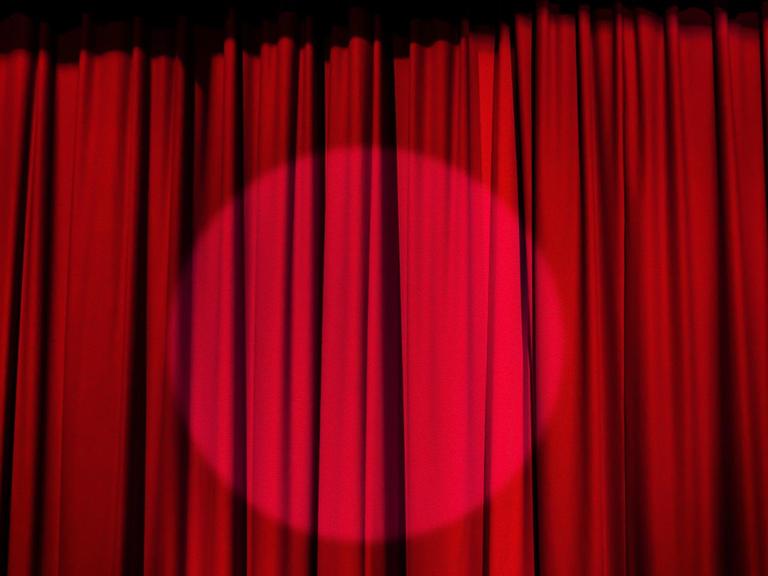Wie Bühnen sich für Diskriminierung sensibilisieren können
07:13 Minuten

Theater wähnen sich auf der Seite des Guten. Doch auch dort gibt es rassistische Vorfälle wie aktuell in Düsseldorf. Eine entsprechende Klausel in den Verträgen der Bühnen kann diese zwar nicht verhindern, aber dabei helfen, damit besser umzugehen.
Am Düsseldorfer Schauspielhaus wird gerade nach rassistischen Vorfällen sehr umfassend über Rassismus und Machtstrukturen an deutschen Theatern diskutiert. Für die zumeist von weißen Männern geleiteten Bühnen kommt diese Debatte auch deshalb überraschend, weil, wie Intendant Winfried Schulz am Montag sagte, sich Theater eigentlich auf der Seite des Guten, Wahren und Schönen wähnt, bei den Unterdrückten und nicht auf der Seite der Unterdrücker.
Teil der Betriebsvereinbarung
Solche Debatten um Machtverteilung und die Teilhabe von Frauen oder Menschen of Color sind nicht neu. So hat die Rechtsanwältin Sonja Laaser gemeinsam mit der Regisseurin Julia Wissert, die mittlerweile Intendantin am Schauspiel Dortmund ist, vor gut zwei Jahren eine Antirassismusklausel erarbeitet. Diese soll dabei helfen, in Fällen von rassistischer oder anderer Diskriminierung zwischen Macht und Ohnmacht zu vermitteln.
Mittlerweile gebe es an einigen Häusern auch eine erweiterte Antidiskriminierungsklausel, wie Laaser erläutert. Beide Klauseln dienten dazu, "dass wenn sich eine Person diskriminiert oder rassistisch behandelt fühlt, eine Maßnahme zu fordern". Das könne eine Mediation sein, um einen Vorfall aufzuarbeiten, eine Empowerment-Maßnahme, um Betroffene zu stärken, oder eine Fortbildung des Hauses, um für rassistische und diskriminierende Strukturen zu sensibilisieren.
In der freien Theaterszene sei die Klausel bereits von vielen Gruppen, Künstlern und Häusern aufgenommen worden, berichtet die Juristin. Bei städtischen und Staatsbühnen sei die Abwehr größer. Es gebe seit Kurzem drei Häuser, die die Klausel in ihre Verträge aufgenommen haben, ohne sie so zu nennen; stellenweise sei die Klausel, so Laaser, "ein ideologischer Kampfbegriff" geworden. Eine Ausnahme sei das Theater an der Parkaue, Berlins junges Staatstheater, wo die Klausel sowohl Teil einer Betriebsvereinbarung sowie der Verträge sei und bereits dreimal zur Anwendung kam.
An vielen Theatern habe es an einem Bewusstsein über Rassismus im Theaterbereich gefehlt, vermutet Laaser über die Gründe, warum nur wenige staatlichen Bühnen die Klausel eingeführt haben. Nach den Abwehrreaktionen habe sich dies aber in den vergangenen Jahren geändert.
Kein Allheilmittel
Ob die Klausel einen Fall wie in Düsseldorf, wo der schwarze Schauspieler Ron Iyamu unter seinem vermeintlichen "Probennamen" als "Sklave" angesprochen wurde, hätte verhindert werden können, kann die Rechtsanwältin natürlich nicht sagen: "Die Klausel ist kein Allheilmittel." Doch gehe sie davon aus, so Laaser, dass wenn die Klausel schon eine längere Zeit existiert und Sensibilisierungsmaßnahmen stattgefunden hätten, die rassistischen Vorfälle nicht kommentarlos hingenommen worden wären.
"Wenn der ganze Raum sensibilisiert ist, wird auch grundsätzlich anders reagiert. Fehler passieren immer. Das ist auch nicht das Problem, sondern der sofortige Umgang damit." Hinzukomme, unterstreicht Laaser, dass beispielsweise am Theater an der Parkaue neben der Klausel auch Strukturen etabliert wurden, um schnell mit konkreten Vorfällen umzugehen.
(rzr)