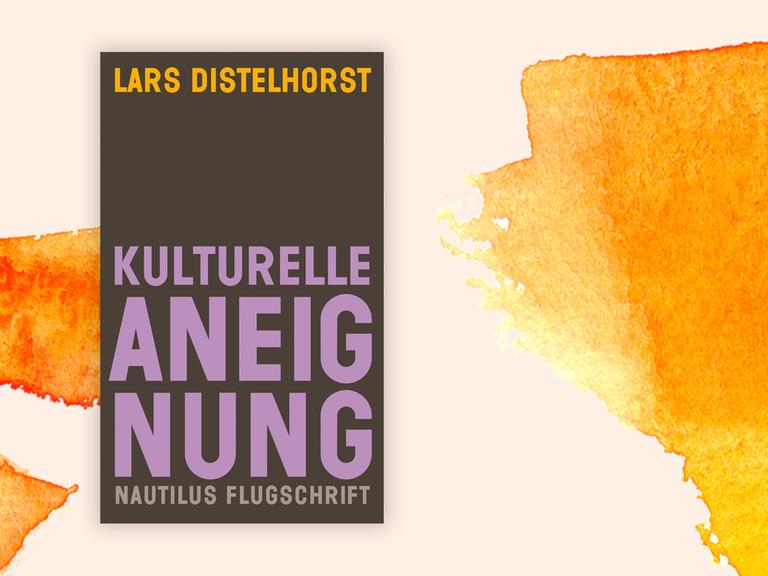Stanislaw (Stan) Strasburger ist Schriftsteller, Publizist und Kulturmanager. Seine Schwerpunkte sind Erinnerung und Mobilität, er sucht nach der EUtopie und schätzt die Achtsamkeit. Sein aktueller Roman „Der Geschichtenhändler“ erschien 2018 auf Deutsch (2009 auf Polnisch und 2014 auf Arabisch). Der Autor wurde in Warschau geboren und lebt abwechselnd in Berlin, Warschau und diversen mediterranen Städten. Zudem ist er Ratsmitglied des Vereins „Humanismo Solidario“.
Die hässliche Fratze lebt fort
04:32 Minuten

Vordergründig ist Rassismus heute verpönt. Doch in vielen Erzählungen und Überlieferungen leben kolonialer Dünkel und Misstrauen gegen das Andere fort, beklagt Stanislaw Strasburger. Er fordert, solchen machtgetränkten Narrativen entgegenzutreten.
Die Herbstmonate dieses Jahres verbringe ich in Granada. Die Sonne scheint, Menschen kommen wieder zusammen in Cafés und Bars, das Leben zeigt sein schönes Gesicht. Doch meine literarische Recherche führt mich zu den dunklen Seiten der Geschichte. Bekanntlich ist das maurische Granada im selben Jahr in die Hände des Königspaars Isabella und Ferdinand gefallen, in dem Kolumbus nach Amerika kam. Mit dem Sieg über die europäischen „Anderen“ wurden in Übersee neue „Andere“ geschaffen.
In „Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen“ verweist Tzvetan Todorov auf Kolumbus, der schreibt: „Sie nahmen alles an, sogar zerbrochene Fassreifen, und gaben, was sie hatten [lies: Gold], wie hirnlose Tiere.“ Selbstverständlich ist der Wert einzelner Gegenstände rein konventioneller Natur, und so gesehen ist Gold an sich nicht mehr wert als Glasperlen. Dennoch, das Bild, das hiermit in die Welt gestreut wird, ist das des dummen Wilden und des Schlaubis Kolumbus.
Kolumbus fügt sich damit in eine Reihe von Entdeckern, Experten bis hin zu Reisenden und Journalisten ein, die das sogenannte Framing des „Anderen“ seit Jahrhunderten betreiben. Die aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammenden Anweisungen des spanischen Königs zum Vorgehen in „Indien“ sind ein Beispiel für die Institutionalisierung solcher Imagekampagnen:
„Die Entdeckungen sollten nicht als Eroberungen bezeichnet werden (...). Wir werden unter dem Deckmantel des Tausches und des Handels freundschaftliche Beziehungen zu ihnen aufbauen, indem wir ihnen viel Zuneigung zeigen, ihnen schmeicheln und kleine Geschenke machen (...). Derweil sollten Priester unter dem Vorwand der Bildungsarbeit verlangen, dass sie ihre Kinder mitbringen, um sie fortan als Geiseln halten zu können (...). Auf diese Art und Weise (…) werden wir sie unterjochen und indoktrinieren können.“
Eine Belastung auch für europäische Nachbarschaften
Aus heutiger Sicht klingen solche direkten Worte überaus zynisch. Doch nicht zuletzt mit Blick auf den Irak oder Afghanistan kann man sich fragen, ob die zeitgenössische Praxis sich wirklich so sehr verändert hat.
Besonders bedrückend wirkt auf mich, dass an die hässliche Fratze, wie es der polnischsprachige Schriftsteller Witold Gombrowicz sagen würde, nicht nur die Macher selbst, sondern auch diejenigen glauben sollen, denen man sie aufsetzt. Nicht nur wir, sondern auch sie selbst sollen daran glauben, dass sie dumme Wilde sind.
Diese Prozesse spiegeln sich nicht nur in heutigen Debatten um Kolonialismus und Rassismus wider, sondern belasten auch europäische Nachbarschaften. Als Beispiel sei hier ein Max Weber genannt, der den Polen „einen Kulturrückschritt von mehreren Menschenaltern“ bezeugte und schrieb, sie würden „verschieden konstruierte Mägen“ haben, da sie ja „das Gras vom Boden fressen“.
Auch wir selbst bleiben uns fremd
In diesem Sinne erscheinen ein Großteil unseres gesamten Wissens über die vergangenen Jahrhunderte und die seit Generationen verinnerlichten Bilder des „Anderen“ eine Art Archives of repressions zu sein. Das Tragische dabei ist, dass solche Quellen oft auch die Stimmen der Opfer vereinnahmen, denn sie sind die einzigen, die uns heute zur Verfügung stehen.
Solang wir mit solchen Archiven hantieren, hindern wir als Gesellschaft und als Land uns massiv selbst daran, den Herausforderungen der globalen, mobilen Welt gerecht zu werden. Mit der Erwartung, wir müssten doch die Schlaubis sein, werden wir zahlreiche Menschen mitten unter uns als Fremde erleben. Mehr noch, wir werden uns selbst fremd bleiben.
Jenseits des tagesaktuellen Tauziehens nach den Bundestagswahlen wünsche ich mir von der Politik mehr Anreize dazu, systematisch in Bildungsprogrammen, im Umgang mit Sammlungen in öffentlichen Museen, aber auch mit (Reise-)Literatur und journalistischer Berichterstattung, den von machtgetränkten Projektionen überfüllten Narrativen über die „Anderen“ entgegenzutreten.