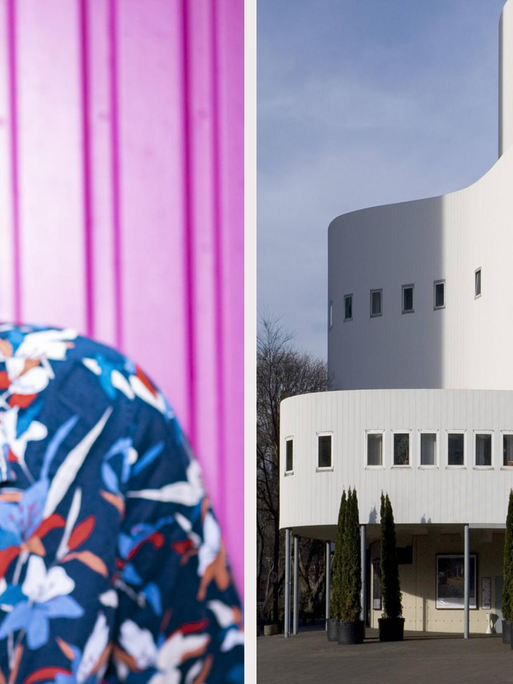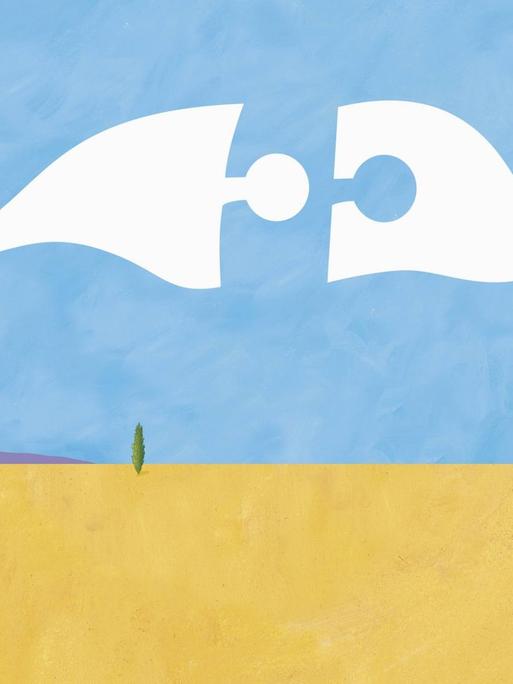Nicola Schubert ist Schauspielerin und freie Autorin. Sie begann bei den "Ruhr Nachrichten" und Radio 91,2 in Dortmund und mit einem Theater- und Medienwissenschaftsstudium. Zurzeit ist sie, nach Schauspieldiplom in Frankfurt am Main und Erstengagement in Ostwestfalen, am Theater Ulm engagiert.
Theater braucht einen Schutzraum
04:47 Minuten

Die eigene Alltagsempfindlichkeit gehöre nicht auf die Probe, schrieb Dramaturg Bernd Stegemann als Reaktion auf die Rassismusvorwürfe gegen das Schauspielhaus Düsseldorf. Schauspielerin Nicola Schubert fordert hingegen sogar mehr Verletzlichkeit.
Wir stellen uns an? Wir sollen uns anstellen! Unsere Verletzlichkeit ist unser Kapital. Als Schauspieler*innen sind wir dafür geschult. Das genaue Erspüren dessen, was unser Gegenüber oder die Regie von uns wollen. Dafür braucht es Offenheit und feine Sensoren.
Im ganzen Schauspielstudium geht es darum. Wir beschäftigen uns mit zwischenmenschlichen Dynamiken und deren Zwischentönen, um sie fürs Spiel nutzen zu können.
Es geht um keine Kleinigkeit
Außerhalb der Rolle sollen wir uns allerdings nicht so anstellen, eben keine Mimosen sei, sondern harte Knochen, die was aushalten, und gerade wenn es um schwierige Situationen in und um Proben geht, die Alltagsempfindlichkeiten außen vorlassen. So zumindest der Dramaturg Bernd Stegemann. Er zeigt sich in der "FAZ" als Vertreter dieser "alten Schule": Verletzlichkeit – er spricht von Alltagsempfindlichkeit – auf der Bühne ja, daneben bitte nicht.
Dabei geht es im konkreten Fall um keine Kleinigkeit. Der Schauspieler Ron Iyamu schildert manifeste rassistische Beleidigungen in Probensituationen. Das N-Wort sei gefallen und er sei in derbem Scherz als Sklave bezeichnet worden. Das alles innerhalb der Probe, aber außerhalb der Rolle. Oder vielleicht doch innerhalb Rolle, die sich im Spiel ja manchmal ausweite, fragt Stegemann?
Auf jeden Fall – und das ist fester Bestandteil der derzeitigen Diskussionen um Rassismus und Identitätspolitik – sollen sich die Betroffenen nicht so haben. Schließlich gebe es Wichtigeres. Am Theater ist dieses Wichtigere die Kunst. Die darf nach dieser Logik auch von weniger, zum Beispiel dem Beanstanden einer simpleren Beleidigung, nicht gefährdet werden.
Emotionen nur auf der Bühne
Die "Beschwerdelage" für Schauspieler*innen ist also generell ungünstig. Sie sollen als Menschen nur auf der Bühne durchscheinen, ihre eigenen Emotionen haben keine Berechtigung. Am Theater eigentlich paradox, geht es gerade dort ja um Emotionen. Doch eben selektiv. Bestimmt werden Orte erlaubter oder unerlaubter Verletzlichkeit oft von denjenigen, die nicht auf der Bühne stehen, sondern aus sicherer Entfernung, etwa vom Regietisch, auf sie schauen. Sie kommentieren die erwünschten Emotionen auf der Bühne.
Wir brauchen ihr Feedback auch. Wir brauchen aber ebenso Rückhalt. Das gilt besonders, wenn Gewaltszenen oder Diskriminierung Eingang in die Probe finden. Es ist unser Beruf, emotionale Arbeit als Arbeit zu verrichten, mit affektiven Schwankungen umzugehen und sie nicht mit eigenen Gefühlen zu verwechseln. Und ja – wir müssen uns auch selbst "fangen", in oder nach heftigen Proben. Wenn es persönlich beleidigend wird, ist die Lage jedoch anders. Denn es ist hier nicht die Rede von Launen. Es geht um die Forderung nach einem respektvollen Umgang. Der ist nicht gleichbedeutend mit Samthandschuhen oder Kunstfeindlichkeit, wie Bernd Stegemann vielleicht fürchtet.
Theater braucht einen Schutzraum. Es wäre ein Widerspruch anzunehmen, dass Spielende sich nur für die Figur verletzlich machen können, sonst aber über grenzenlose Abwehrmechanismen verfügen. Gerade die Einheit von Figur und spielender Person ist gewünscht. Diese Einheit bei schweren Beleidigungen beibehalten zu müssen, würde Selbstaufgabe bedeuten. Natürlich im Interesse der Figur, wie es dann heißt. Doch Figuren speisen sich auch aus der Persönlichkeit: sonst würde ja jeder Faust gleich gespielt.
Theater braucht einen Schutzraum. Es wäre ein Widerspruch anzunehmen, dass Spielende sich nur für die Figur verletzlich machen können, sonst aber über grenzenlose Abwehrmechanismen verfügen. Gerade die Einheit von Figur und spielender Person ist gewünscht. Diese Einheit bei schweren Beleidigungen beibehalten zu müssen, würde Selbstaufgabe bedeuten. Natürlich im Interesse der Figur, wie es dann heißt. Doch Figuren speisen sich auch aus der Persönlichkeit: sonst würde ja jeder Faust gleich gespielt.
Gesellschaften werden sensibler
Jemandem, der Grenzüberschreitungen benennt, ein Aussteigen aus dem schauspielerischen Vorgang vorzuwerfen, wie Bernd Stegemann es gegenüber Ron Iyamu tut, ist ein gängiges Prinzip, mit dem Schauspieler*innen klein gehalten werden. Iyamu hat rassistische Diskriminierung erlebt, jetzt wird er auch noch dafür kritisiert, dass er diese anprangert – und zwar als Person of Color und als Schauspieler.
Aber: Gesellschaften werden sensibler. Auch wenn es immer noch heißt: Stellt euch nicht so an. Das Eingeständnis von Verletzbarkeit ist im Übrigen nicht nur Schauspieler*innen vorbehalten. Auch Theaterleitungen können und dürfen sich dem – übrigens patriarchal geprägten – Imperativ der Härte entziehen.
Aber: Gesellschaften werden sensibler. Auch wenn es immer noch heißt: Stellt euch nicht so an. Das Eingeständnis von Verletzbarkeit ist im Übrigen nicht nur Schauspieler*innen vorbehalten. Auch Theaterleitungen können und dürfen sich dem – übrigens patriarchal geprägten – Imperativ der Härte entziehen.