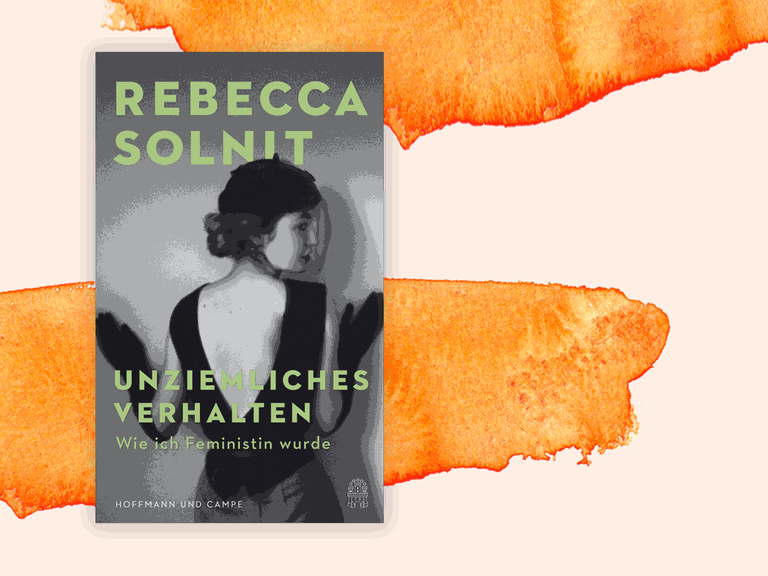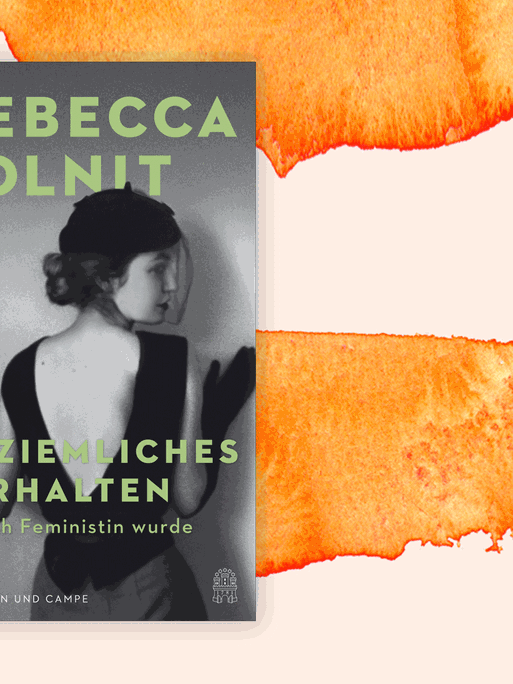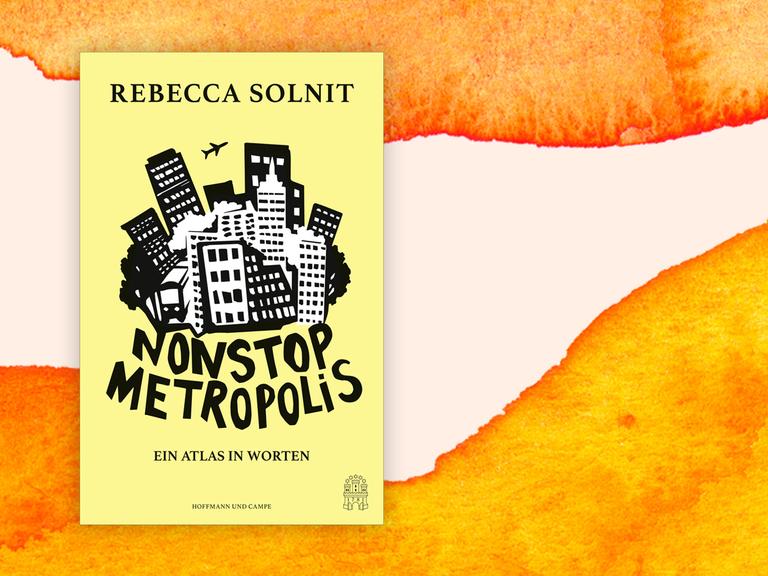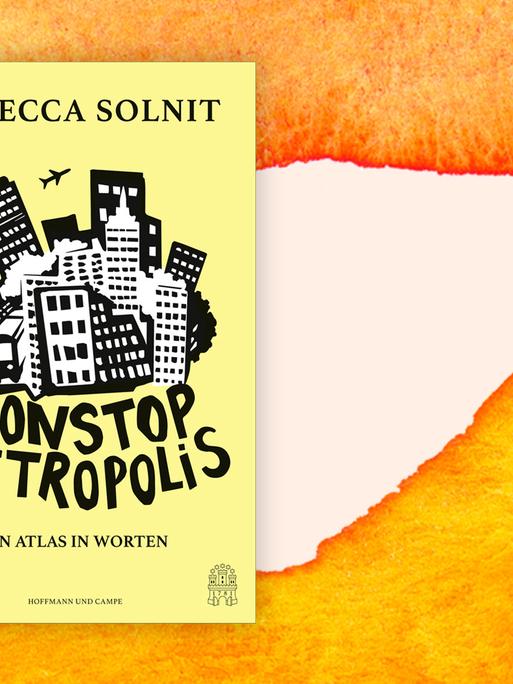Rebecca Solnit: "Die Kunst, sich zu verlieren"
Matthes & Seitz Berlin
250 Seiten, 22 Euro
Persönliche Irrfahrten durch die USA
07:07 Minuten

Rebecca Solnit nimmt in ihrem Buch die Leser mit auf den nordamerikanischen Kontinent. Es handelt von europäischen Ankömmlingen in einer Welt, die nur ihnen als neu erschien. Und immer wieder geht es um das Einschlagen unbekannter Wege.
"Irgendwie dachte ich an Dich, frag mich nicht, warum." So endet die Mail meiner Redakteurin, mit dem Auftrag, "Die Kunst, sich zu verlieren" von Rebecca Solnit zu besprechen. Die Nachricht erreichte mich unterwegs nach Italien, einem Ort wie geschaffen, sich zu verlieren, auf dem Ruinenfeld des römischen Ostia Antica unter schweißtreibender Spätsommersonne, oder im Gassengewirr von Genua, auch wenn ich im Zug unterwegs bin und nicht zu Fuß, wie Seume nach Syrakus oder wie Eichendorffs Taugenichts "zwischen den grünen Bergen und an lustigen Städten und Dörfern vorbei gen Italien hinunter".
"Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, dass ich eigentlich den rechten Weg nicht wusste."
"Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, dass ich eigentlich den rechten Weg nicht wusste."
Unterwegs, sich zu verlieren – auch Solnit schreibt darüber. Ihre erste Erinnerung führt sie allerdings zurück in die eigene Kindheit: Es ist der Seder-Abend vor dem Pessach-Fest, zu dem sich ihre jüdisch-katholische Familie versammelt hat. Unbemerkt von den Erwachsenen trinkt die kleine Rebecca den Becher Wein, der eigentlich für den Propheten Elia bestimmt ist. Solnit erinnert sich an "ein Gefühl der Gelassenheit in der plötzlich spürbaren Schwere eines kleinen Körpers".
Sich in der Wildnis verlieren
Rausch als Erfahrung, sich zu verlieren … Ich habe meine Redakteurin in Verdacht, dass sie deswegen an mich dachte, in Erinnerung an die eine oder andere gemeinsame erlebte berauschte Partynacht und an meine Erzählungen rauschhafter Abenteuer mit Wildfremden im Club oder sonst wo. Solnit allerdings belässt es bei dem einen Kinderrausch. Stattdessen nimmt sie ihre Leserschaft mit auf Reisen, nein, nicht nach Italien, sondern durch den nordamerikanischen Kontinent.
Ihre Geschwister im Geist sind nicht die Romantiker des frühen 19. Jahrhunderts, sondern die europäischen Ankömmlinge in einer Welt, die nur ihnen als neue Welt erschien, als "Terra incognita". Diese Amerikaner wussten nicht, wo sie sind, schreibt sie, und es habe sie auch nicht sonderlich interessiert. Sie zitiert den aus Uruguay stammenden Schriftsteller Eduardo Galeano, der in den "offenen Adern Lateinamerikas" die These aufstellt, dass Amerika, zwar erobert, aber nicht entdeckt worden sei.
Solnit folgt nicht den breiten Schneisen, die die Conquistadores durch den Urwald auf der Suche nach dem Eldorado schlugen, oder den endlosen Planwagen-Kolonnen der Siedler Richtung Westen. Sie erinnert an die, die sich in der Wildnis verliefen und ein neues Leben fanden, wie die Puritanerin Eunice Williams, die 150 Jahre später von Mohawk Indianern entführt wurde, einen Mohawk heiratete, eine Familie gründete und es später vorzog, als "Wilde" zu leben, als auf den "rechten Weg" der weißen Kolonisatoren zurückzukehren.
Verlust von Sprache und Traditionen
"Verliert man sich, ist die Welt größer geworden als das Wissen, das man von ihr hat", schreibt Solnit. Sie erzählt Geschichte aus dem Blickwinkel von Außenseiterinnen, die den Weg zurück in den Mainstream verschmähten. In den Passagen über die Irrwege des jüdischen Teils ihrer Familie, die sich in den Gassen russischer Shtetl verlieren, beschreibt sie den Preis, den ihre Groß- und Urgroßeltern zahlten, um im amerikanischen Mainstream anzukommen: Über den Verlust des angestammten Familiennamens vor den Einwanderungsbeamten in Ellis Island bis zum Verlust der eigenen Sprache und eigener Traditionen.
Dass in dieser jüdischen Tradition das Sich-Verlierens mit der Exodus-Geschichte, in der die Israeliten immerhin 40 Jahre durch die Wüste irren, einen festen Platz einnimmt, ist ihr allerdings keine Zeile wert. Dafür schildert sie seitenlang die eigene Heimatlosigkeit angesichts einer Familie, in der die alten Geschichten zu klischeehaften Anekdoten geronnen sind.
"Manchmal glaube ich, ich bin Historikerin geworden, weil ich keine Geschichte habe", bekennt Solnit. Die sucht die Kulturhistorikerin, Feministin, Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin auf ihren ganz persönlichen Irrfahrten kreuz und quer durch die USA. Seite um Seite beschreibt sie ihre Erlebnisse in diversen amerikanischen Nationalparks. Für jemanden, der wie ich, mit den Wüstenlandschaften der USA vor allem das Aussteiger-Hippiefestival von Burning Man in Nevada und bewusstseinserweiternden Substanzen verknüpft, eine wenig wegweisende Lektüre.
"Manchmal glaube ich, ich bin Historikerin geworden, weil ich keine Geschichte habe", bekennt Solnit. Die sucht die Kulturhistorikerin, Feministin, Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin auf ihren ganz persönlichen Irrfahrten kreuz und quer durch die USA. Seite um Seite beschreibt sie ihre Erlebnisse in diversen amerikanischen Nationalparks. Für jemanden, der wie ich, mit den Wüstenlandschaften der USA vor allem das Aussteiger-Hippiefestival von Burning Man in Nevada und bewusstseinserweiternden Substanzen verknüpft, eine wenig wegweisende Lektüre.
Feldbücher und Landschildkröten
Der englische Originaltitel des Buchs lautet: "A field guide to getting lost". Ein "field guide" werden auch botanische und zoologische Bestimmungsbücher genannt. In der Tat wimmelt es in Solnits Essay von seltenen Vögeln, großen und kleinen Nagern. Besonders Landschildkröten haben es der Autorin angetan. Die Rückbesinnung auf die unberührte Flora und Fauna steht in der Tradition des amerikanischen Transzendentalismus. Denker wie Henry David Thoreau und Ralph Waldo Emerson verknüpften darin europäische Romantik mit Zivilisation und Kulturkritik. Thoreau gilt als der Erfinder des zivilen Ungehorsams. Erstaunlich, dass Solnit ihn nur einziges Mal zitiert: "Nicht eher als bis wir die Welt verloren haben, fangen wir an, uns selbst zu finden."
Solnit schreibt ausführlich über das irrlichternde Blau in den monochromen Bildern von Yves Klein, aber die blaue Blume der Romantik fehlt. Immerhin entdecke ich einen Dichter, der mir auf meiner Italienreise immer wieder begegnet: Dante. Solnit zitiert ihn einmal mit einer Zeile aus der "Divina Commedia". Dabei wäre selbst dem Kellner, der meinem Gastgeber und mir unseren Aperitif bringt, ein besseres Zitat zur "Kunst, sich zu verlieren" eingefallen: "Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich in einem finsteren Wald wieder, denn der gerade Weg war verloren."
Solnit braucht knapp 200 Seiten, wofür Dante drei Zeilen braucht. Dann doch lieber sich selbst verlaufen, egal wo.
Solnit schreibt ausführlich über das irrlichternde Blau in den monochromen Bildern von Yves Klein, aber die blaue Blume der Romantik fehlt. Immerhin entdecke ich einen Dichter, der mir auf meiner Italienreise immer wieder begegnet: Dante. Solnit zitiert ihn einmal mit einer Zeile aus der "Divina Commedia". Dabei wäre selbst dem Kellner, der meinem Gastgeber und mir unseren Aperitif bringt, ein besseres Zitat zur "Kunst, sich zu verlieren" eingefallen: "Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich in einem finsteren Wald wieder, denn der gerade Weg war verloren."
Solnit braucht knapp 200 Seiten, wofür Dante drei Zeilen braucht. Dann doch lieber sich selbst verlaufen, egal wo.