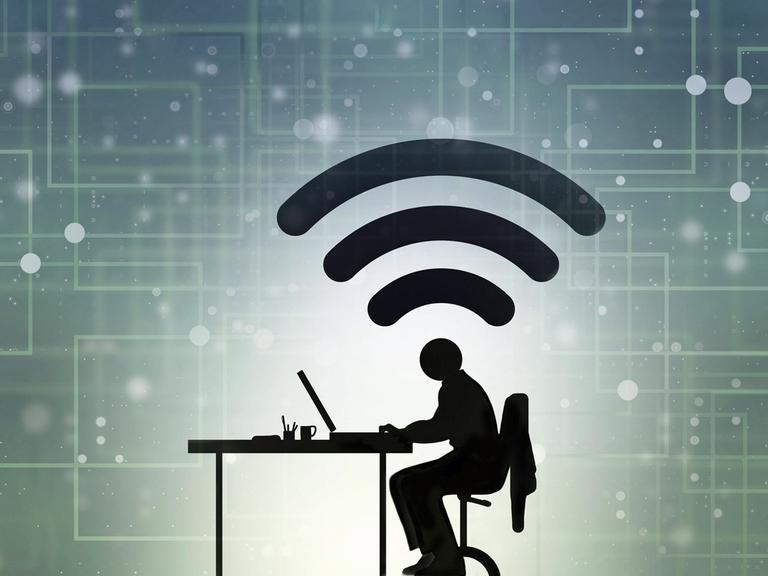Für die Betroffenen nimmt der Schrecken kein Ende
11:04 Minuten

In der kommenden Woche beginnt der größte Terrorprozess in der Geschichte Sachsen-Anhalts: Stephan B. muss sich für den Anschlag auf die Synagoge in Halle und wegen zweifachen Mords verantworten. Ein Ortsbesuch in Halle und Benndorf.
Ismet Tekin sitzt vor seinem Imbissladen in Halle an der Saale. Drinnen an einer Wand hängt eine goldene Gedenktafel, darauf die Namen von Kevin und Jana. Jeden Tag erinnert die Tafel Tekin daran, was hier im vergangenen Jahr am 9. Oktober passiert ist.
Kevin macht im "Kiez-Döner" gerade Mittagspause, als der mutmaßliche Attentäter Stephan B. mehrmals auf den Imbissladen schießt und dabei Kevin tödlich trifft. Er zielt auch auf Tekin und seinen Bruder Rifat. Doch die beiden kurdisch-stämmigen Türken haben Glück. Sie überleben. Doch Tekin fällt es schwer, die Tat zu verarbeiten, er hat noch immer Alpträume:
"Jemand kommt und schießt auf uns, zwei Menschen sind gestorben. Viele Menschen sind psychisch kaputtgegangen. Wir können das nicht noch verarbeiten, dazu kommt noch die finanzielle Krise."
Nicht als Nebenkläger zugelassen
Denn Tekin hat Schulden. In der Coronazeit musste er mehrere Wochen schließen. Die Miete für den Laden kann er immer noch nicht zahlen.
Inzwischen läuft es finanziell wieder etwas besser. Doch nun der nächste Tiefschlag: 40 Nebenkläger hat die Generalbundesanwaltschaft zum Prozess gegen Stephan B. zugelassen. Tekin gehört nicht dazu.
"Enttäuscht? Viel enttäuscht. Also ich komme dahin, die Kugeln fliegen über meinen Kopf auf die Wand. Aber das Gericht beschließt, dass ich nicht bin Nebenkläger."
"Enttäuscht? Viel enttäuscht. Also ich komme dahin, die Kugeln fliegen über meinen Kopf auf die Wand. Aber das Gericht beschließt, dass ich nicht bin Nebenkläger."
Völlig unverständlich, findet auch Tekins Anwalt Onur Özata aus Berlin. Er hält die Entscheidung der Bundesanwaltschaft für juristisch und sachlich falsch. Ein Beschluss, der besage:

Ismet Tekin hat mit den Folgen des Anschlags auf seinen "Kiez-Döner" in Halle zu kämpfen.© Deutschlandradio / Niklas Ottersbach
"Der Attentäter wollte gar nicht irgendwelche Passanten oder meinen Mandanten treffen, sondern der wollte ausschließlich die Polizei attackieren. Das halte ich für eigenartig, so etwas anzunehmen. Zumal wir wissen, mit welchem Ziel er sich aufgemacht hat, in die Innenstadt zu gehen. Mit welcher Bewaffnung er losging. Mit welchem Weltbild er losging. Dass er auch versucht hat, insbesondere Passanten umzubringen, die er als Muslime erkannt haben will."
Einschusslöcher sind noch immer zu sehen
Bislang ist das zuständige Oberlandesgericht Naumburg der Bundesanwaltschaft gefolgt. Auf Deutschlandradio-Anfrage will sich das OLG Naumburg zu einzelnen Nebenkläger nicht äußern. Bestätigt aber, dass mehrere Nebenklageanträge abgelehnt wurden.
500 Meter vom Kiez-Döner entfernt liegt die Synagoge. Noch immer sind die Einschusslöcher in der massiven Holztür zu sehen. Sie hat 50 Jüdinnen und Juden an Jom Kippur das Leben gerettet.
Max Privorozki, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, erzählt, wie er über eine Überwachungskamera dabei zusehen konnte, wie Stephan B. an der Eingangstür zunächst scheiterte und dann aus Frust eine Passantin erschoss.
"Frau, den Namen werde ich nicht sagen, nach Vornamen Jana. Sie wurde eigentlich vor der Synagoge ermordet. Ich persönlich konnte sehen, wie das geschehen ist. Das kann man wirklich nie vergessen und wahrscheinlich auch nie verzeihen."
Eine der ersten Maßnahmen der Landesregierung nach dem Anschlag: permanente Polizeibewachung aller Synagogen in Sachsen-Anhalt. Vor dem 9. Oktober war das nicht so.
Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Magdeburger Landtag gab die Revierleiterin aus Halle zu Protokoll: Sie wusste nichts von Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Eine konkrete Sicherheitsanfrage der jüdischen Gemeinde habe es aber auch nicht gegeben.
Kommunikation zwischen der Jüdischen Gemeinde Halle und der Polizei, sie findet kaum statt: Das ziehe sich schon länger so hin, sagt der gebürtige Ukrainer Privorozki.
Zum Beispiel 2014, zu Zeiten des Gaza-Krieges zwischen Israelis und radikalen Palästinensern, da habe die Polizei die hallesche Synagoge strenger bewacht. Ohne, dass Privorozki darum gebeten habe.
"Dann hat Polizei mitgeteilt, jetzt ist vorbei. Die sehen das anders und jetzt wird Polizei nicht immer präsent bleiben. So war immer. Polizei hat selber entschieden, wann die präsent sind. Wenn die entschieden haben, nicht präsent zu sein. Dann sind die nicht da."
Ausbruchsversuch von Stephan B.
Seit dem Anschlag ist im Leben von Privorozki viel passiert: Jeden Tag Medienanfragen, Staatsbesuche: Von Bundespräsident Steinmeier bis US-Außenminister Pompeo.
Dann kam Corona und das bedeutet bis heute für die 500-köpfige Jüdische Gemeinde in Halle: Es finden kaum noch Veranstaltungen statt.
Nun der Prozess, in dem Privorozki als Nebenkläger auftreten wird. Über Antisemitismus in der Gesellschaft macht er sich keine Illusionen: Er gehört zu seinem Alltag. Zuletzt hat jemand vor dem Gemeindehaus Hakenkreuze aus Papier geformt. Das komme öfter vor, sagt Privorozki.
Was diesmal bemerkenswert war: Der Polizist, der den Straftatbestand aufnehmen sollte, habe versucht, die Tat zu vertuschen.
"Mindestens das, was ich selber gesehen habe auf unserer Kamera. Der Mann hat versucht, dieses Hakenkreuz aus Papier zu vernichten. Er hat es nicht nur versucht, er hat es vernichtet. Überreste von diesem Papierstück hat er zur Seite geschoben, und zwar so, dass der zweite Polizist nicht sehen konnte. Also, das sieht man ganz offensichtlich auf Aufnahme. Wenn so was passiert, dann verliert die Polizei an Glaubwürdigkeit."
Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle gegen den Polizisten wegen Strafvereitelung im Amt. Doch es ist nicht das erste Mal, dass Privorozkis Vertrauen in die Behörden erschüttert wurde.
Vor wenigen Wochen konnte Stephan B., der mutmaßliche Attentäter von Halle, unbewacht über eine drei Meter hohe Gefängnismauer klettern. Eigentlich soll er immer von zwei Justizvollzugsbeamten bewacht werden. Doch die JVA in Halle hatte eigenmächtig die Sicherheitsvorkehrungen gelockert.
Von Sicherheitsbehörden übersehen
Es folgte: erst einmal nichts. Der Vorfall wurde nicht gemeldet. Erst Tage später kam der Ausbruchsversuch raus, als Konsequenz wurde der Staatssekretär im Justizministerium in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Die zuständige Ministerin ist noch im Amt.
Erst die ungeschützte Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag, dann der laxe Umgang mit dem Täter. Für Rechtsextremismusexperte Torsten Hahnel vom Verein Miteinander e.V. ein doppeltes Versagen:
"Nun ist die Tat passiert, wir haben den Täter. Und er wird wieder so behandelt, als wäre er nicht ein Schwerverbrecher, der hier versucht hat, ein Massaker an der Jüdischen Gemeinde anzurichten, und ganz nebenbei zwei Menschen ermordet hat, sondern als wäre er ein ganz normaler Gefangener. Das kann ich nur als Fahrlässigkeit bezeichnen. Das auch die Aufarbeitung wieder eher so schleppend wirkt und es wenig Zuständigkeiten gibt, die sagen, wir haben einen Fehler gemacht, es ist unverzeihlich. Das zeigt, dass sich die politische Kultur relativ wenig verändert hat."
Es zeigt auch, dass Stephan B. schon wieder "übersehen" wurde. Die Sicherheitsbehörden hatten ihn im Vorfeld nicht auf dem Schirm. Aber wer ist dieser 28-jährige Mann?
Ein Besuch in seinem Heimatort Benndorf im Mansfelder Land. Eine Bergbauregion. Bis zum Mauerfall haben die Leute in engen Schächten Kupferschiefer abgebaut. Danach brach der Bergbau zusammen, die Betriebe wurden abgewickelt. Noch heute leiden die Menschen in der Region darunter.
Seit dem Ende der DDR hat Benndorf die Hälfte seiner Einwohner verloren. Jetzt leben noch 2000 Menschen hier. Da kennt man sich doch. Oder?

Benndorf ist der Heimatort von Stephan B.© Deutschlandradio / Niklas Ottersbach
Georg Kühne, gebürtiger Benndorfer, kann sich noch gut dran erinnern, als es hieß, der Attentäter aus Halle komme aus seinem Heimatort.
"Na entsetzt war ich, weil er wohnte ja dort und ich wohne einen Block weiter vor. Ich kannte den gar nicht."
Egal wen man fragt, immer dasselbe Bild. Ein junges Paar, Ende 20, er geht mit dem Hund Gassi, sie begleitet ihn. Der Attentäter aus ihrem Ort?
"Stephan B.? Ne, kennen wir auch nicht. Keine Ahnung. Hatte wohl keinen Kontakt mit den Leuten. Ist doch merkwürdig, dass wir den alle nicht kennen, oder? Wahrscheinlich nur so Computerspiele gespielt. So rumjeballert. Na ja, doch. Wird schon so sein. Stubenhocker!"
"Eigentlich war er ein Mitläufer"
Eine, die Stephan B. zumindest indirekt kennt, ist Sigrid Kriskuwiak. 60 Jahre alt. Ihr Sohn sei mit Stephan B. gemeinsam eine Zeit lang zur Schule gegangen.
"Also, er war, so wie der Junge gesagt hat, sehr ruhig. Eigentlich war er ein Mitläufer. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil der Junge hat darüber auch nicht gesprochen. Ich weiß nur, die Mutter ist auch weggezogen. Die hat es nicht ausgehalten hier und sie war ja auch eine Zeit lang in der Psychiatrie, um das überhaupt zu verarbeiten. Als Mutter, ob man das verarbeiten kann, ich weiß nicht."
Die Eltern von Stephan B. leben getrennt: Er wohnte bei seiner Mutter. Sie ist von Beruf Grundschullehrerin. Ihre Fächer: Deutsch, Mathe und Ethik. Am Tag des Anschlags sagte sie einem Kamerateam von Spiegel TV, ihr Sohn habe nichts gegen Juden, sondern nur was gegen Leute, die die finanzielle Macht hätten. Wer habe das nicht? Zitat Ende.
Rechtsextremismusexperte Hahnel sagt dazu:
"Ich bin mir sicher, dass es natürlich mit Menschen aus seinem Umfeld zu tun haben muss. In der ostdeutschen Provinz aufwachsen heißt halt auch, mit wenig Widerspruchskultur gegen Rassismus und gegen Demokratiefeindschaft aufzuwachsen. Das äußert sich mal mit Apathie vielleicht auch wirklich mit Demokratieferne. Bei manchen Leuten entwickelt sich dann so ein ausgeprägtes Weltbild und ein Handlungsdruck, der dann wiederum sehr stark mit der Online-Community und der Vernetzung mit rechtsextremen Strukturen zu tun hat."
Beweisstück für die Stadt
Stephan B. bewegte sich im Internet vor allem auf sogenannten Imageboards. Das sind Internetforen, auf denen anonym Bilder und Texte ausgetauscht werden. Das ist eine Welt, die für Ismet Tekin unerklärlich bleibt.
Der Chef vom "Kiez-Döner" in Halle will aber verstehen, woher der Hass von Stephan B. kommt. Er hofft darauf, doch noch als Nebenkläger auftreten zu dürfen. Ihm ist es wichtig, dass auch er offiziell als Opfer rassistischer Gewalt anerkannt wird.
Und seinen Döner-Imbiss, der zum Tatort wurde, den will er weiterführen, auch wenn es finanziell schwierig wird. Aufgeben kommt für Tekin nicht infrage.
"Deswegen kämpfe ich hier, weil das ein Beweisstück für diese Stadt, für dieses Land ist."