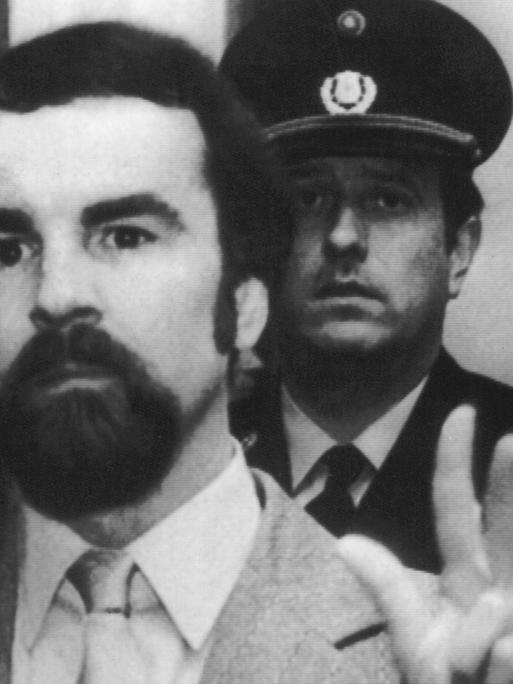Die gesamte Sendung "Der Tag mit Ebru Taşdemir" können Sie hier nachhören: Audio Player
Warum immer Ostdeutschland?

Zu wenig Ausländer? Mangelnde Aufarbeitung der NS-Vergangenheit? Für die offenbar starke Anfälligkeit vieler Ostdeutscher für den Rechtsextremismus werden viele Gründe genannt. Für die Journalistin Ebru Taşdemir liegen diese in der dortigen "Monokultur".
Ob NSU, Gruppe Freital oder jetzt "Revolution Chemnitz" - Rechtsterrorismus scheint gegenwärtig ein ostdeutsches Phänomen zu sein.
"Es findet nur gehäuft dort statt", sagt die Journalistin Ebru Taşdemir. "Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Mölln und Solingen gab", so die freie Redakteurin der "tageszeitung" mit Blick auf die ausländerfeindlich motivierten Morde Anfang der 1990er-Jahre.
"Deutsch-Sein" wichtig für die Rollenprägung
Dass sich militanter Rechtsextremismus derzeit aber doch vor allem in Sachsen und da speziell in Chemnitz manifestiert, mag Taşdemir zufolge daran liegen, dass es dort wenig Menschen gegeben hat, die ausländische Wurzeln haben. Oder an einer speziellen politischen Alltagskultur, in der "Deutsch-Sein" bis hin zum Extremismus besonders wichtig für die Rollenprägung sei:
"Es scheint irgendetwas dort in Sachsen zu passieren, was bedeutet, dass es eben keinen Widerspruch gibt. So kommt mir das vor. Das ist so eine Unkultur von Demokratiemangel und eben auch von einer bestimmten Stärke, die man so demonstrieren will."

Die Publizistin Ebru Taşdemir© Foto: Bettina Fuerst-Fastre
Offenbar habe es dort eine Kultur gegeben, die wenig Raum zum Atmen gelassen habe, sagt Taşdemir und verweist auf einen Artikel ihres Taz-Kollegen Daniel Schulz "Wir waren wie Brüder", in dem dieser sein Aufwachsen im Ostdeutschland der 1990er-Jahre beschreibt: "Schon wenn man anders aussah – es ging ja gar nicht darum, dass man ausländische Wurzeln hatte, aber sobald man lange Haare hatte, eben nicht mit seinen Nazifreunden abgehangen hatte, war man plötzlich anders und war Freiwild."
(uko)