Regieren ohne Kompass?
Ohne Gott ist alles sinnlos. Wenn der Glaube an Gott verloren geht, dann geht auch die Moral verloren. Dann ist im Grunde alles erlaubt, auch der Mord. So geht eine bis heute vorgebrachte Argumentationsfigur.
Dagegen ist zu sagen: Man kann moralisch sein auch ohne Gottesglauben. Wir haben evolutionär erworbene Fähigkeiten wie Vernunft und Empathie, die uns zu moralischem Verhalten führen. Etwa zur Goldenen Regel: Füge niemanden etwas zu, was auch du nicht willst, das man dir zufügt!
Dennoch hat in der politischen Ethik der Rückgriff auf Gott ernstzunehmende Fürsprecher. So betonte der Philosoph Max Horkheimer: Wenn Politik nicht ein Moment von Theologie und damit Moral in sich bewahrt, bleibt sie letzten Endes Geschäft. Und eine Menschheit, die sich als das Einzige und Höchste aufspreizt, wird zum Götzen, der Appetit nach blutigen Opfern hat.
Diese Mahnung Horkheimers verdient Beachtung. Eine selbstherrliche Menschheit, die keine übergeordnete, universale Wirklichkeit mehr kennt, die ihr Halt und Orientierung gibt, eben das, was wir Gott nennen, eine solche Menschheit läuft Gefahr, in die Irre zu gehen. Daher schreibt Horkheimer: Es gilt "den Gedanken an ein Transzendentes, Unbedingtes zu bewahren, nicht als Dogma, sondern als ein die Menschen verbindendes geistiges Motiv."
Dem stimme ich zu, und ich meine, dass der Gedanke an Gott oder Transzendenz auch in den Verfassungen säkularer Staaten einen Platz finden sollte. Aber so, dass damit das Prinzip der Trennung von Staat und Religion nicht ernstlich verletzt wird.
Ein recht gutes Beispiel dafür ist unser Grundgesetz. Dort gibt es zwei Erwähnungen Gottes: Im Artikel 56 die Schlussformel zum Amtseid, die aber nicht verpflichtend gesprochen werden muss: "So wahr mir Gott helfe". Und in der Präambel, wo es heißt, das deutsche Volk hat sich das Grundgesetz "im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen" gegeben.
Obwohl ich ein Verfechter des säkularen Staatsprinzips bin, halte ich den Verweis auf Gott besonders in der Präambel für wertvoll. Weil er im Vorspruch steht und nicht im eigentlichen Gesetzestext, wird dieser Gottesbezug in einer vor- oder überpolitischen Sphäre gehalten. "Gott" wird sozusagen aus dem politischen Geschäft um Macht und Interessen herausgehalten, nicht jedoch aus unserem politischen Bewusstsein verbannt. Gut ist auch, dass der Begriff "Gott" in der Präambel ganz unbestimmt und offen bleibt – gerade dadurch könnte er für Menschen unterschiedlichen Glaubens akzeptabel sein.
Für Politiker in der Verantwortung kann es Zeiten übermenschlich schwerer Entscheidungsnöte geben – wie bei Helmut Schmidt als Kanzler im Kampf gegen den Terror der RAF. Da zu bestehen gelingt vielleicht nur mit einem Rückhalt in der Transzendenz. Das "Vertrauen auf Gott, den Herrn der Geschichte", schreibt Schmidt, habe ihn davor bewahrt, den Weg der an Moral und Recht sich orientierenden Vernunft zu verlassen.
Der an Kant geschulte frühere Kanzler weiß aber auch: Gott und Transzendenz können wir nur glauben, nicht wissen. Politisches Handeln darf sich deshalb niemals auf den Willen Gottes berufen. "Gott will es" war der Schlachtruf der Kreuzfahrer; er darf in unserer Welt keine Politik mehr bestimmen.
Nikolaus German, M. A., geb. 1950, Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Lebt als Autor und freier Journalist in München, schreibt v. a. für Süddeutsche Zeitung, Das Parlament; außerdem zahlreiche Beiträge für Rundfunk und Fernsehen sowie mehrere Dokumentarfilme, darunter "Botschafter der Hoffnung - Sergiu Celibidache in Rumänien", "München unterm Hakenkreuz - Hitlers Hauptstadt der Bewegung", "Max Mannheimer - ein Überlebender aus Dachau".
Dennoch hat in der politischen Ethik der Rückgriff auf Gott ernstzunehmende Fürsprecher. So betonte der Philosoph Max Horkheimer: Wenn Politik nicht ein Moment von Theologie und damit Moral in sich bewahrt, bleibt sie letzten Endes Geschäft. Und eine Menschheit, die sich als das Einzige und Höchste aufspreizt, wird zum Götzen, der Appetit nach blutigen Opfern hat.
Diese Mahnung Horkheimers verdient Beachtung. Eine selbstherrliche Menschheit, die keine übergeordnete, universale Wirklichkeit mehr kennt, die ihr Halt und Orientierung gibt, eben das, was wir Gott nennen, eine solche Menschheit läuft Gefahr, in die Irre zu gehen. Daher schreibt Horkheimer: Es gilt "den Gedanken an ein Transzendentes, Unbedingtes zu bewahren, nicht als Dogma, sondern als ein die Menschen verbindendes geistiges Motiv."
Dem stimme ich zu, und ich meine, dass der Gedanke an Gott oder Transzendenz auch in den Verfassungen säkularer Staaten einen Platz finden sollte. Aber so, dass damit das Prinzip der Trennung von Staat und Religion nicht ernstlich verletzt wird.
Ein recht gutes Beispiel dafür ist unser Grundgesetz. Dort gibt es zwei Erwähnungen Gottes: Im Artikel 56 die Schlussformel zum Amtseid, die aber nicht verpflichtend gesprochen werden muss: "So wahr mir Gott helfe". Und in der Präambel, wo es heißt, das deutsche Volk hat sich das Grundgesetz "im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen" gegeben.
Obwohl ich ein Verfechter des säkularen Staatsprinzips bin, halte ich den Verweis auf Gott besonders in der Präambel für wertvoll. Weil er im Vorspruch steht und nicht im eigentlichen Gesetzestext, wird dieser Gottesbezug in einer vor- oder überpolitischen Sphäre gehalten. "Gott" wird sozusagen aus dem politischen Geschäft um Macht und Interessen herausgehalten, nicht jedoch aus unserem politischen Bewusstsein verbannt. Gut ist auch, dass der Begriff "Gott" in der Präambel ganz unbestimmt und offen bleibt – gerade dadurch könnte er für Menschen unterschiedlichen Glaubens akzeptabel sein.
Für Politiker in der Verantwortung kann es Zeiten übermenschlich schwerer Entscheidungsnöte geben – wie bei Helmut Schmidt als Kanzler im Kampf gegen den Terror der RAF. Da zu bestehen gelingt vielleicht nur mit einem Rückhalt in der Transzendenz. Das "Vertrauen auf Gott, den Herrn der Geschichte", schreibt Schmidt, habe ihn davor bewahrt, den Weg der an Moral und Recht sich orientierenden Vernunft zu verlassen.
Der an Kant geschulte frühere Kanzler weiß aber auch: Gott und Transzendenz können wir nur glauben, nicht wissen. Politisches Handeln darf sich deshalb niemals auf den Willen Gottes berufen. "Gott will es" war der Schlachtruf der Kreuzfahrer; er darf in unserer Welt keine Politik mehr bestimmen.
Nikolaus German, M. A., geb. 1950, Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Lebt als Autor und freier Journalist in München, schreibt v. a. für Süddeutsche Zeitung, Das Parlament; außerdem zahlreiche Beiträge für Rundfunk und Fernsehen sowie mehrere Dokumentarfilme, darunter "Botschafter der Hoffnung - Sergiu Celibidache in Rumänien", "München unterm Hakenkreuz - Hitlers Hauptstadt der Bewegung", "Max Mannheimer - ein Überlebender aus Dachau".
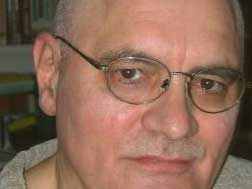
Nikolaus German© Privat