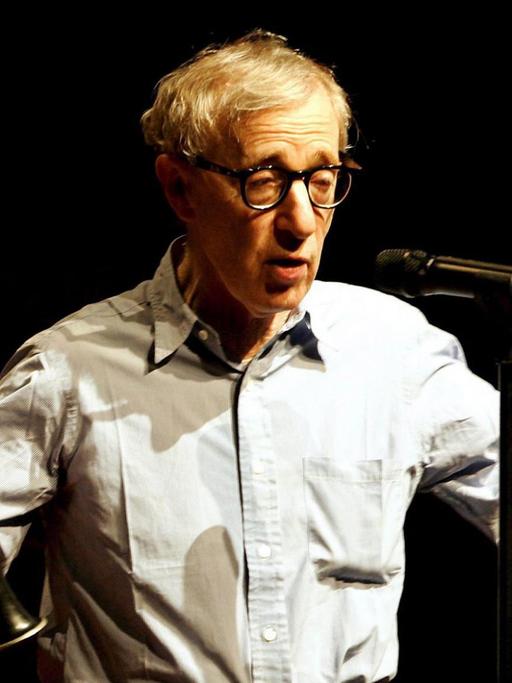Am Montag, den 10. Oktober, ab 09 Uhr 07 ist Dani Levy zu Gast in der Sendung "Im Gespräch", und erzählt mehr über seinen Film und seine eigenen familiären Konstellationen und Situationen.
Familienleben als Achterbahnfahrt

Wieder einmal steht die Familie im Zentrum einer Komödie von Dani Levy. "Die Welt der Wunderlichs" handelt von psychischen Verzweiflungen einer Alleinererziehenden und ihrer engsten Familienmitglieder. Der Regisseur sieht darin auch eine Art Gesellschaftsporträt.
Susanne Burg: Der Regisseur Dani Levy hat uns schon so manche Komödie beschert: "I Was on Mars" etwa, die Hitler-Satire "Mein Führer" oder "Alles auf Zucker". Nun steht wieder einmal die Familie im Zentrum seines neuen Films: "Die Welt der Wunderlichs". Diese Welt ist ziemlich bewegt: Mimi ist Musikerin und alleinerziehende Mutter eines hyperaktiven Sohnes. Sie versucht, ihr Leben zu meistern, aber da ist noch der Rest der Familie: der Vater, gespielt von Peter Simonischek, ist spielsüchtig. Die Mutter, gespielt von Hannelore Elsner, depressiv, und ihr Ex-Mann Johnny, ebenfalls Musiker, chaotisch. Als Mimi plötzlich eine Einladung zu einer Casting-Show erhält, denkt sie, ihr Ex hat ihr die beschert.
Einspieler
Es war der Sohn. Ab hier beginnt nun eine Screwballkomödie auf Reisen. Ich habe Dani Levy zum Interview getroffen und ihn auf diese Familie angesprochen, denn alle außer Mimi, die von Katharina Schüttler gespielt wird, haben psychische Probleme. Borderline, Depression oder ADHS. Ich wollte wissen: Was war zuerst da beim Film – die Idee einer psychischen Störung oder die Idee einer schwierigen Familienkonstellation?
Dani Levy: Die Idee einer psychischen Störung, weil ich einfach festgestellt habe in den letzten Jahren, vielen Jahren sogar schon, dass die ganz schön in unserer Gesellschaft angekommen sind, dass die Menschen am Leben doch ganz schön verzweifeln und ganz schön kämpfen mit ihrem eigenen Leben in verschiedenster Form, ob das jetzt Ängste sind, die sie haben, ob es Zwanghaftigkeiten sind, die sie entwickeln, überstrukturiert zu sein, überorganisiert zu sein, das Gefühl haben, sie fallen in Löcher, Auf und Abs, Höhen und Tiefen, Psychosen entwickeln, Ängste in Beziehungen, sich einsam fühlen, und und und…
Psychische Probleme angekommen in der Mitte der Gesellschaft
All das, was quasi vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal, noch so ein bisschen Randgebiete waren, dass jemand ein Psychopharmaka bekommen hat oder Medikamente bekommen hat oder sogar in die Psychiatrie kam, und inzwischen befinden wir uns in der Mitte der Gesellschaft. Wir haben alle damit zu tun, mit uns selber, mit unseren Familien, mit unseren Freunden, und wir kommen auch alle in das Alter, wo man dann tatsächlich mal ein Burnout hat oder nicht mehr weiter weiß oder an sich selber so stark verzweifelt, dass man gar nicht weiß, ob man dem weiter genügt und die Kraft noch hat, und plötzlich irgendwie in sich zusammenfällt und einem einfach alles zu viel wird.
Da hatte ich das Gefühl, das ist wirklich Teil unserer Gesellschaft, und das ist auch in den Medien voll aufgenommen worden, und wir wissen, dass das einen Großteil der Gesellschaft betrifft oder einen guten Teil der Gesellschaft betrifft, und das war für mich ein wichtiges erstes Element, darüber einen Film zu machen und vor allem auch eine Komödie zu machen, weil ich das Gefühl habe, diese Menschen, die wir alle sind und unsere eigenen Unzulänglichkeit und Verzweifeltheit und Leidensfähigkeit, die wir alle Menschen haben, weil wir mit unserer Existenz ja auch am hadern sind, das gehörte ja immer schon in mein Universum.

Der Regisseur Dani Levy© picture alliance / dpa / Georg Wendt
Auch die Zuckerfamilie ist eine dysfunktionale Familie. Familien haben entweder ein geschichtliches Stigma zu bekämpfen, weil sie halt, keine Ahnung, Flüchtlinge sind, Opferfamilien, Täterfamilien, was auch immer, oder sie haben eben in sich in der Familie selber eine psychische Struktur, die natürlich die Familie extrem prägt und die uns alle zu dem macht, die wir sind. Daraus wollte ich einen Film machen, aber habe erst mal gar nicht gewusst, wie das denn so sein kann, was das überhaupt so sein kann, bis ich dann erst auf die Idee kam, dass es tatsächlich in einer Familie stattfindet.
Burg: Nun sind es ganze, wenn ich richtig gezählt habe, sieben Familienmitglieder, die alle auch ihre eigene Geschichte haben, die auch als Charaktere entwickelt werden in dem Film. Wie schwierig war es, diese Familienkonstellation aufzustellen und dabei doch noch allen Charakteren gerecht zu werden und Mimi als Protagonistin dennoch im Zentrum zu lassen?
Levy: Das war ein längerer Weg als ich gedacht habe. Ich dachte, das wird so ein schneller Film, den kann ich schnell schreiben und machen, und dann hat sich gezeigt, dass das doch ein ganz schön steiniger Weg war, dieses Drehbuch zu entwickeln, ehrlich gesagt, dass ich wirklich viele, viele Fassungen geschrieben habe und oft auch verzweifelt bin, nicht wusste, wie ich den Stoff irgendwie in eine Mischung hineinkriege, dass er eben trotzdem noch, ich sage jetzt mal, eine wirklich gute Komödie wird, eine substantielle, die man eben auch als Unterhaltungsfilm sehen kann, die trotzdem aber real und auch tiefer mit den Figuren umgeht.
Wenn Frauen ihren eigenen Träumen nicht gerecht werden
Geholfen hat natürlich dabei, dass ich eine Hauptfigur hatte, von der ich wirklich wusste, was ich erzählen wollte. Ich wollte einen Film machen über eine alleinerziehende Mutter, und wenn es dann noch eine Frau ist wie Mimi, die von ihrer ganzen Familie ganz schön beansprucht wird und auch ganz schön angestrengt ist von den ganzen Egozentrikern, die sie da in ihrer Familie hat und nicht dazu kommt, ihr eigenes Leben zu leben eigentlich oder ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Sehnsüchte wahr werden zu lassen, dann ist das, finde ich, einfach eine wirklich aktuelle, heutige Frauenfigur, weil ich schon das Gefühl hatte irgendwo, trotz aller Frauenemanzipation und einer Gesellschaft, die Frauen natürlich viel mehr Chancen und Möglichkeiten gibt und Frauen viel klarer wissen, dass sie auch einen eigenen Weg gehen wollen, ist es immer noch so, dass ich es als Frauenschicksal bezeichnen, wenn Frauen sich für ihre Familie, für ihre Kinder aufopfern und dabei ihren eigenen Träumen eigentlich gar nicht so richtig gerecht werden.
Burg: Man sieht sie dabei, wie sie eigentlich zu einer Castingshow möchte. Sie möchte endlich mal ihren Weg verfolgen, und ihre Familienmitglieder stören sie eigentlich ständig dabei. Alle Neurosen der Familie stürzen auf sie ein, und man denkt, wie schaffst du es trotzdem noch, nicht durchzudrehen und alles irgendwie noch beisammen zu halten. Sie fährt dann eben zu dieser Castingshow, die heißt "Second Chance", da sitzen dann viele Menschen in der Jury – im Film sieht das teilweise sehr, sehr echt aus –, Thomas Anders, Sabrina Setlur, Friedrich Liechtenstein sitzen da. Nun sind Castingformate ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie Chancen bieten, sondern dass Menschen eher vorführen. Kann es denn trotzdem für sie ein Weg sein, sich zu emanzipieren, ihren eigenen Weg zu finden?
Levy: Erst mal war es egal, wo sie hinfährt. Sie hätte auch zu einem Ruderwettbewerb fahren können. Erst mal war wichtig, dass es überhaupt etwas ist, was sie aus ihrem Alltag, der sie so fesselt, befreien will. Sie hat das Bedürfnis, aber sie würde es selber gar nicht schaffen. Es ist ja ihr siebenjähriger Sohn, der sie dort anmeldet, und ihr siebenjähriger Sohn, der spürt halt auch, dass die Mutter nicht wirklich glücklich ist und meldet sie halt bei dieser Castingshow an.
"Ich will einfach meine Liebe für Musik auch mal in einem Film ausleben"
Ich bin übrigens nicht einverstanden mit was Sie da sagen. Ich glaube, die heutigen Castingshows sind tatsächlich doch ganz schön respektvoll geworden mit den Kandidaten, auf jeden Fall viele. Wir reden jetzt nicht über so blöde Formate wie "Promi Big Brother" oder irgendwelche Containershows, sondern ich rede wirklich von Castingshows, also wie "Britain’s Got Talent" oder "The Voice" oder "The Voice of Germany" oder so, das sind eigentlich Castingshows, die schon sehr respektvoll und auch sehr liebevoll, finde ich, mit den Kandidaten umgehen, weil die Castingshow-Redaktionen auch gemerkt haben, dass das verächtliche oder das entwürdigende Element, was sowas wie "DSDS" hatte, nicht gut ankommt beim Publikum. Die haben ja stetig auch Zuschauer verloren, weil die Leute wollten eigentlich gar nicht sehen, wie andere Leute zur Sau gemacht werden.
Deswegen habe ich es jetzt erst mal so negativ nicht gesehen, aber für mich war es erst mal egal. Wichtig war für mich eine Frau, eine talentierte Singer-Songwriterin, sieht keine Möglichkeit mehr, ihren Traum der Musik zu leben und wird von ihrem Kind zu einer Veranstaltung angemeldet, und da ich ein riesiger Musikfreund bin und Musikfilme eigentlich total liebe, und ich habe so schöne Musikfilme gesehen in den letzten paar Jahren, wo ich auch so dachte, ich will einfach meine Liebe für Musik auch mal in einem Film ausleben, ich will einen richtigen Musikfilm machen. Deswegen war für mich erst mal die Plattform wichtig. Für mich war es toll, dass sie halt an einen Ort geht, der eben auch ein bisschen zwiespältig ist, nicht einfach jetzt, was weiß ich, sie macht einen Konzert in einem Club oder so, das wäre jetzt ein bisschen…, sondern etwas, was so eine Öffentlichkeit hat, was auch sowas Anrüchiges hat. Das fand ich schon ganz gut.
Burg: Ihre ganze Familie reist dann auch ihr nach zu dieser Castingshow. Ihr Vater wird gespielt von Peter Simonischek, den man ja derzeit sehr auch im Film kennengelernt hat durch "Toni Erdmann" von Maren Ade, auch eine Komödie – wie ist das jetzt, mit einem Film von Ihnen, der rauskommt, auch eine Komödie, ist das Fluch oder Segen, macht es das einfacher oder schwieriger?
"Ich habe mich einfach total in Peter Simonischek verliebt"
Levy: Das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Also ich wusste gar nichts von Maren Ades Film und Peter hatte mir auch gar nichts erzählt. Ich habe einfach den bestmöglichen Schauspieler für die Rolle von Walter Wunderlich gesucht und habe Peter Simonischek eingeladen zum Casting, und er ist hierher gekommen, und wir haben eine kurze Probe gemacht zusammen und haben das mal angespielt, wie die Figur sein könnte, und ich habe mich einfach total in ihn verliebt. Ich habe einfach gedacht, was ein toller, herzlicher, spannender, entspannter und trotzdem wirklich authentischer Mensch auch so.
Ich empfinde das jetzt im Moment eher als Segen, dass man ihn jetzt so kennt, dass es sein Jahr ist und dass ich in diesem Jahr mit dabei bin. Ich gönne ihm das total. Er ist eine wirkliche Entdeckung, und zwar eine zu recht Entdeckung, das ist eben auch so toll, aber ob jetzt noch ein zweiter Film mit Peter Simonischek so den Platz hat, den "Toni Erdmann" hat, weiß ich jetzt nicht, aber ich gönne es ihm einfach. Ich finde es einfach toll, dass er dabei ist, und ich weiß, dass wir eine richtige Entscheidung gefällt haben.
Burg: Sie haben ja schon eingangs gesagt, dass Sie schon immer an Familien interessiert waren. Die Familie ist natürlich auch schon immer die Quelle für große Komödien gewesen. Wie hat sich Ihr Interesse im Laufe Ihrer Karriere am Thema Familie und/oder Komödie verändert?
Levy: Also die ersten Filme, die ich gemacht habe so in den Ende 80er-, Anfang 90er-Jahren, waren ja eher so, da habe ich mich so an meiner Familie ein bisschen abgearbeitet, will ich komme aus einer Familie, die nicht unkompliziert war. Ich hatte erst mal ein sehr schwieriges Verhältnis mit meinen Eltern, ich fand die sehr distanziert, sehr bürgerlich, steif, dass es eher so eine, so ein bisschen eine Eiszeit war teilweise, dass ich meine Eltern auch nie so kennengelernt habe als wirklich streitendes Paar oder Privatperson. Bei uns wurde nicht über Sex gesprochen und kaum über die Vergangenheit meiner Eltern gesprochen, wo sie herkommen. Da gibt es ja eine Menge Geheimnisse, die meine Mutter hatte, auch als Flüchtlings-, als jüdisches Kind, was aus Berlin 1939 in die Schweiz geflohen ist. Das war alles eher bei uns in so einem Tabubereich.
Mit den ersten Filmen rebellierte Levy gegen die Eltern
Es war kein nahes Verhältnis mit meinen Eltern, und deswegen sind die ersten Filme, die ich gemacht habe, eher so der Junge rebelliert gegen die Eltern geprägt, und im Laufe der Filme und im Laufe der Jahre, die ich Filme gemacht habe, ist der Weg zu meinen Eltern kontinuierlich schöner und reicher geworden, weil wir auch so viel über die Filme, die ich gemacht habe, auch noch mal eben ein neues Thema hatten miteinander, weil sie natürlich mein Universum kennengelernt haben, wo ich lebe, wie ich denke, was ich mache.
Da gab es auch Streit teilweise, weil ich ja dann doch eher ein Linker bin und meine Eltern eher konservativ sind, aber im Grunde genommen haben wir uns erst durch die Filme viel besser kennengelernt, und seitdem ich selber Kinder habe, also jetzt seit 16, 17 Jahren, ist mein Gefühl natürlich zu meinen Eltern, die leider inzwischen beide tot sind, natürlich auch massiv gewachsen, weil ich auch viel mehr spüre, wie schwierig es ist, Vater zu sein oder Eltern zu sein und wie komplex so Familienstrukturen eben auch sind.
Ich empfinde die Familie auch viel stärker als ein Fundament, auch unserer Gesellschaft. Die Familie ist halt ein Grundstein jeder Gesellschaft, glaube ich. Wir leben auch in der Familie erst mal unser gesamtes gesellschaftspolitisches Leben. Wenn unsere Eltern nicht in der Lage sind, uns für die Welt, auch empathisch für die Welt zu erziehen, dann werden wir das auch nicht werden, dann ist das auch als Erwachsener ein langer Weg, und den kenne ich wirklich. Das ist etwas, was mich schon interessiert an Familien, wo ich schon echt fasziniert bin, wie viel Komödienstoff das, ehrlich gesagt, auch ist.
Burg: Eine sehr dysfunktionale, aber auch eine sehr liebenswerte Familie, die erlebt man jetzt im neuen Film von Daniel Levy, "Die Welt der Wunderlichs". Herzlichen Dank für das Gespräch!
Levy: Gerne!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.