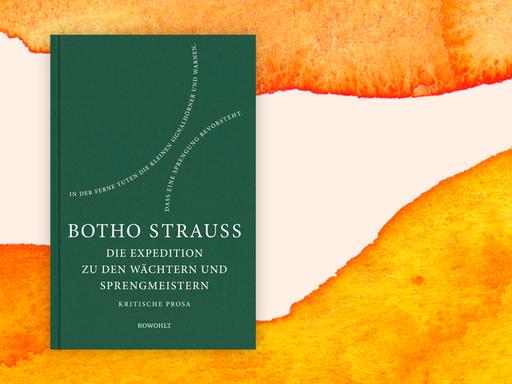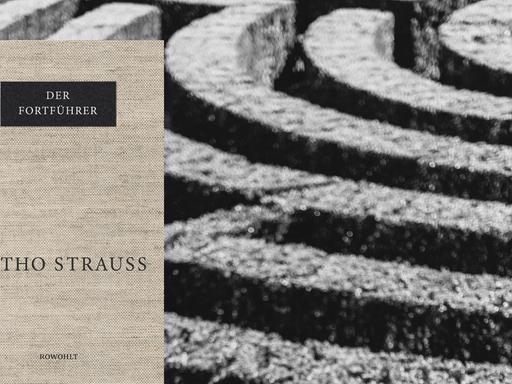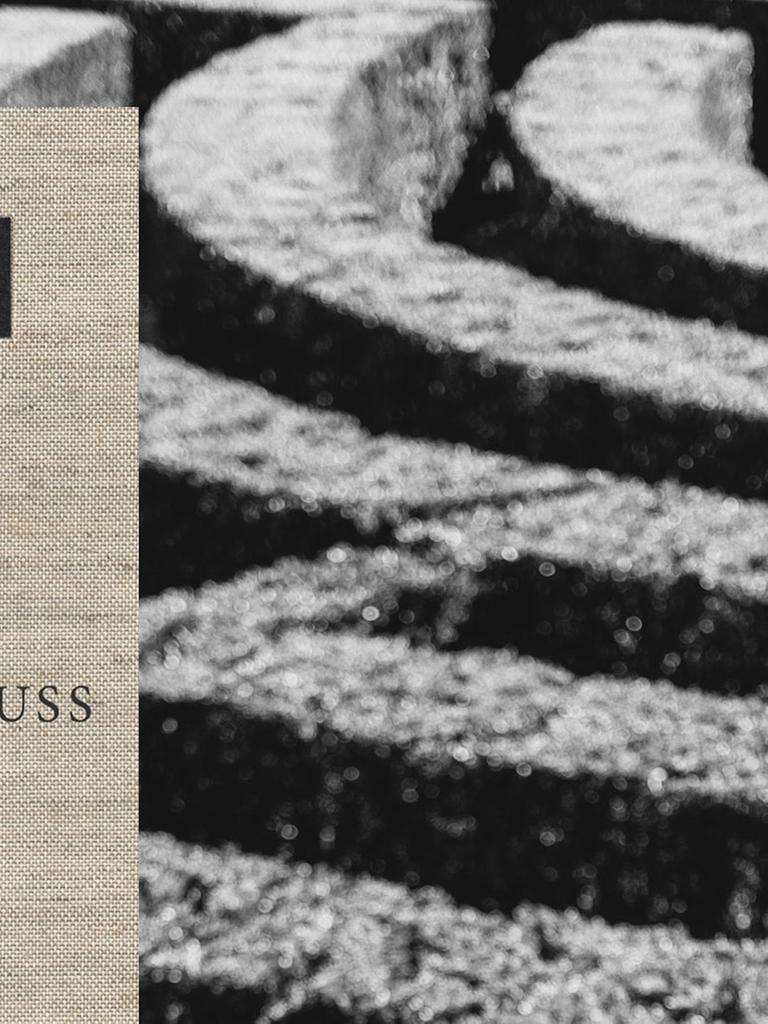Botho Strauß ist schon immer ein Mann für die Bühne gewesen. Er spielt gern Theater, allerdings tut er das am liebsten schriftlich. So besteht auch der erste, der längste Teil seines neuen Prosabuches aus kurzen Szenen, die Alltagssituationen zu verdichten versuchen. Am Anfang steht sogar eine regelrechte Regieanweisung. „Der Vorhang geht auf. Man sieht Menschen beim Leben erwischt. Sie erstarren und stehen steif auf der Stelle. Einer Frau wird die Perücke vom Kopf gerissen – an einem unsichtbaren Faden steigt sie hinauf in die Himmel-Soffitten“, schreibt Strauß.
„Das Schattengetuschel“ ist das Titel- und Hauptstück des Bandes, der noch aus zwei weiteren Teilen besteht. Kostbare Wörter wie die „Himmel-Soffitten“ weisen darauf hin, dass auch der Ton, der hier angeschlagen wird, ein bedeutsamer Teil der Botschaft ist. Als Soffitte bezeichnet man eine Deckenkulisse im Theater. Das ganze irdische Geplänkel erscheint also von einer höheren Warte aus betrachtet, gewissermaßen aus einer Sonnenposition – deshalb ist es ein bloßes „Schattengetuschel“.
Irdisches Geplänkel und Schattengetuschel
Typische Figuren sind etwa eine spindeldürre junge Frau, die in einem altmodischen Cocktailkleid mit Strassbesatz allein vor einem Mikrofon steht, oder die rundliche Passagierin eines Stadtbusses. Daraus entstehen aberwitzige, die Realität fremdartig durchdringende Dramolette. „Man muss eine Menge Welt malen, bis eines Menschen Verlorenheit darin zum Vorschein kommt“, heißt es.
Eine Spezialität von Botho Strauß ist seit jeher das psychische Sezieren. Verborgene Gefühlssequenzen werden geradezu chirurgisch freigelegt. Einmal überfällt einen Mann eine winterliche Vision: verführerische weibliche Nacktheit unter verhüllenden warmen Kleidungsstücken. Als aber im Zimmer dann endlich der Pullover, die Socken und die Strumpfhose ausgezogen werden, tritt das Theater der Realität in Erscheinung.
Er sah bald, wie ihr Lächeln, das freundlich gefällige, verschwand, in der Lust die Lippen schief, die Augen jede Regung überwachend. Sie schenkte sich ungeschickt, als müsse sie ihm ein ‚erstes Mal‘ vorspielen. Oder so etwas zumindest markieren, wie ein Schauspieler, der eine Szene zuerst markiert, bevor er sie wirklich spielt. Und der Firnis von ernster Bedeutung, der über ihrem Gesicht lag, wurde ein wenig brüchig, ein Anflug von Ironie trat hervor, und der schien zu sagen: ich tue es gern, aber es ist vielleicht nicht mein Bestes.
Botho Strauß in "Das Schattengetuschel"
Gelegentlich kippt das Begehren um in etwas Traumverhangenes, Enigmatisches. So in einer zunächst hautnah realistisch erscheinenden Szene aus einem Überlandbus zwischen Schwerin und Aachen: Da entwickeln sich surreale Motive, in denen sich Sinnlichkeit, Absurdität und Fremdheit suggestiv mischen.
Es scheint unsichtbare Fäden zu geben, an denen die einzelnen Figuren hängen und in einen Raum verweisen, den sie nicht durchschauen. Selbstbestimmt ist hier nichts. Und so geschehen immer wieder Übergänge in mythische Dimensionen, die für den Autor zentral sind und die er gegen Ende des „Schattengetuschel“-Reigens direkt benennt, ja sogar anruft: Es geht um die drei Moiren, die Schicksalsgöttinnen der alten Griechen, die für den Lebensfaden jedes Menschen verantwortlich sind – „drei Grundfiguren unserer Phantasie, unserer Ängste, unserer Wünsche und Gelüste, unserer Mythen und Märchen.“
Dass der Autor sich meist eines auffällig ziselierten Stils bedient, eines Bildvorrats aus humanistischem Gymnasium und deutscher Romantik, steht damit offenkundig in direktem Zusammenhang. „Die Schrift fördert die Kraft des Gewärtigens – und das ist auf gut Schlegelsch: die ‚Divination‘“, schreibt Strauß. Oder auch, am Beginn einer kleinen Fabel, in altem Ton: „In der Zerstreutheit des Herzens stößt man auf den entlegensten Menschen, den man kaum kannte, einen aber, der von allen, die man bloß flüchtig streifte, als der freundlichste im Gedächtnis blieb.“
In politischer Romantik-Tradition
Botho Strauß ist nicht nur der fantasiegestützte deutsche Romantiker, der wie Friedrich Schlegel in „Lucinde“ an erotische Reize anknüpft. Er stellt sich vor allem auch in die politische Romantik-Tradition, die sich das katholische deutsche Mittelalter als Ideal auserkoren hat.
Das aktuelle „Schattengetuschel“ beginnt mit einer Szene, in der sich der konkrete Autor zwar verbirgt, aber mit gezielten Andeutungen auch kokett stilisiert. Da erwartet der irgendwie ins Abseits geratene Ich-Erzähler seinen Sohn, der am Beginn einer privilegierten Karriere steht. Der Vater residiert jedoch immerhin auf einem „Gut Zichow“, also erkennbar in ostelbisch-preußischen Landen wie auch Botho Strauß selbst, und als der Sohn dann kurzfristig absagt, heißt es: „Die Einsamkeit hatte einen neuen Höhepunkt erreicht. Im Zimmer auf und ab gehen, von neun Uhr abends bis zehn. Die Stunde will nicht vergehen, der Zeiger der Wanduhr teilt sie in lauter angehaltene Sekunden. Dann aber doch: zehn! Die Kleider ablegen, die üblichen Waschungen vornehmen, zu Bett gehen und im Meditationsbüchlein lesen.“
Wie ist dieses Mönchische, dieses zeitabgewandte Lebensgefühl zu verstehen? Schwingt da ein Hauch von Selbstironie mit? Doch so sehr diese Passage auch eine inszeniert-theatralische ist und der Ich-Erzähler eine Spielfigur – vielleicht ist das alles doch ernster gemeint, als man annehmen möchte. Denn der zweite Teil des „Schattengetuschel“-Buches ist überschrieben mit „Der allzeit Unzeitgemäße“, und hier handelt es sich nicht mehr um komödiantische und abgründige Bühnenszenen wie vorher, sondern um philosophisch-politische sowie auch poetologische Reflexionen. Das ist offenkundig die andere Seite der Medaille.
Der allzeit Unzeitgemäße suchte noch einmal zur Größe seiner Vorbilder sich aufzurichten. Wie ein Blitz wollte er zwischen die Heute-Anbeter fahren, Schrecken verbreiten, die bittere Schelte über sie bringen. Wollte ihnen das Leid-Wesen wiederentdecken, sie zwingen aufzublicken statt scheel aufs Display. Sie sollten leiden. Er wollte sie stürzen, verzweifeln, entgeistert sehen. Kein privates Wehweh. Sondern das unerbittliche Leid, das ein Hölderlin, ein Nietzsche ertragen mussten. Das kulturelle Leid, deutsch zu sein, zu fühlen, zu denken.
Botho Strauß in "Das Schattengetuschel"
Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Historisch gesehen ist das ein eher zwiespältiger Distinktionsgewinn. Der „allzeit Unzeitgemäße“, der da spricht, ist aber eindeutig ein hochgestimmtes Selbstbild des Schriftstellers Botho Strauß, wie er der Dekadenz seines Zeitalters den Spiegel vorhält und seine Zeitgenossen an die großen Traditionen des Dichtens und Trachtens erinnert.
Gegen Gender-Sprache und Debatten über Postkolonialismus
Die Verdummung durch die digitalen Medien ist ihm genauso ein Gräuel wie die Gender-Sprache und die Debatten um Postkolonialismus. Ein Gedanke scheint ihn dabei besonders umzutreiben, er taucht in einem abschließenden Aphorismen-Teil auf. „Wozu die tiefen Blicke, wenn sie dann nur zu einer leidenschaftlichen Vegetarierin führen?“, heißt es da. Nur fünf Seiten später liest man indes Folgendes: „Tiefe Blicke, die schließlich zu jemanden führen, die nur eine Leidenschaft kennt: die vegane Ernährung.“
Hat da der Lektor nicht richtig aufgepasst? Oder ist das mit dem Vegetarisch-Veganen ein regelrechtes Trauma? Sicher, man kann eine Thüringer Rostbratwurst lieber mögen. Aber derart tagespolitisch agiert Botho Strauß nicht. Resolut nimmt er für sich in Anspruch: „kein Interesse an Politik“. Trotzdem treibt ihn da etwas um. Allerdings benennt er es eher raunend.
Zuweilen war mir, als sei ich ganz allein mit der ‚Wiedervereinigung‘. Das hohe Wort hätte nur mich mit seinem mystischen Sinn berührt, so dass ich davon deutscher wurde, als es die Zeitgeschichte erlaubt. Im Sinne des ‚hieros gamos‘, einer heiligen Hochzeit, eines Glücks, wie es das Kauderwelsch Geschichte so deutlich nur selten herausbringt.
Botho Strauß in "Das Schattengetuschel"
Damit will Botho Strauß offenkundig sogar Novalis toppen, den romantischen Geschichtstheologen. Es geht um den hohen deutschen Geist, der von allen geschichtlichen Verwerfungen unangefochten waltet, und um dessen religiöse Fundierung. Der Autor stellt sich voller Pathos an die Seite eines alten Barden und Sehers wie Rudolf Borchardt, auf den er immer wieder hingewiesen hat. Borchardt sah in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg den preußischen Oberbefehlshaber Wilhelm II. als Nachfolger des mythischen Mittelalter-Kaisers Friedrich Barbarossa und wollte dadurch das Heilige Römische Reich deutscher Nation wiederbeleben. Natürlich, letztlich ist das alles nur Theater. Aber es hat schon bessere Tage gesehen.