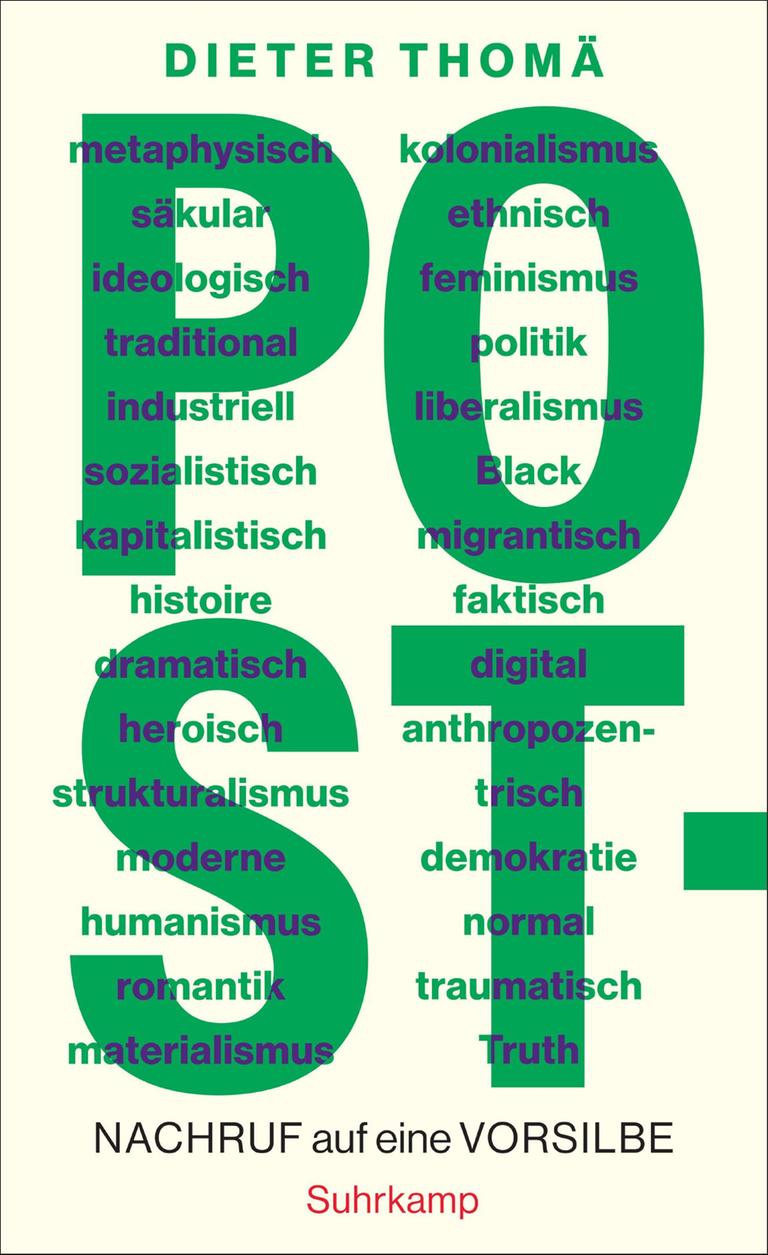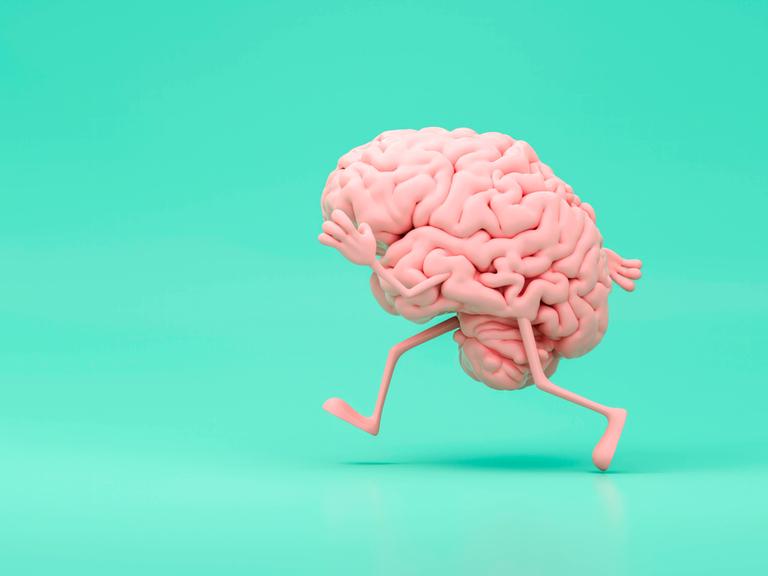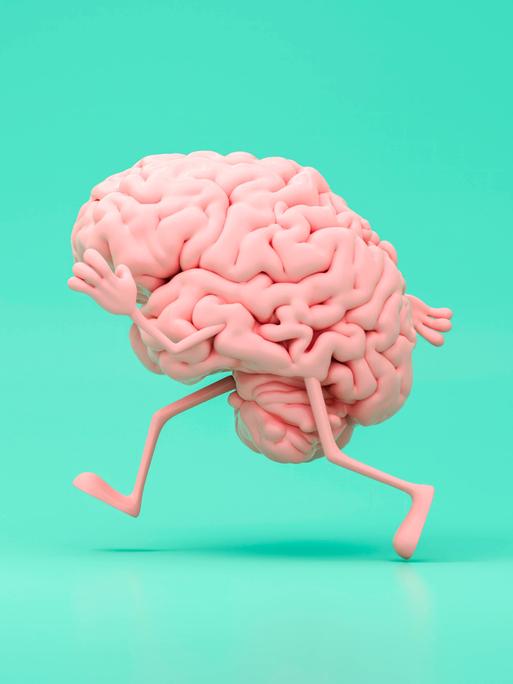Bei der Vorsilbe „Post-„ handelt es sich um die erfolgreichste Erfindung der Geistes- und Sozialwissenschaften seit 1945, konstatiert Dieter Thomä. Wer dem „Postismus“ verfallen ist, bleibt dem, was er hinter sich lassen will, auf unauflösliche Weise verbunden. Früher waren andere Vorsilben schick, „Neo“ zum Beispiel, oder „Anti“. Auch diese Präfixe referierten auf Vorangegangenes, im „Antiroman“ etwa oder im „Antihelden“, sie wirkten aber deutlich weniger demobilisierend als das temperamentlos-ermüdende „Post“. Da war „Anti-” von einem anderem Kaliber:
„Die Vorsilbe Anti- entfaltete – im Guten, aber auch im Schlechten – eine hohe mobilisierende Kraft. Man denke an Antifaschismus, Antiimperialismus und Antikommunismus.“
Das waren halt noch Bewegungen, die mit Schmackes zur Sache gingen, wie immer man sie im Einzelnen auch bewertet haben mochte. „Post“ hingegen hat einen faden Beigeschmack, wirkt temperamentlos, sich mutlos nach allen Seiten hin absichernd.
Kein "Ende der Geschichte"
Auf knapp 400 Seiten schreitet Dieter Thomä – seit einem Vierteljahrhundert Philosophieprofessor an der Universität St. Gallen – zur launigen Generalabrechnung mit dem, was er „Postismus“ nennt. Das „postdramatische Theater“ und das „postfaktische Zeitalter“ lässt der Philosoph außen vor, Thomä konzentriert sich auf drei Großbaustellen: „Postkolonialismus“, „Postmoderne“ und „Posthistoire“.
Im Falle des „Posthistoire“ wird die Überzeugung wirksam, dass die großen geschichtlichen Kämpfe ausgekämpft sind. Grundlegende Neuerungen sind nicht mehr zu erwarten. Die Hohepriester der „Posthistoire“ glaubten erkannt zu haben, dass es nach der Menschheitskatastrophe des Zweiten Weltkriegs nur noch um das Verwalten des Bestehenden gehe. In Deutschland war es der konservative Philosoph Arnold Gehlen – in jüngeren Jahren noch NSDAP-Mitglied – der die Rede vom „Posthistoire“ nach dem Krieg in die Hörsäle trug. Die Kombination von Konsumgesellschaft und bürokratischer Herrschaft sollte die Epoche geschichtlicher Großumwälzungen ein für alle Mal ablösen. Anfang der 1990er-Jahre wird der US-Amerikaner Francis Fukuyama erneut das „Ende der Geschichte“ ausrufen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs hätten Kapitalismus und liberale Demokratie den Sieg über die Totalitarismen des zwanzigsten Jahrhunderts davongetragen, jubelte Fukuyama. Das Ziel der geschichtlichen Entwicklung wäre damit, ganz im Sinne Hegels und Kojèves, erreicht. Ein Befund, über den Dieter Thomä heute nur mehr den Kopf schütteln kann.
Von der "Diversität" zur Entsolidarisierung?
Auch dem beim zweiten großen „Postismus“ lässt Dieter Thomä in seiner philosophischen Tirade die Luft aus: der Postmoderne. Der Berliner Philosoph verortet ihre Anfänge unter anderem in den Schriften des US-amerikanischen Dichters Charles Olson, der zu Beginn der Eisenhower-Ära als einer der Ersten einen Abgesang auf die Moderne anstimmte. Olson, ein Freund des Lyrikers Robert Creeley und des Komponisten John Cage postulierte den radikalen Bruch mit der modernen Rationalität.
Der Literaturkritiker Leslie Fiedler führte den Begriff „Postmoderne“ eineinhalb Jahrzehnte später in die Literaturwissenschaft ein. Zum Ausklang der Roaring Sixties stellte Fiedler der gesamten literarischen Moderne – von Marcel Proust und Thomas Mann bis hin zu Alain Robbe-Grillet – den Totenschein aus.
Die Postmoderne ist in den 2000ern nach und nach verröchelt. Dennoch zeitigt sie bis heute spürbare Nachwirkungen. Den Trend zur „Diversität“ beispielsweise. Man kann den aber nicht nur positiv, sondern auch kritisch sehen – als Tendenz zur Entsolidarisierung, findet Dieter Thomä:
„Es war in der Postmoderne ganz wichtig, diese großen Erzählungen zu zerstören und viele kleine Erzählungen zu generieren. Es war wichtig, objektive Wahrheiten infrage zu stellen. Und dabei bleibt dann unterm Strich eine Entwicklung, die durchaus ihre Tücken hat, nämlich eine Entwicklung, in der jeder sich eigentlich daran erfreut, dass er anders ist – oder sie, oder wie auch immer jetzt das Pronomen lautet; dass sie anders sind als alle anderen. Also der Genuss am Anderssein hat eigentlich den Genuss, etwas gemeinsam zu schaffen, abgelöst. Als wäre das schon automatisch toll, wenn man irgendwie divers ist vom anderen. Divers heißt wörtlich, man wendet sich ab vom anderen. Das ist eigentlich gar nicht so eine tolle Sache.
Das mag für viele provokant klingen, aber es zeigt: Dieter Thomä hält, trotz einer gewissen Wertschätzung für die Segnungen der „Diversity“, an einer der Kardinaltugenden der klassischen Moderne – so wie Linke sie begreifen – fest: am Glauben an die Macht der Solidarität. Dass Thoma Modernist ist, einer, der trotz gewisser Einwände die Errungenschaften der Aufklärung hochhält, zeigt sich auch in seinen Einlassungen zum dritten großen „Ismus“, dem er in seinem Buch analytisch zu Leibe rückt: dem Postkolonialismus. Dieser Bewegung – der lebendigsten unter den „Großen Drei“, die er sich vorgeknöpft hat – kann Thomä vom Grundsatz her einiges abgewinnen.
"Postkolonialismus" kann Ausbeutung nicht angemessen beschreiben
In der Auseinandersetzung mit Frantz Fanon, Edward Said, Walter D. Mignolo, Gayatri Spivak und anderen führenden Köpfen des sogenannten Postkolonialismus arbeitet er allerdings heraus, dass es diesen Postkolonialismus als geschlossenes System gar nicht gibt. Was es gibt, sind verschiedene Schulen und Fraktionen, zum Teil miteinander verfehdet, die unter der Bezeichnung „Postkolonialismus“ gelabelt werden, auch wenn sich einzelne ihrer Vertreter, der Kameruner Achille Mbembe zum Beispiel, dagegen wehren, der postkolonialistischen Denkschule zugerechnet zu werden.
Er grenzt die verschiedenen Fraktionen postkolonialen Denkens voneinander ab – den sogenannten „Dolorismus“ etwa von den Apologetinnen und Apologeten der „Hybridität“ –, um dann zum Schluss zu kommen, dass die Vorsilbe „Post“, vor den Kolonialismus gepappt, schlicht und einfach ungeeignet ist, die Realität heutiger Ausbeutungs- und Übervorteilungsverhältnisse in ihrer Komplexität zu beschreiben.
Verfechter des Universalismus
Wogegen Dieter Thoma besonders scharf Stellung bezieht: dass Theoretikerinnen wie etwa die indisch-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Gayatri Spivak den Universalismus der westlichen Aufklärung als kulturimperialistisches Diktat interpretieren. Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ wäre demnach nichts anderes als ein Herrschaftsinstrument des westlichen Expansionismus, mit dem die ehemals geknechteten Kulturen aufs Neue unterjocht werden sollen. Da kann Thomä nicht mit.
Dieter Thomäs Nachruf auf die Vorsilbe „Post-” ist ein ebenso streitbares wie anregendes Buch, voll herrlicher Sottisen und strahlender Sentenzen. Ein bisschen philosophische Vorbildung wird es wohl brauchen, will man die Lektüre des Bandes in vollen Zügen genießen. Bleibt nur die Frage: Was kommt nach dem „Postismus“? Irgendwas mit „Post-” kann es ja wohl nicht sein.
Damit legt Dieter Thomä dem Publikum etwas erfrischend Unzeitgemäßes ans Herz: Lust an der Zukunft. An einer solidarischen und demokratischen Zukunft wohlgemerkt.