Stephen King: "Ihr wollt es dunkler"
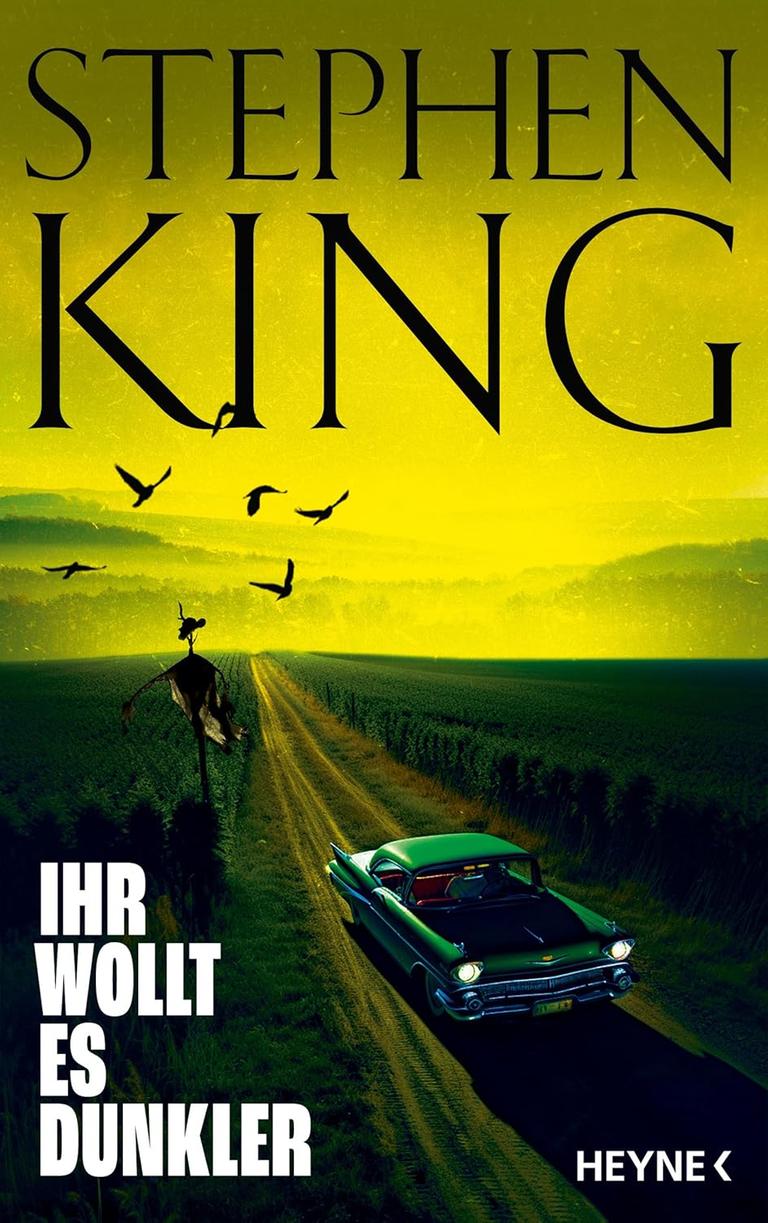
© Heyne Verlag
Keine Sicherheit - nirgendwo
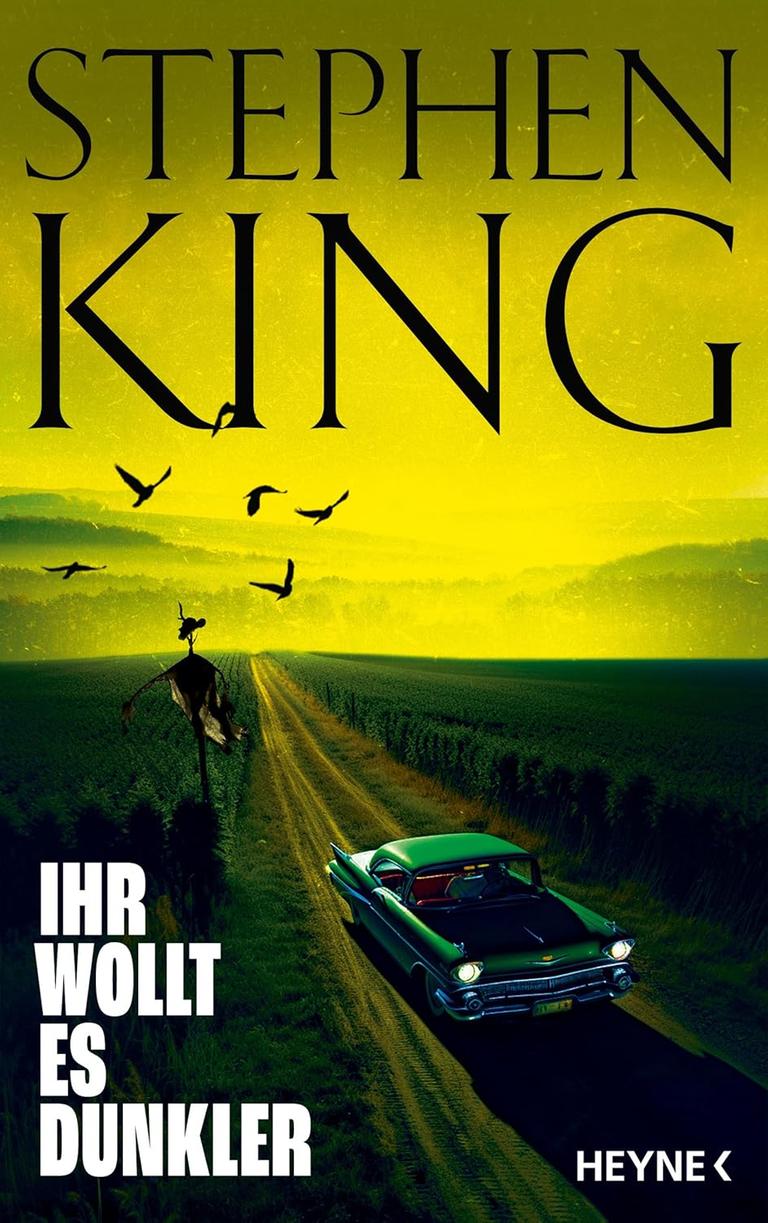
Stephen King
Wulf Bergner, Jürgen Bürger, Karl-Heinz Ebnet, Gisbert Haefs, Marcus Ingendaay, Bernhard Kleinschmidt, Kristof Kurz, Gunnar Kwisinski, Friedrich Sommersberg und Sven-Eric Wehmeyer
Ihr wollt es dunklerHeyne Verlag, München 2024736 Seiten
28,00 Euro
Stephen King, der Großmeister des Horrors, hat das Genre der Erzählungen schon immer hochgeschätzt. Nun sind mit „Ihr wollt es dunkler" zwölf Geschichten erschienen. Ein Alterswerk, in dem King sich spielfreudig und variationsreich zeigt.
„You want it darker“, also: „Ihr wollt es dunkler“ – das ist der Titel von Leonard Cohens letztem Studioalbum, veröffentlicht zwei Wochen vor dem Tod des kanadischen Sängers und Songwriters. Der Titelsong des Albums enthält die unmissverständliche Zeile „I’m ready, my lord“, übersetzt: „Ich bin bereit, mein Herr“. Ein Abschiedslied, ein Totengesang.
Stephen Kings neuer Erzählungsband heißt im Original ein wenig abgeschwächt „You like it darker“, aber der Autor bezieht sich in seinem Nachwort ausdrücklich auf Cohens finales Werk. Dass Stephen Kings Blick noch nie sonderlich optimistisch und stets auf die Schattenseiten gerichtet war, ist eine fast banale Feststellung angesichts des Grauens, das er in der Welt und in den Menschen ahnt.
Doch nun sind viele seiner Figuren in „Ihr wollt es dunkler“ mit ihm gealtert, haben Krankheiten und Rückenschmerzen, haben etwas Schreckliches hinter sich gebracht. Traumatisiert von Verlusten, Kriegserfahrungen oder Schicksalsschlägen sind die Protagonisten in „Ihr wollt es dunkler“ nun bereit, Abschied zu nehmen, sei es vom Leben oder auch nur von einer Lebensphase. Ja, es ist wahrhaftig ein dunkles Buch, aber nach einigen schwächeren Werken Kings in den vergangenen Jahren auch ein großes Buch.
Ein Universum, in dem alles passieren kann
Der Band eröffnet mit der Geschichte eines Vermächtnisses: Gleich im ersten Satz von „Zwei begnadete Burschen“ tut der Ich-Erzähler kund, sein Vater Laird Carmody sei im Alter von neunzig Jahren gestorben. Der Vater hatte als junger Mann gemeinsam mit seinem besten Freund Butch in der Kleinstadt Castle Rock im Bundesstaat Maine einen Schrottplatz eröffnet. Castle Rock ist einer jener immer wiederkehrenden Schauplätze in Stephen Kings Universum, in denen alles passieren kann.
So auch in diesem Fall: Nach einem gemeinsamen Jagdausflug in den späten 1970er-Jahren kehrten Laird und Butch vollkommen verstört nach Castle Rock zurück. Danach änderte sich ihr Leben. Laird wurde ein weltberühmter Schriftsteller; Butch ein nicht minder berühmter bildender Künstler. Woher dieser plötzliche Kreativitätsschub kam, offenbart der Vater dem Sohn in einer Geschichte, die er in einem Ringbuch niedergeschrieben und in seinem Nachlass hinterlegt hat. Demnach hatten Laird und Butch auf ihrem Ausflug eine so unheimliche wie zunächst unerklärliche Begegnung:
„Regen hatte eingesetzt, nur ein leichtes Nieseln. Weil es tiefe Nacht war, hätten die tief hängenden Wolken unsichtbar sein sollen, aber ich konnte sie gut erkennen, weil sie von sich langsam bewegenden hellen Lichtscheiben angestrahlt wurden. Fünf, dann sieben, dann neun in unterschiedlicher Größe. Die kleineren Scheiben hatten einen Durchmesser von etwa zehn Metern, die größeren von ungefähr dreißig. Sie entstanden nicht etwa dadurch, dass Scheinwerferstrahlen von den Wolken reflektiert wurden, sondern sie befanden sich direkt in den Wolken.“
Verwischte Grenzen zwischen Rationalem und Irrationalem
Außerirdische in fliegenden Untertassen, die auf der Erde landen? Ist das Einfallslosigkeit oder ein ironisches Zitieren des Zeitkolorits der 1970er-Jahre? Bei King geschieht das mit der größten Selbstverständlichkeit, als sei es Teil der realen Welt. Ob die Erzählung des Vaters, in der er seinen plötzlichen Erfolg und den des Freundes mit der Einwirkung exterrestrischer Mächte erklärt, nicht selbst reine Erfindung, sprich: Literatur, ist, bleibt offen. Doch besteht die Kunst Stephen Kings von jeher darin, die Grenzen zwischen Rationalem und Irrationalem so geschickt zu verwischen, dass beide Sphären gleichberechtigt, ja unmerklich ineinander übergehen.
In seinem im Jahr 2000 veröffentlichten autobiografischen Essay „Das Leben und das Schreiben“ gibt King erstaunlich offen Auskunft über die handwerklichen Aspekte seiner Arbeit und öffnet, wie er selbst es nennt, seinen Werkzeugkasten. Darin finden sich klare grammatikalische Grundsätze, Strategien zum Spannungsaufbau innerhalb einer Geschichte und eine Handvoll von Vorbildern, angefangen bei H.P. Lovecraft über John Steinbeck bis hin zu Cormac McCarthy. Zu Kings Eigenheiten gehört es auch, dass eine Erzählung von einem Augenblick auf den anderen lückenlos in seinem Kopf entstehen kann. So verhielt es sich, wie der Autor im Nachwort zu „Ihr wollt es dunkler“ verrät, auch mit der knapp 140 Seiten umfassenden Erzählung „Klapperschlangen“ im neuen Buch:
„Als ich eines Tages meinen Morgenspaziergang machte, mir dabei ‚Highway 49‘ von der Jeff Healey Band anhörte und an nichts anderes dachte als daran, wie cool die Leadgitarre doch war, sah ich zwei grüne Plastikfiguren mit roter Mütze. Sie flankierten die Straße und trugen die Warnung: LANGSAM! SPIELENDE KINDER. Da kam mir die Geschichte mit dem Titel ‚Klapperschlangen‘ in den Sinn, und zwar bereits voll entfaltet.“
Es gibt exakt zwei Werke, über die King selbst sagt, mit ihnen habe er die Perfektion seines Schreibens nahezu erreicht: Es handelt sich dabei um die beiden Gefängnisgeschichten „Die Verurteilten“, deren Verfilmung mit Tim Robbins und Morgan Freeman in den Hauptrollen seit 2008 ununterbrochen auf Platz eins der Rangliste der Internet Movie Database steht, und „The Green Mile“, verfilmt mit Tom Hanks. Beides meisterhafte Erzählungen, was zeigt, wie klar Kings Blick auf die Qualität seiner Arbeit ist. „Klapperschlangen“ aus dem neuen Buch ist ein Text, der die hohen Erwartungen des Autors an sich selbst ebenfalls erfüllen dürfte. Passionierte King-Leser werden eine Freude daran haben zu entdecken, wie der Autor hier Figuren und Motive aus seinem Werk wiederaufnimmt und neu verknüpft.
Der Kinderwagen als Vehikel der Hölle
Der Ich-Erzähler von „Klapperschlangen“ heißt Vic Trenton, ist 72 Jahre alt und Werbefachmann im Ruhestand. Vic Trentons kürzlich verstorbene Ehefrau war Donna Trenton, die Protagonistin aus Kings vor mehr als vierzig Jahren publizierten Roman „Cujo“. Ein ebenfalls in Castle Rock angesiedeltes Buch, in dem ein tollwütiger Bernhardiner eine Frau und deren kleinen Sohn so lange bei sengender Hitze in einem fahruntüchtigen Auto gefangen hält, bis das Kind verdurstet. Vic Trenton kommt also mit dem Trauma eines zweifachen Verlusts, eines alten und eines frischen, nach Rattlesnake Key in Florida, um im Wochenendhaus eines ehemaligen Geschäftspartners Abstand zu gewinnen. Seine Nachbarin heißt Mrs. Bell. Vic ist bereits vor seiner Ankunft vor der alten Dame gewarnt worden. Sie sei höchst wunderlich, hieß es, aber ungefährlich. Tatsächlich schiebt Mrs. Bell bei ihrer ersten Begegnung mit Vic einen leeren Zwillingskinderwagen vor sich her. Das quietschende Gefährt wird zu einem der Leitmotive der Erzählung:
„‚Wollen Sie nicht den Zwillingen hallo sagen, Vic?‘ Sie deutete auf den Buggy. In einem der Sitze lagen blaue Shorts, in dem anderen grüne. Und über die Rückenlehnen war jeweils ein launiges Mottoshirt gebreitet. Auf einem stand RACKER, auf dem anderen RABAUKE. ‚Der links ist Jacob‘, sagte sie mit Blick auf die blauen Shorts. ‚Der andere ist Joseph.‘ Sie fasste an das T-Shirt mit der Aufschrift RABAUKE. Es war nur eine kurze Geste, aber zärtlich und voller Liebe.“
So wie Vic, der Ich-Erzähler, vor rund vierzig Jahren seinen Sohn unter tragischen Umständen verloren hat, so rissen Mrs. Bells Zwillinge etwa zur gleichen Zeit in einem unbemerkten Augenblick von zu Hause aus und gerieten im seinerzeit noch wilden, unbewohnten Teil der Insel in ein Nest von Klapperschlangen. Sie starben auf qualvolle Weise. Der leere Kinderwagen mit seinen quietschenden Reifen, den Mrs. Bell seitdem auf Rattlesnake Key vor sich herschiebt, sorgfältig mit Kleidung der beiden Kinder ausstaffiert, ist in dieser Erzählung ein unheimliches Vehikel für die höchst lebendigen Gespenster der Vergangenheit.
Niemand lässt seine Dämonen hinter sich
Stephen King glaubt fest an die konkrete Handlungsmacht einer belebten Dingwelt. Als er selbst 1999 als Spaziergänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde, kaufte King nach seinem Krankenhausaufenthalt das Unfallauto und zerstörte es am Jahrestag des Unfalls. Es ist also weit mehr als ein Spleen, wenn King Alltagsgegenständen in seinen Texten immer wieder eine entscheidende Funktion zuweist. So lässt er also in „Klapperschlangen“ den Zwillings-Kinderwagen auch nach Mrs. Bells plötzlichem Tod als ein zwischen der Welt der Lebenden und der der Toten hin und her quietschendes Höllenmobil durch seine Geschichte fahren. Mittendrin der gealterte Vic, dessen vermeintlicher Rückzug in die Selbstreflexion zu einer alptraumhaften Konfrontation mit den Geistern seines Lebens wird. Die Stimmen in seinem Kopf, die Einflüsterungen der Zwillinge, die inneren Gespräche mit seinem toten Sohn vermischen sich zu einem riesigen Hallraum. Eines Tages erinnert sich Vic an die letzten Minuten seiner im Sterben liegenden Ehefrau:
„Ihr Blick ging an mir vorbei in die Ferne, und ihr Gesicht hellte sich auf. ‚Mein Gott, was bist du gewachsen! Schau nur, wie groß du bist!‘ Ich drehte den Kopf um. Natürlich war da niemand, aber ich wusste genau, wen sie gerade sah.“
Bei Stephen King lässt niemand seine Dämonen hinter sich. Im Gegenteil – in „Klapperschlangen“ wachsen sie buchstäblich mit. So verschwimmen die vermeintliche Realität, Visionen, Erinnerungen und Träume nicht nur in dieser fabelhaften Erzählung zu einem Kosmos, der seinen eigenen Wahrheiten gehorcht. Den inneren Gesetzmäßigkeiten dieser so haarscharf neben der Normalität liegenden Welt sind die Menschen ausgeliefert. Außenstehenden – in diesem Fall beispielsweise einem gealterten Polizisten mit beschränkter Fantasie – bleiben sie verschlossen.
Alkoholsucht als Generalthema in Kings Büchern
Stephen King wird oft vorgeworfen, seine Figuren seien flach angelegt und blieben ohne innere Entwicklung. Ein mindestens unpräziser Vorwurf. So seltsam es auch klingen mag bei einem Autor, dessen Bücher regelmäßig an der 1000-Seiten-Grenze kratzen: King denkt nicht in Handlungsbögen und groß angelegten Plots, sondern situativ. Er setzt Menschen in Situationen hinein und schaut ihnen dabei zu, wie sie damit umgehen, wie sie reagieren. So verhält es sich auch mit Danny Coughlin, dem Protagonisten der mit 225 Seiten längsten Erzählung in „Ihr wollt es dunkler“. Coughlin ist einer jener einfach gestrickten, von jeglicher Metaphysik unbeleckten Typen, die die idealen Spielfiguren für Kings Existenz-Feldversuche abgeben:
"Er hat noch nie einen Geist gesehen, findet Filme über Dämonen und Verfluchungen reine Zeitverschwendung und würde nicht zögern, bei Dunkelheit durch einen Friedhof zu spazieren, wenn das eine Abkürzung wäre. Er geht nicht in die Kirche, denkt nicht über Gott oder das Leben nach dem Tode nach, nimmt sein Leben, wie es kommt, und hat die Wirklichkeit nie infrage gestellt."
Danny Coughlin ist ein geradezu klassischer King-Charakter: Ein trockener Alkoholiker Ende 30, dessen Frau sich aufgrund seiner Sucht und des damit verbundenen Kontrollverlusts von ihm hat scheiden lassen und das gemeinsame Kind mitgenommen hat. Die Alkoholsucht und die Entwöhnung von der Droge sind ein Generalthema, das sich durch Kings Bücher zieht. In den gegen die Verlockungen des Alkohols kämpfenden Männern steckt, wie der Autor es einmal verraten hat, stets ein Selbstporträt. Auch King war bis in die späten 1980er-Jahre hinein alkoholkrank. Die Figur des Psychopathen Jack Torrance in „Shining“, entstanden bereits 1977, interpretierte King später als einen unbewussten Hilferuf. Danny Coughlin hingegen hat mittlerweile festen Boden unter den Füßen, lebt in einem Trailerpark in Kansas, ist allseits beliebt und arbeitet als Hausmeister an der örtlichen High School. In dieses befriedete Leben bricht das Unheimliche in Form eines Traums ein:
"Dannys Beine tragen ihn vorwärts. Er sieht, dass der Hund eine Hand und teilweise auch den dazugehörigen Unterarm aus dem Boden gescharrt hat. Zwei Finger sind bis auf die Knochen abgenagt. Auch der fleischige Teil der Handfläche ist verschwunden und befindet sich jetzt im Hundebauch. Ums Handgelenk – ungenießbar und daher nutzlos für einen hungrigen Hund – liegt ein Bettelarmband. Danny holt Luft, öffnet den Mund und..."
Ein Traum wird Wirklichkeit
Der Traum lässt Danny nicht mehr los. Er beginnt, im Internet zu recherchieren und stellt fest, dass es den Ort, an dem er in seinem Traum die Frauenleiche gefunden hat, in der Realität tatsächlich gibt. Also macht Danny sich auf den Weg und findet alles exakt so vor, wie er es geträumt hat: Die tote Frau, den Hund, das Armband. Sein Traum war eine Eingebung, wie er sie nie zuvor in seinem Leben hatte und die ihn in tiefe Verwirrung stürzt. In seiner Angst, man könnte ihm die Traum-Geschichte nicht glauben, verlässt Danny den Tatort und verständigt anonym die Polizei. Genau das allerdings wird ihm zum Verhängnis, denn die Ermittler identifizieren Danny als Hinweisgeber. Ab diesem Augenblick gerät Danny ins Visier einer weiteren klassischen King-Figur: Franklin Jalbert, den King als einen Wiedergänger des Polizisten Javert in Victor Hugos „Die Elenden“ konzipiert hat, übernimmt den Fall. Jalbert ist ein schlafloser Getriebener, der an einer Arithmomanie, an einem manischen Zählfimmel, leidet:
„Nachdem er sich anderthalb Stunden hin und her gewälzt hat, schlägt er die Decke zurück und steht auf. Er muss ein Stück gehen, und er muss zählen. Tut er das nicht, rastet er noch aus. Wieder einmal kommt ihm der Gedanke, sich den Lauf seiner Waffe in den Mund zu stecken, und das ist durchaus verlockend.“
„Danny Coughlins böser Traum“, so der Titel der Erzählung, ist eine im Grunde klassische, aber mystisch grundierte Kriminalgeschichte, in deren Zentrum das Duell zwischen Ermittler und Verdächtigem steht. Solche Geschichten erzählt Stephen King routiniert, spannend und vor allem als Spiegel der amerikanischen Gegenwart mit all ihren sozialen Ungleichheiten und psychopathischen Aufladungen.
Raus aus den Komfortzonen
Dass in einem 800 Seiten starken Erzählungsband nicht jede Geschichte die gleiche Qualität haben kann, ist eine Binsenweisheit. Vor allem zwei der kürzeren Erzählungen sind Kabinettsstückchen mit einem etwas lahmen Knalleffekt am Ende. Lesenswert und gelungen sind aber auch sie. An mancher Stelle wird King geradezu altersmilde, beispielsweise in der Erzählung „Laurie“. Darin findet ein Mann unmittelbar nach dem Tod seiner Frau Trost in Gestalt einer kleinen Hündin, die er eigentlich gar nicht haben wollte. Laurie, so heißt das Tier, wird zu einer Begleiterin und Beschützerin zugleich; zu einer Art Schutzgeist sogar:
„Lloyd streichelte sie. Laurie sah mit ihren Bernsteinaugen zu ihm hoch. Er fragte sich wie so oft, was sie wohl in dem Gesicht erblickte, das da in ihres herabsah. Wie die Sterne, die er sah, wenn er Laurie nachts hinausließ, war das ein Mysterium. Und das war gut so. Ein kleines Mysterium war etwas Gutes, vor allem wenn sich die Jahre dem Ende zuneigten.“
Man darf das ein wenig sentimental finden. Solche Passagen relativiert King in „Ihr wollt es dunkler“ allerdings sofort wieder. Eine seiner Spezialitäten ist es, auch seinen Lesern das Gefühl zu geben, dass sie sich in keiner Situation sicher fühlen dürfen. Nicht in ihren vier Wänden, nicht in einem von vermeintlich bewährter Technik geschützten Raum. Das Unbehagen von Stephen King beruht unter anderem darauf, dass er die Komfortzonen seines Publikums genau kennt und eben dort zu bohren beginnt. Wer die Erzählung „Ein Fachmann für Turbulenzen“ gelesen hat, dürfte zukünftig mit einem anderen Gefühl in ein Flugzeug steigen:
„Dixon schloss die Augen und wartete darauf zu sterben. Er wusste zwar, dass es nicht dazu kommen würde, wenn er seine Aufgabe erledigte, dafür war er ja da, aber es war immer dasselbe. Immer wartete er darauf zu sterben.“
Helle erzählerische Flamme
Den Abschluss von „Ihr wollt es dunkler“ bildet eine Erzählung, die King vor knapp 50 Jahren in seinen frühen Jahren begonnen und nun auf Drängen seines Neffen beendet hat. „Der Antwortmann“, so der Titel, erzählt im Zeitraffer ein Leben vom Beginn bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Darin begegnet Phil Parker, ein Rechtsanwalt aus New Hampshire, immer wieder in entscheidenden Situationen seines Lebens einem Mann, den nur er sehen kann und der als „Der Antwortmann“ einen bescheidenden Stand am Rand der Landstraße aufgeschlagen hat. Es ist eine Geschichte, die die Frage aufwirft, ob es tatsächlich einen Gewinn bringen könnte, wüsste man über die eigene Zukunft Bescheid.
„Der Antwortmann“ ist eine so unheimliche wie auch anrührende Geschichte. Es ist ein Miniatur-Entwicklungsroman über einen Menschen, der schmerzhaft erfahren muss, dass das Schicksal genau dort zuschlägt, wo er selbst es am wenigsten vermutet hätte. Der würdige Abschluss eines Erzählungsbandes, der definitiv ein Alterswerk ist. Ein Alterswerk allerdings, in dem Stephen King sich spielfreudig, variationsreich und auf der Höhe seiner Möglichkeiten zeigt. „You want it darker“, flüstert Leonhard Cohen und schickt hinterher: „We kill the flame.“ Stephen Kings erzählerische Flamme leuchtet in diesem dunklen Buch besonders hell.






