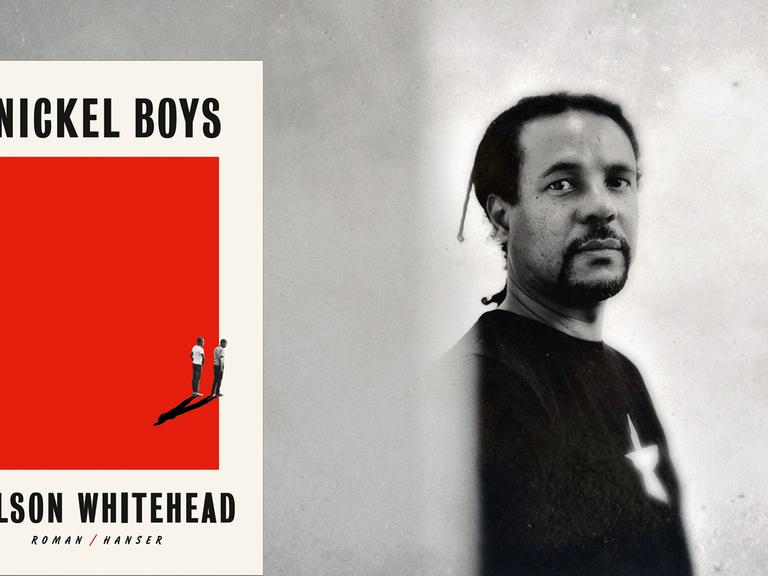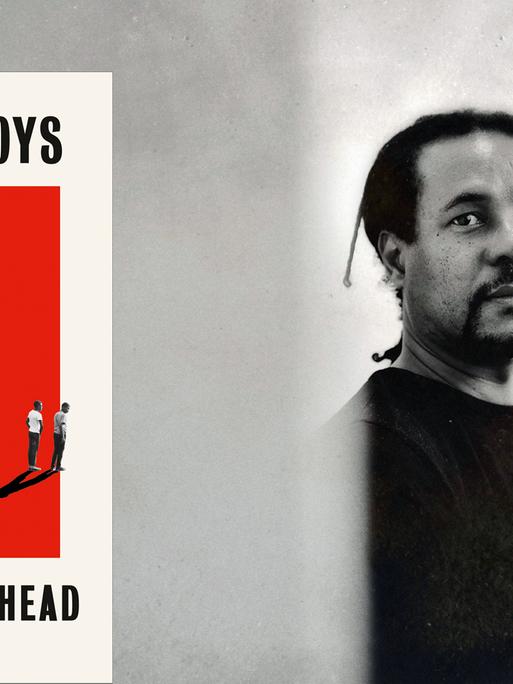Richard Wright: "Sohn dieses Landes"
Aus dem amerikanischen Englisch von Klaus Lambrecht, ergänzt und überarbeitet von Jasmin von Rauch.
Kein & Aber, Zürich 2019
576 Seiten, 24 Euro
Das Innenleben einer geschundenen Seele
06:17 Minuten

"Sohn dieses Landes" spielt im Chicago der 1930er: Beklemmend intensiv und psychologisch eindringlich schreibt der US-Autor Richard Wright über Rassismus. Der Roman erschien erstmals 1940 – für den deutschen Buchmarkt ist er eine Neuentdeckung.
Lust auf einen großen amerikanischen Roman? Dies ist einer und hierzulande immer noch zu entdecken.
"Sohn dieses Landes" erschien erstmals 1940. Innerhalb von drei Wochen verkauften sich eine Viertelmillion Exemplare. Der Roman des 1908 geborenen Richard Wright verdrängte John Steinbecks "Früchte des Zorns" von der Spitze der Bestsellerliste. Es war der bis dahin größte Erfolg eines afroamerikanischen Autors.
So spannend wie Dostojewski
Die Durchschlagskraft des Buches wird schnell plausibel, wenn man den Roman heute in der überarbeiteten und vervollständigten Übersetzung von 1941 liest. Mit seiner beklemmenden Intensität der Darstellung und seiner psychologischen Eindringlichkeit schlägt er in den Bann wie Dostojewskis "Verbrechen und Strafe".
Die Hauptfigur Bigger Thomas, ein junger Mann aus dem "schwarzen Gürtel" Chicagos, gleicht einer wandelnden Bombe. Er lebt mit seiner Mutter und den jüngeren Geschwistern zusammengepfercht in einem schäbigen, rattenverseuchten Zimmer und droht in die Gang-Kriminalität abzurutschen. Dann bekommt er einen Job als Chauffeur bei einem reichen Weißen. Mr. Dalton ist eine widersprüchliche Gestalt. Seine Firma vermietet Schrott-Immobilien an die Schwarzen zu Wucherpreisen. Andererseits ist er ein freundlicher Mann, der Millionen in philanthropische Projekte steckt.
Ein Monster, getrieben von Panik und Paranoia
Schon der erste Tag im Dienst der Daltons endet katastrophal. In der Panik, als Schwarzer in einer verfänglichen Situation mit der betrunkenen Tochter Mary ertappt zu werden, bringt Bigger das Mädchen um. Einerseits ist der Mord ein "Versehen", andererseits aber auch die Konsequenz der permanenten rassistischen Demütigung und der Verhaltensmuster, die aus ihr hervorgehen. Bigger zerstückelt die Leiche und stopft sie in die Heizung der Villa.
Die Bigger-Figur ist mit ihrer Brutalität nicht als Sympathieträger angelegt, als Klischeebild des bemitleidenswerten Unterdrückten. Er ist ein Monster, getrieben von Panik und Paranoia. Er sieht sich wie eine Ratte in die Ecke gedrängt von den Weißen, die er nicht als Menschen, sondern als "drohende Naturgewalt" empfindet.
Nach der Treibjagd auf den Mörder kommt es zum Prozess. Draußen tobt der weiße Lynchmob, und der Staatsanwalt trägt seine vor Rassismus triefende Anklage vor. Biggers jüdischer Verteidiger Boris Max jedoch hält ein ergreifendes Plädoyer, das den Mörder als Produkt unmenschlicher Verhältnisse zeichnet und die Grundübel der rassistischen Gesellschaft benennt: Angst, Hass und Gewalt.
Ein Hang zum Surrealen
Zwar ist Richard Wright geschult am sozialen Realismus der 30er-Jahre. Viele Kapitel des Romans haben allerdings einen Zug ins Surreale, was sich keiner formalen Experimentierlust verdankt, sondern Wrights gelungenem Bemühen, das Innenleben einer geschundenen Seele zum Ausdruck zu bringen.
"Er hatte gemordet, und damit hatte er sich ein neues Leben geschaffen." Es finden sich immer wieder solche Sätze, die getragen sind von einem existenzialistischen Pathos, das die Theorie einer bloßen sozialen Determination des Verbrechens durchkreuzt. Gerade weil Biggers Handeln sich nicht in einer Formel auflösen lässt, ist es so beunruhigend.