Mason Currey: Musenküsse. Für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Die täglichen Rituale berühmter Künstler
Aus dem Amerikanischen von Anna-Christin Kramer
Kein&Aber, Zürich 2014
256 Seiten, 14,90 Euro
88 Wege zur Kreativität
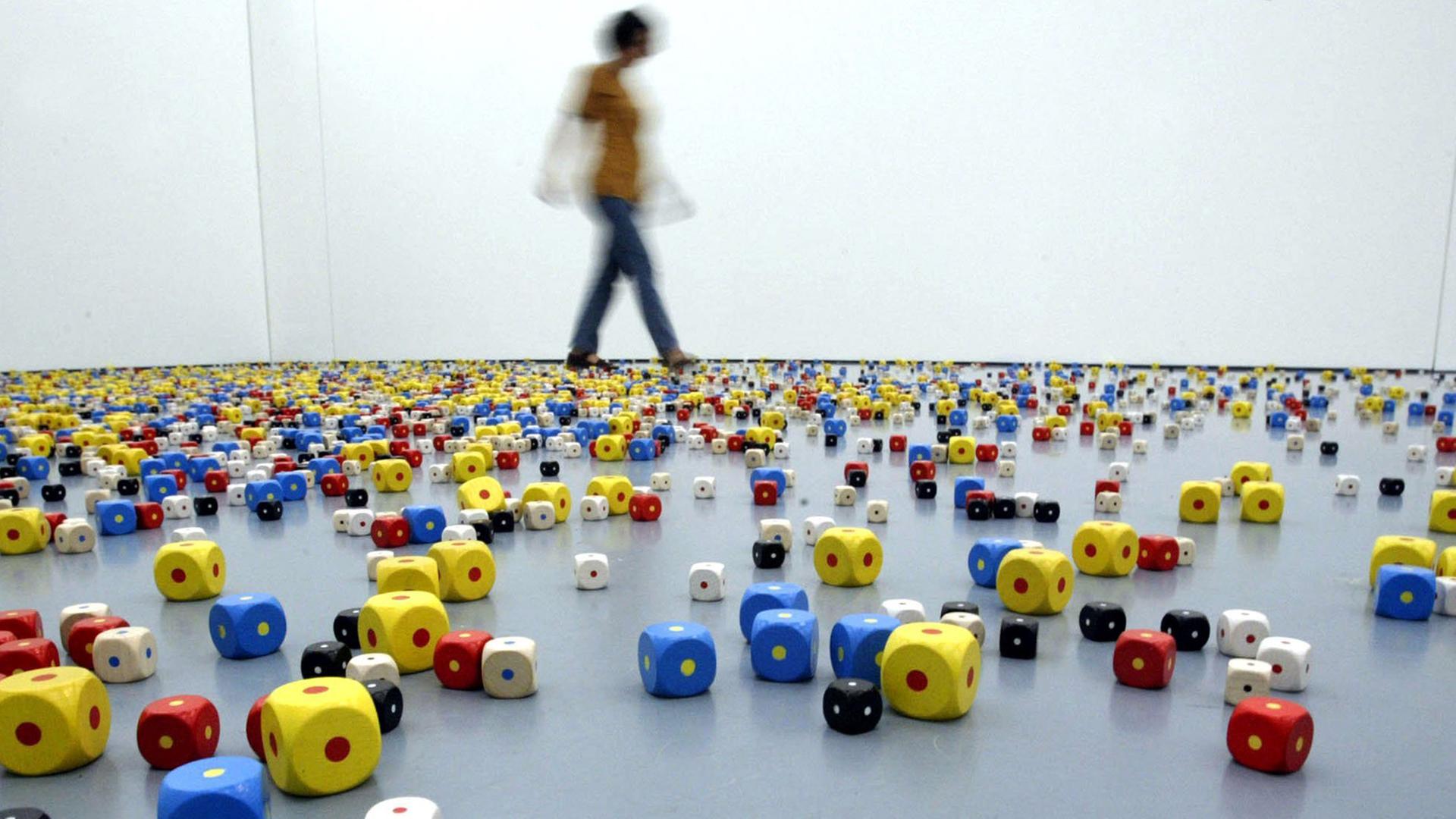
Jeder Künstler hat seine eigene Methode, dem Tag ein Kunstwerk abzutrotzen. Der amerikanische Journalist Mason Currey hat Alltagsstrategien berühmter Künstlerinnen und Künstler zusammengetragen.
Die Kreativwirtschaft floriert, Bürozeiten von 9 bis 17 Uhr sind passé und die "kreative Klasse" steht vor einem Problem: Freischaffende Webdesigner, Projektmanager oder Hörspielproduzenten müssen heute selbst bestimmen, unter welchen Arbeitsbedingungen sich ihre Kreativität entfaltet.
Da kommen die "Musenküsse" des amerikanischen Journalist Mason Currey gerade recht, in dem er 88 Alltagsstrategien berühmter Künstlerinnen und Künstler zusammen getragen hat. Darunter der titelgebende Rat des Regisseurs Woody Allen: "Für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche".
Jede Stunde sei genau getaktet
Currey zitiert neben Filmemachern auch Schriftsteller, Maler und Komponisten aus drei Jahrhunderten. Seine Auswahl wirkt oft beliebig, folgt aber dem strikten Kriterium, welche Berühmtheiten sich überhaupt zu ihrem Arbeitsalltag in Briefen, Tagebucheinträgen oder Interviews geäußert haben. Richard Strauss etwa beschrieb penibel seine Routine, als er im Jahr 1893 einen Brief aus seinem Kuraufenthalt in Ägypten nach Hause schickte. Jede Stunde sei genau getaktet, denn "er müsse eben komponieren, wie eine Kuh gemolken werden müsse".
Völlig anders ging dagegen sein russischer Kollege Dmitri Schostakowitsch ans Werk: Er komponierte seine Werke vollständig im Kopf, ehe er sie in Höchstgeschwindigkeit notierte. Was heute als geniale Gabe verehrt würde, machte Schostakowitsch zu schaffen: Komposition sei schließlich eine "ernste Sache" und die "rasende Geschwindigkeit" besorge ihn zutiefst. "Es ist anstrengend und recht unangenehm, und am Ende fehlt einem jegliches Vertrauen in das Ergebnis. Aber ich werde diese schlechte Angewohnheit einfach nicht los."
Eine gute Portion Zeitgeist spiegelt sich auch bei den Nobelpreisträgern unter den Schriftstellern: Als wahrer Familientyrann erscheint etwa Thomas Mann. "Zwischen 9:00 und 12:00 Uhr, wenn Mann am produktivsten war, durften die Kinder keinen Mucks von sich geben." Noch in den 1950er-Jahren musste sich dagegen Alice Munroe als Frau ihre Zeit zum Schreiben erst erkämpfen: "Wenn Nachbarn oder Bekannte vorbeischauten und sie beim Schreiben störten, traute Munroe sich nicht, ihnen zu sagen, dass sie gerade arbeitete."
Kein einheitliches Bild
Viele der vorgestellten Künstler haderten mit den gesellschaftlichen Erwartungen und Rollenbildern an ihre Zunft, sodass viele Werke entgegen widriger Umstände entstanden. So ergibt sich aus der Fülle der Beispiele partout kein einheitliches Bild. Die Zauberformel für Kreativität scheint es nicht zu geben. Doch die oft sehr amüsant zu lesenden Zeugnisse legen eine tiefere Weisheit frei: Es könnte sich lohnen, auf sich selbst zu hören und eigene Macken zu zulassen.
Marcel Proust schlief tagsüber und arbeitete nachts, Francis Bacon hat gesoffen, Franz Kafka turnte nackt bei offenem Fenster und die britische Dichterin Edith Sitwell ließ sich der Legende nach durch das Liegen in Särgen inspirieren. Wenn Künstler die besten Schüler der neoliberalen Schule sind, wie ein belgischer Sozialforscher einmal formulierte, dann machen diese exzentrisch-liebenswürdigen Vorbilder Hoffnung.
