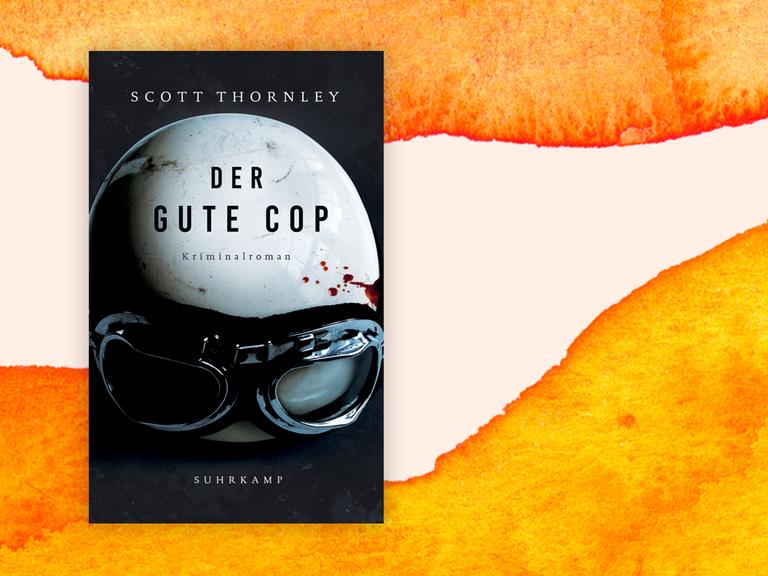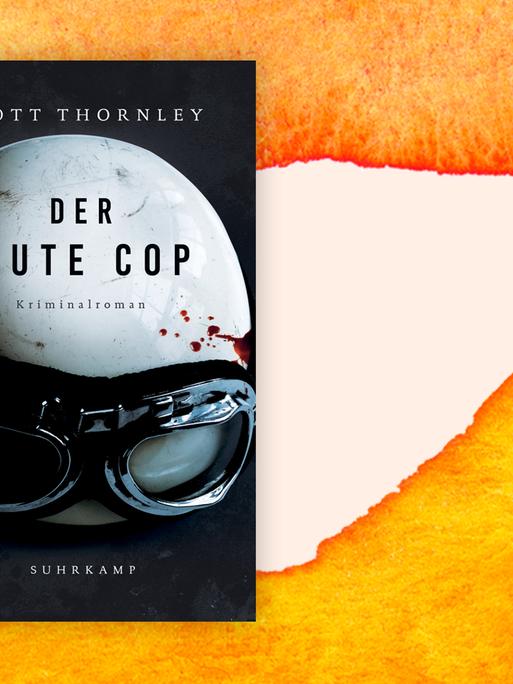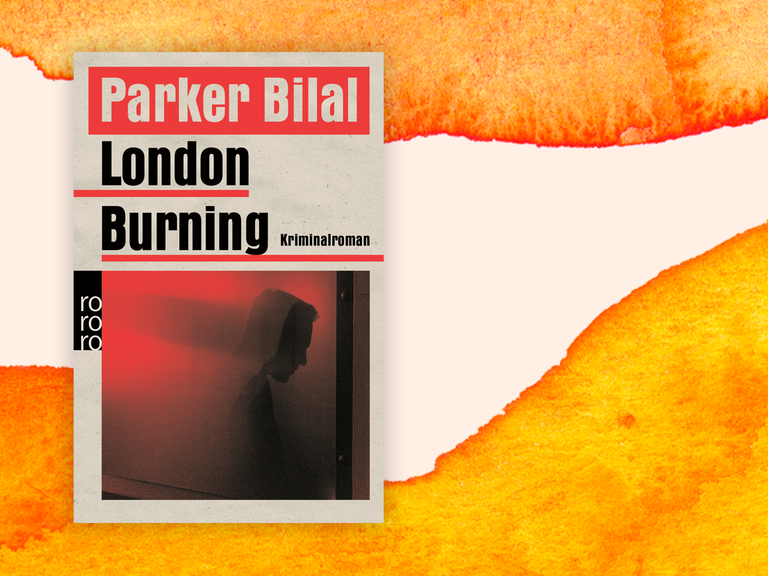Sara Sligar: "Alles, was zu ihr gehört"
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Ulrike Brauns
Verlag Hanserblau, München 2020
496 Seiten, 16 Euro
Aggression und Leidenschaft
02:54 Minuten

Eine neue Stimme in der US-amerikanischen Kriminalliteratur: Sara Sligar zeichnet in ihrem Debütroman "Alles, was zu ihr gehört" das Porträt einer Künstlerin, die zwischen Depression und sexistischer Gewalt zerrieben wird.
Kate Aitken will ihr altes Leben hinter sich lassen, also verlässt sie New York und die Medienbranche, um in einem Küstenstädtchen in der Nähe von San Francisco den Nachlass der feministischen Fotografin Miranda Brand zu sortieren. Schon bald ist sie zutiefst fasziniert von der Fotografin und dem Geheimnis um ihren Tod.
Einst wurde ihr Ableben als Selbstmord deklariert, möglicherweise aber wurde sie auch ermordet. Als Hauptverdächtiger galt damals ausgerechnet Kates Auftraggeber, Mirandas Sohn Theo, zu dem sich Kate stark hingezogen fühlt.
Im Nachlass fehlt das Tagebuch
Sara Sligar verhandelt in "Alles, was zu ihr gehört" die faszinierende Geschichte von zwei Frauen. In der Gegenwart wühlt sich Kate durch die Briefe, Fotos, Dokumente und Rechnungen im Nachlass von Miranda und hadert mit den Vorfällen in New York, derentwegen sie die Stadt verlassen musste.
Der zweite Erzählstrang ist das Tagebuch von Miranda. Geschrieben hat sie es von 1982 bis zu ihrem Tod im Jahr 1993. Es könnte Aufschluss darüber geben, ob sie Selbstmord begangen hat. Aber es war nicht im Nachlass. Kate hatte es bei ihren heimlichen Streifzügen durch das Brand-Haus in Theos Nachttischschublade gefunden.
Zwei Zeitebenen, zwei Erzählstimmen sind konventionelle erzählerische Anlagen gerade in psychologischen Spannungsromanen. Bei Sligar aber entwickeln sich insbesondere Mirandas Tagebuchpassagen zu dem beeindruckenden Zeugnis einer Künstlerin, die zerrieben wird von dem Leben, einem gewalttätigen Mann und einer vermutlich postnatalen Depression.
Reflexionen über die Rolle von Künstlerinnen
Diese Passagen sind aggressiv, leidenschaftlich, verzweifelt und euphorisch, sie enthalten Reflexionen über Fotografie und die Rolle von Künstlerinnen, in ihnen spiegelt sich Mirandas Unsicherheit und Bestimmtheit in ihrer Kunst. Sie haben einen völlig anderen Ton, sind stilistisch sehr eigenständig – und machen Sligar zu einer aufregenden neuen Stimme in der Kriminalliteratur.
Im Vergleich ist die Gegenwartsperspektive ein wenig schwächer. Hier erklärt Sligar manchmal zu viel. Doch dieser Makel passt erstaunlich gut zu den Frauen in diesem Roman: Auch sie sind widersprüchlich, sind stark und schwach, alles andere als sympathisch, sondern sehr menschlich. Sie treffen schlechte Entscheidungen und hadern mit den gesellschaftlichen Erwartungen, die an sie als Frauen, als Feministinnen und als Künstlerinnen gestellt werden.
Im Zusammenspiel werfen diese zwei Frauenleben zu verschiedenen Zeiten hoch spannende drängende Fragen nach Machtverhältnissen und Eigenständigkeit auf, auf die es glücklicherweise keine eindeutigen Antworten gibt. Weder in diesem Roman noch im Leben.