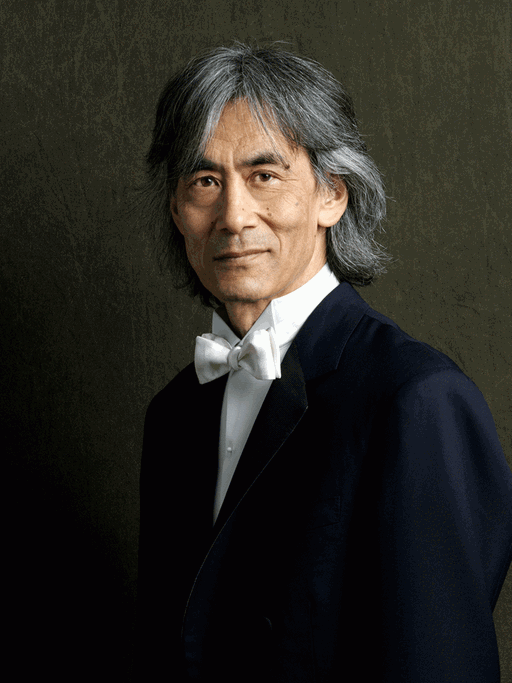Ein Roman in vier Sätzen

Mehr als 600 Lieder komponierte Franz Schubert. Doch er nahm auch die Herausforderung des Vorbildes Beethoven an und widmete sich dem Schreiben von Sinfonien. Seine "Große" in C-Dur galt damals als längstes Orchesterwerk überhaupt.
Als Franz Schubert 1828 mit gerade 31 Jahren starb, wurde seine Hinterlassenschaft ordentlich aufgelistet. Sie bestand vorwiegend aus Wäschestücken, darunter einige Paar Socken, vier Hemden, eine Matratze und eine Decke, sowie "einige alte Musikalien" – in dieser Reihenfolge.
Elf Jahre später machte Robert Schumann einen Neujahrsbesuch bei Schuberts Bruder in Wien, stöberte in den "alten Musikalien" und fand einen Schatz – die große C-Dur-Sinfonie.
Schumann begriff den künstlerischen Wert der Komposition sofort, Felix Mendelssohn Bartholdy brachte sie mit dem Gewandhausorchester Leipzig zur Uraufführung – stark gekürzt allerdings, denn die Musiker verzweifelten wohl spätestens am wirbelnden letzten Satz.
Schubert selbst hat sein Werk nie gehört. Schon der Versuch, es wenigstens einmal durchzuspielen, scheiterte zu seinen Lebzeiten kläglich. Man überreichte dem Komponisten hundert Gulden als Trostpreis, der Autograph lag fortan im Archivschlaf bei der Gesellschaft der Musikfreunde zu Wien.
Schubert steckte seine Abschrift in die Schublade – und für die Schublade zu komponieren, das war für ihn ja nichts Neues.
Nicht Verzweifeln an Beethoven
In Wien 1824, als Schubert anfing, über seine Sinfonie nachzudenken, gab es vor allem ein Gesprächsthema: Beethovens aktuelles Werk mit Sängern und Chor, die Neunte Sinfonie. Schubert hatte die Uraufführung miterlebt, war völlig begeistert und fühlte sich zugleich vollkommen nidergeschmettert. Schließlich komponierte er selbst ein Werk nach dem anderen, hatte aber den Ruf: "Du kannst nur Lieder".
Schubert wusste: Wenn er in Wien etwas gelten wollte, musste er nachlegen, mit einer großen Sinfonie. Dass er sich, mit Beethovens Vorbild im Nacken, doch verhältnismäßig schnell befreien und den übermächtigen Eindruck in etwas Eigenes, Schöpferisches verwandeln konnte, das liegt vor allem auch daran, dass Schubert seinen ganz eigenen Ton hat.
Wienerisch von Anfang an
Immer, vom ersten Lied bis zum letzten Sinfonieakkord, spricht Schubert seine eigene musikalische Sprache, ein eigenes wienerisches Idiom. Nikolaus Harnoncourt spitzte das in der Formulierung zu, Schubert habe Wienerisch "von Geburt an" gesprochen.
Das Volksliedhafte frei von jeglicher Tümelei, Wehmut und Melancholie sowie ein durchgehend wandernder rhythmischer Schwung aus punktierten Noten ziehen sich durchs gesamte Werk – alles entwickelt aus der Keimzelle allerersten Beginns.
Dabei denkt Schubert vom Lied her, mehr als 600 von ihnen hat er ja geschaffen, gilt als eigentlicher Schöpfer dieser Gattung. Diese strömende Klangrede nimmt er mit ins Orchester. Schubert entfaltet sein Material in die Weite, gestaltet nicht oder doch selten "kämpferisch" wie Beethoven, sondern lässt aussingen, ohne die Fäden der Konstruktion aus der Hand zu geben.
Das braucht Zeit. Und so entsteht mit seiner C-Dur-Sinfonie für viele Jahre das längste reine Orchesterwerk überhaupt.
Lesarten aus sieben Jahrzehnten
Aufführungen und Aufnahmen dieses musikhistorischen Meilensteins fallen höchst unterschiedlich aus, abhängig nicht zuletzt davon, ob man sich wie in älteren Deutungen auf Bearbeitungen stützt oder den Autographen konsultiert.
Zu hören sind Interpretationen aus sieben Jahrzehnten unter Leitung von Wilhelm Furtwängler, René Leibowitz, Bruno Walter, Herbert Blomstedt, Claudio Abbado, Nikolaus Harnoncourt, John Eliot Gardiner und Iván Fischer. Mit dem Chamber Orchestra of Europe hat einmal sogar das gleiche Orchester im selben Jahr Schuberts Sinfonie mit verschiedenen Dirigenten aufgenommen – mit Claudio Abbado und Nikolaus Harnoncourt.