Unser Bildungssystem bleibt mittelmäßig

Das deutsche Bildungssystem stehe heute innerhalb der OECD im oberen Mittelfeld, sagt der Bildungsforscher Ludger Wößmann. Damit sei die Bundesrepublik immer noch deutlich weit entfernt von Spitzenreiterländern wie Singapur und Japan, aber auch Estland oder Finnland.
Marcus Pindur: Die erste PISA-Studie löste in Deutschland einen Schock aus. Das war im Jahr 2000. Wie sich herausstellte, waren die deutschen Schulen im internationalen Leistungsvergleich doch nicht so gut, wie man es jahrzehntelang gedacht hatte. Seitdem hat sich viel getan im deutschen Schulsystem. Die PISA-Studien, ein Leistungsvergleich der OECD, gibt es immer noch. Und auch innerdeutsche Bildungsstudien sorgen immer wieder für Wirbel. Wie gut sind deutsche Schulen aufgestellt? Und wie wichtig ist das für unsere Wirtschaft und Gesellschaft? Wir sprechen in unserer Sendung Tacheles darüber mit Professor Ludger Wößmann, Bildungsforscher und Volkswirt am Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag, Herr Wößmann.
Ludger Wößmann: Hallo.
Pindur: Zwanzig Jahre nach dem PISA-Schock: nennen Sie mal drei Dinge, die tatsächlich an deutschen Schulen heutzutage gut funktionieren.
Wößmann: Das ist gleich ein bisschen schwierig zu machen, weil, genau was wir aus den Studien gelernt haben, ist natürlich, dass sich nicht immer alle Schulen über einen Kamm scheren lassen. Darum will ich jetzt nicht zu plakativ hier sagen, das läuft gut an deutschen Schulen, das läuft schlecht an deutschen Schulen. Genau wie bei der Leistung, was wir gesehen haben, ist eigentlich letztendlich auch bei dem, was getan wird, Deutschland in vielerlei Hinsicht im internationalen Vergleich Mittelmaß.
Man kann diskutieren, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Aber wenn ich drei Sachen nennen sollte, die sich zumindest ein stückweit verbessert haben: Ich glaube, das erste ist tatsächlich, dass wir einen stärkeren Fokus auf die Lernergebnisse bekommen haben. Genau durch diese Studien ist das, was bis dahin eigentlich kaum jemand gefragt hat, was kommt da wirklich hinten raus, was haben die Kinder und Jugendlichen gelernt in der Schule, etwas, woran wir viel mehr denken. Zuvor haben wir viel mehr über Inputs und über Schulzeiten und ähnliches nachgedacht.

Schüler eines Magdeburger Gymnasiusm bei den Abiturprüfungen© Jens Wolf / dpa
Ein zweiter Punkt ist, dass wir ein Stück weit mehr Vergleichbarkeit der Prüfungen bekommen haben. Zumindest viele Bundesländer haben externe Abschlussprüfungen, so was wie ein Zentralabitur eingeführt. Es gibt ein paar Bemühungen, auch zwischen den Bundesländern mehr Vergleichbarkeit zu bekommen. Da kann man drüber streiten, wie weit man da gekommen ist. Aber das ist sicherlich auch etwas, was die Sache zum einen gerechter, aber auch klarer macht, um zu sehen, wo wir da eigentlich stehen.
Drittens gibt es mancherorts ein bisschen mehr Autonomie für die Schulen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel können die Schulen vielfach selbst Lehrer einstellen. Früher war das anders. Aber in den meisten Bundesländern ist es immer noch anders. Da werden die Lehrer zum Beispiel von zentralen Verwaltungsbehörden zugewiesen. Und wie so oft weist vieles darauf hin, dass – wenn wir so eine zentrale Verwaltungswirtschaft haben – das meist nicht zu den besten Ergebnissen führt.
Erst "unteres", jetzt "oberes Mittelfeld"
Pindur: Wo stehen wir denn im internationalen Vergleich? Sie haben sich viel mit internationalem und auch historischem Vergleich befasst. Wo liegen wir da insgesamt?
Wößmann Genau. Ich würde mal sagen, wir liegen jetzt im oberen Mittelfeld und haben zu Beginn bei PISA im unteren Mittelfeld gelegen. Wenn man das so ein bisschen vergleicht, man sollte jetzt auch nicht auf einzelne Liga-Punkte oder Plätze schauen, das ist vielleicht gar nicht so entscheidend, aber es ist schon wichtig sozusagen: Wie weit weg sind wir von den besten Ländern, von den schlechtesten Ländern?
Wir lagen deutlich im unteren Mittelfeld. Und wir haben uns seit 2000 stetig, nicht mit sehr großen Schritten, aber eigentlich so stetig wie kaum ein anderes Land, verbessert, so dass wir jetzt bis 2012 sehr gut da standen und, ich sage mal, im oberen Mittelfeld lagen. Das war die vorletzte PISA-Studie.
Und dann die letzte PISA-Studie, die findet alle drei Jahre statt, war 2015, für die wir die Daten jetzt haben: Da hat es deutliche Rückschritte gegeben, zumindest in Mathematik und Naturwissenschaften. Beim Lesen sind wir etwa gleich geblieben. Da streitet man sich noch ein bisschen drüber, hat das mehr damit zu tun, dass PISA vom Papier- und Stift-Test umgestellt hat auf einen computerbasierten Test? Das könnte möglicherweise leicht zu Verzerrung geführt haben. Aber insgesamt ist das ein bisschen alarmierend, dass jetzt sozusagen der positive Trend abgebrochen ist und wir uns verschlechtert haben.
Also, wir stehen im Rahmen der entwickelten Länder der OECD im oberen Mittelfeld. Da heißt, wir sind aber auch noch deutlich weit entfernt von Spitzenreiterländern, ich sage mal, wie Singapur und Japan, aber auch Ländern wie Estland oder Finnland, die in den meisten Fächern deutlich besser sind als wir.
Finnland als Vorbild
Pindur: Was machen denn diese Länder Ihrer Ansicht nach besser als wir?
Wößmann: Wir haben in dem Bereich tatsächlich viel Forschung gemacht, um zu sehen, was machen denn Länder, die gut sind, systematisch anders als Länder, die schlecht sind.
Es ist natürlich so, dass direkt nach dem PISA-Schock ein großer Tourismus nach Finnland hin eingesetzt hat und jeder schauen wollte, was machen die denn anders, damit wir so gut werden können wie Finnland. Aber das ist natürlich ein großes Problem. Denn Finnland macht sicherlich Dutzende von Sachen anders als wir. Und die Frage ist: Welche davon sind dafür verantwortlich, dass sie besser sind? Das kann man wissenschaftlich gesehen eigentlich nur beantworten, indem man möglichst viele Länder gleichzeitig anschaut und schaut, ob Länder, die dieses oder jenes anders machen, tatsächlich auch systematisch besser abschneiden.
Was wir da sehen, ist erstens ein bisschen überraschend. Es ist halt nicht so, dass die Länder, die besser abschneiden, deutlich mehr Geld ins System stecken würden oder zum Beispiel kleinere Klassen hätten. Das sieht man überhaupt nicht, sondern da gibt’s keinen Zusammenhang.
Insgesamt aus meiner Sicht hat die Forschung deutlich gezeigt, dass es schon Dinge am Schulsystem sind, die besser gemacht werden, und zwar alles im Bereich der institutionellen Rahmenbedingungen.

Schüler an einer Gesamtschule schreiben ihre Abschluss-Arbeiten© dpa/Julian Stratenschulte
Länder, die externe Abschlussprüfungen haben, so was wie ein Zentral-Abitur, schneiden systematisch besser ab. Es scheint so zu sein, dass das die richtigen Anreize setzt für die Schulen, die Lehrer, aber auch für die Schülerinnen und Schüler, sich tatsächlich auf die Ergebnisse zu konzentrieren. Weil, am Ende des Tages wird das überprüft und offengelegt. Wir können vergleichen. Dann lohnt es sich, sich anzustrengen, weil, am Ende des Tages sieht man, man ist besser geworden.
Wenn das nicht der Fall ist, wenn am Ende des Tages nie jemand sieht, wie viel die SchülerInnen wirklich gelernt haben, dann ist es weder für die Schülerinnen und Schüler, noch für die Lehrkräfte besonders anregend zu sagen, ich setze mich jetzt voll dafür ein, dass sie wirklich was lernen. Das ist so ein Aspekt.
Ein zweiter Aspekt ist: Wenn wir externe Abschlussprüfungen haben, dann schneiden Schüler in Schulen besser ab, die mehr Autonomie haben, die tatsächlich mehr Selbständigkeit haben, über die verschiedensten Dinge selber entscheiden können. Es scheint also so zu sein: Wenn externe Prüfung die Standards klar vorgeben und auch überprüfen, dass es dann die Schulen vor Ort sind, die eigentlich am besten wissen, wie sie da hinkommen.
Ein dritter Aspekt, der auch noch wichtig ist, ist, dass Länder besser abschneiden, die einen größeren Anteil von Schulen in freier Trägerschaft haben. Das scheint mehr Wahlmöglichkeiten für die Eltern zu geben, dadurch auch einen gewissen Wettbewerb zwischen den Schulen, der – und das zeigt die Forschung in diesem Bereich – scheinbar dazu führt, dass insgesamt die Schülerleistungen besser sind.
Viel Geld, bessere Bildung?
Pindur: Viele Bildungsexperten haben sich an dieser Äußerung von Ihnen gerieben, man brauche eben nicht mehr Geld für bessere schulische Leistungen. Aber andererseits scheint es doch unmittelbar einleuchtend zu sein, dass man für bessere Betreuung, für intensiveres Lernen auch mehr Lehrer und vielleicht auch bei Problemschulen auch mehr Sozialarbeiter braucht. Das kostet Geld.
Wößmann: Das kostet Geld! In der Tat ist es ja häufig so, dass vieles, was so offensichtlich scheint, am Ende des Tages vielleicht doch nicht das Wichtigste ist.
Ich gehe mal von der Klassengröße aus. Natürlich sind wir alle überzeugt, dass kleinere Klassen viel besser sind. Ob am Ende des Tages die wirklich viel mehr lernen, in Abhängigkeit davon, wie viele da jetzt da sind, das ist eben die Frage, die wir empirisch untersuchen müssen. Das ist ja nicht nur meine Forschung in diesem Bereich, die eher darauf hindeutet, dass das kaum einen Effekt hat, sondern da gibt’s eine riesengroße breite Forschung auch aus den reinen Bildungswissenschaften. Ich sage mal, 95 Prozent der Studien in diesem Bereich kommen zu dem Ergebnis, dass das keine oder nur sehr kleine Effekte hat.

Schulassistenten unterstützen einzelne Schüler im gemeinsamen Unterricht© dpa/Holger Hollemann
Jetzt ist die Frage: Warum ist das so? Möglicherweise ist es eben einfach so, dass potenziell man vielleicht in kleineren Klassen besser unterrichten könnte, aber man dieses Potenzial gar nicht nutzt, weil, wenn man mal in einem Jahr dreißig Schüler vor sich hat, im nächsten Jahr zwanzig Schüler, aber dann den gleichen Unterricht macht, den gleichen Unterrichtsstil, dann ist möglicherweise gar nicht viel geholfen und es kommen tatsächlich nicht groß andere Ergebnisse raus.
Ich glaube, was wir insgesamt sehen, ist, dass wir auf in den entwickelten Ländern auf einem Niveau sind, wo das kein großer und gewichtiger Einflussfaktor mehr ist. Die durchschnittliche Klassengröße in Deutschland ist zurzeit 21 Schüler pro Klasse. Das ist deutlich kleiner als vor zehn Jahren. Je nach Schulart ist das um bis zu drei Schüler kleiner. Und es ist viel kleiner als das, was wir vor dreißig, vierzig oder fünfzig Jahren hatten.
Es ist offensichtlich nicht so, dass wir diese zusätzlichen Ressourcen, die wir dann da haben, so einsetzen, dass wirklich die Schülerinnen und Schüler mehr lernen. Um das zu verbessern scheint es wesentlich mehr darauf anzukommen, wie wir die Ressourcen einsetzen. Und dann kommen diese institutionellen Rahmenbedingungen zum Beispiel ins Spiel.
"Extrem viele" Reformen
Pindur: Welche institutionellen Rahmenbedingungen meinen Sie da? Es hat ja in den letzten zwanzig Jahren, sage ich mal, zwei Jahrzehnten ziemlich viele Reformen gegeben. Teilweise hatte man den Eindruck, das ist ein wenig hektisch, was da auf Länderebene passiert. – Welche Reformen waren und sind denn Ihrer Ansicht nach sinnvoll?
Wößmann: Ja, es ist in der Tat so, dass man das Gefühl hat, dass immer extrem viel reformiert wird. Das ist sicherlich auch so gewesen. Das Verrückte ist halt, dass ein Großteil dieser Reformen zum Beispiel überhaupt nichts mit den PISA-Ergebnissen zu tun hatte. Man musste möglichst schnell zeigen, dass man was tut als Politiker, um der Bevölkerung zu zeigen, wir haben gesehen, es gibt ein Problem, und wir machen jetzt was besser.
Was eine der Reformen ist, die, glaube ich, wirklich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt besser dastehen als zu Beginn, sind die externen Abschlussprüfungen. Zu Beginn von PISA hatten sieben der 16 Bundesländer Zentralabitur oder zentrale Prüfungen in der Mittleren Reife und in den anderen Abschlüssen.
Man hat dann gesehen, dass sozusagen im PISA-Test 2000 und 2003 es so war, dass man sehen konnte, dass de facto alle Bundesländer, die zentrale Abschlussprüfungen hatten, im Durchschnitt besser waren als auch nur das beste Bundesland, was keine zentrale Abschlussprüfung hatte.
Das war dann so offensichtlich zu sehen, dass sich Politiker da auch nur schwer gegen stemmen konnten, gegen dieses Offensichtliche. Und dann haben viele Bundesländer, bis auf eines, also 15 von 16 Bundesländern haben jetzt zentrale Abschlussprüfungen. Auch da gibt’s große Unterschiede, wie das genau umgesetzt wird, aber zumindest innerhalb der Bundesländer gibt’s am Ende derzeit einheitliche Prüfungen. Ich glaube, das ist in der Tat etwas, was dazu beigetragen hat, erstens, dass wir uns auf Ergebnisse fokussieren, und zweitens, dass wir ein bisschen mehr Vergleichbarkeit haben.
Das Zentralabitur als allgemeiner Standard
Pindur: Das heißt, schlicht und ergreifend hat die Politik einen Standard gesetzt. Hier ist das Zentralabitur. Da müsst ihr durch. Über diese Latte müsst ihr gehen. Und dann haben sich alle mehr nach der Decke gestreckt? Das wäre ja eine recht simple Erklärung, ein simples Erfolgsmodell.
Wößmann: Ja, ich würde es fast so simpel sehen. Natürlich, das ist alles viel komplexer, aber am Ende des Tages ist es genau das. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Schüler, machen gerade Ihren Abschluss in der Realschule. Und Sie wollen eine Lehrstelle bekommen. Sie gehen zum Lehrmeister vor Ort, legen dem das Zeugnis hin. Der schaut drauf und sieht, das ist eine Zwei in Mathe. Wenn das in Bayern ist, und ich spreche hier sozusagen von der Zeit vor der Vergleichbarkeit, wenn das in Bayern ist, dann sieht der Lehrmeister, oh ja, das sind ja die einheitlichen Abschlussprüfungen. Da kann ich halbwegs was draus lernen. Zwei in Mathe, der kann da ordentlich was. Den kann ich einstellen.

Schüler und Lehrerin während einer Unterrichtsstunde© imago / Photothek
Wenn Sie das Gleiche in NRW gemacht hätten damals, dann kann der Lehrmeister nur sagen: Entweder ist der selber ganz gut in Mathe oder die entsprechende Lehrkraft hatte sehr niedrige Standards und hat die Noten einfach so vergeben. Das heißt, Sie wissen eigentlich gar nicht, was Sie aus dieser Zwei in Mathe rausziehen sollen. Das heißt aber, Sie werden auch die Einstellungsentscheidung viel weniger aufgrund dieser Noten und viel mehr meinetwegen aufgrund von fünf Minuten, in denen Sie sich mit dem Bewerber mal unterhalten, entscheiden, als in Bayern.
Das wiederum merkt mit der Zeit eben auch der Bewerber. Und man weiß dann eben: Wenn das was zählt, wenn das vergleichbar ist und wenn zum Beispiel später auf dem Arbeitsmarkt die Leute drauf schauen oder wenn man zu einer Uni gehen will, dann lohnt es sich viel mehr, sich anzustrengen. Und dann strengen sich alle Schüler mehr an und werden besser.
Das Gleiche gilt nicht nur auf die Schüler bezogen. Das Gleiche gilt zum Beispiel auf die Lehrer und auch auf die Schulen bezogen. Wenn es regelmäßig so ist, dass die Schüler bei einer bestimmten Lehrkraft im Französisch-Abitur viel schlechter abschneiden als anderswo, dann wird man anfangen zu fragen, woran liegt’s und was müssen wir ändern.
Wenn es aber so ist, dass jeder Lehrer seine eigene Französisch-Abschlussprüfung macht, dann wird das nie jemand merken, dass hier nicht genügend gelernt wird.
Mehr lernen nach der Reform
Pindur: Kommen wir mal zu einer anderen Reform, die immer wieder für Furore gesorgt hat und die mittlerweile wieder rückabgewickelt wird, das achtjährige Abitur, das man eingeführt hat mit der Orientierung an vielen anderen industrialisierten Ländern, die auch nach der zwölften Klasse ihre Hochschulreife vergeben.
Jetzt kommen viele Länder wieder dazu, dass sie zum neunjährigen Abitur zurückkehren. Was halten Sie denn für sinnvoll?
Wößmann: Ja, ich glaube tatsächlich, aus der PISA-Forschung können Sie überhaupt nichts dafür ableiten, ob das jetzt sinnvoll wäre oder weniger sinnvoll. Das ist genau eine dieser Reformen, die ohne jede Evidenzfundierung gemacht wurde, aber auch ohne jede Prüfung und Testung, wie man es am besten machen kann.
Man muss ernsthaft sagen, dass das in vielen Bundesländern mehr oder weniger über Nacht gemacht wurde und sehr schlecht eingeführt wurde. Ich glaube, daher kommen auch viele der Unzufriedenheiten damit. Es gibt einiges an Forschung dazu, die insgesamt darauf hindeutet, dass wir wenig negative Effekte sehen und durchaus etliches an positiven Effekten.
Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, was 15-jährige Schülerinnen und Schüler gelernt haben, dann ist das sozusagen nach der Reform deutlich mehr gewesen. Es ist ja auch so, dass deutlich mehr Unterrichtszeit, mehr Stoff in die Mittelstufe verlagert wurde. Und das hat auch dazu geführt, dass die Schüler mehr gelernt haben.
Was ich ein bisschen verrückt finde, ist eben, dass man tatsächlich acht Jahre lang gebraucht hat, um die ganzen Lehrbücher anzupassen, und sich jetzt entscheidet, wir drehen das alles wieder zurück und wir wieder acht Jahre brauchen, um das Ganze wieder zurückzudrehen. Ich glaube, das ist auch was, was die Bevölkerung insgesamt extrem unzufrieden zurücklässt.
Insofern hätte ich persönlich mir durchaus vorstellen können, wir bleiben beim G8, aber fangen an das zu verbessern, was eben schlecht läuft. Denn es ist klar, dass die Lehrkräfte der einzelnen Fächer sagen: Bei uns ist sicherlich nichts zu streichen, weil das alles super wichtig ist.
Natürlich ist alles immer super wichtig. Aber ich glaube, wenn man das von außen aus betrachtet hätte, hätte man diskutieren können: Wo können wir es denn so verschlanken und so verändern, dass die Jugendlichen trotzdem gut auf den Lebensweg vorbereitet werden. Und dann habe ich in vielen Fällen gesehen, dass das auch gut geht, ohne dass jetzt Kinder und Jugendliche überlastet werden im Rahmen eines G8.
Insofern hätte ich persönlich mir vorstellen können, dass man besser versucht, das G8 zu verbessern. Aber wir sehen auch insgesamt, dass das G8 in der Bevölkerung wenig Rückhalt hat.
Ganztagsschule als Reformmodell
Pindur: Kommen wir zu einem anderen Reformmodell, der Ganztagsschule. Hat sich das in Ihren Augen bewährt? Es wird ja immer darauf hingewiesen, dass das besonders gut sei, um die Breite, die Masse der Schüler mitzubekommen, eben durch Hausaufgabenbetreuung und intensiveres Zusammenarbeiten am Nachmittag.
Wößmann: Ja, auch das ist so eine Sache, wo ich glaube, zum einen die Art, wie wir es eingeführt haben, gar nicht darauf hin arbeitet, und zum anderen, dass ich insgesamt keine Forschung kenne, die gezeigt hätte, dass der Ganztagsunterricht wirklich dazu geführt hätte, dass Schülerinnen und Schüler mehr lernen.

Ganztagsschulen sollten ihren Schülern und Schülerinnen auch ein Mittagessen anbieten © dpa / picture-alliance / Franziska Kraufmann
Nur in vier Prozent der Schulen in Deutschland, an denen Ganztag gemacht wird, ist das der sogenannte rhythmisierte Ganztag. Da versucht man, die Unterrichtszeit tatsächlich mehr über den ganzen Tag zu verteilen, auch in den Nachmittag rein und dafür morgens mal mehr Ausgleichsstunden hat.
Aber das macht kaum eine Schule, sondern Ganztag ist zum Großteil dann leider in der Realität so, dass sie eigentlich fast den gleichen Vormittagsunterricht machen wie im Halbtagsmodell, dann zusammen Mittagessen und dann so was wie eine Hausaufgabenbetreuung oder ähnliche Dinge haben, wo aber in den meisten Fällen zum Beispiel die Lehrkräfte schon gar nicht mehr da sind, sondern weniger geschultes pädagogisches Personal da ist, das die Betreuung macht.
Das Ganze wird natürlich nur funktionieren, wenn man es verzahnt und anders macht. Leider machen wir das nicht zur Genüge.
Pindur: Was können wir denn lernen, was wir anders machen können, aus den PISA-Studien?
Wößmann: Ja, wie ich angedeutet habe: Es geht viel darum zu sagen, wir legen klare Standards fest. Wir überprüfen auch, ob die erreicht werden.
Pindur Das ist ja relativ simpel.
Wößmann: Vieles ist simpel, genau, und kostet auch nicht mehr Geld. Man muss dann aber auch bereit sein, den Schulen mehr Autonomie, mehr Selbständigkeit zu lassen, die Dinge sozusagen dann zu finden. Das machen wir viel zu selten in unserem deutschen Schulsystem, weil vieles dann jeweils von den Kultusministerien gesteuert wird.
Ich glaube, insgesamt müssen wir da noch Schritte weiterkommen. Wir müssen dahin kommen zum Beispiel, dass auch deutschlandweit Leistungen vergleichbarer sind.
Privatschulen und staatliche Schulen
Pindur: Sie haben als Rezept sozusagen auch in den Raum gestellt, man möge doch bitte einfach mehr Schulen in privater Verantwortung zulassen. – Würde das aber nicht Ressourcen abziehen aus dem Bereich der staatlichen Schulen und somit dann unweigerlich auch wieder zu einer sozialen Segregation an Schulen führen?
Wößmann: Da kommt es extrem drauf an, wie man es dann macht. Natürlich ist die Idee, dass das Geld aus den staatlichen Schulen kommt oder dass es dann weniger staatliche Schulen gibt. Man könnte ja die staatlichen Schulen, einige, die es gibt, einfach nehmen und in eine andere Trägerschaft geben zum Beispiel. Da haben wir die gleichen Ressourcen. Die sollten auch genauso drin bleiben. Worum es geht in dem Bereich, ist, dass Eltern Alternativen haben und dann wählen können und dass sozusagen nicht alles ein und dieselben Schulträger sind.
Das Paradebeispiel dafür sind die Niederlande. In den Niederlanden gehen drei Viertel aller Schülerinnen und Schüler auf Privatschulen, auf Schulen, die in nichtstaatlicher Trägerschaft sind, von Kirchen und anderen sozialen Trägern. Aber diese Schulen, und das ist in der Verfassung festgeschrieben in den Niederlanden, sind alle identisch wie die staatlichen Schulen mit dem gleichen Schlüssel finanziert. Das heißt, man bekommt quasi pro Schüler soundso viel Geld.

In den Niederlanden gehen viele Kinder in Privatschulen © picture-alliance/ dpa / Lehtikuva / Jussi Nukari
Das Interessante ist: Wenn man es so macht, dann kann man es sogar auch noch so machen, dass man sagt: Okay, aber wenn es Schulen sind, die in Brennpunktzentren sind, so sehr viele benachteiligte Kinder sind, können wir sogar pro Kind noch mehr Geld hingeben. Was dadurch aber entsteht ist, dass die Eltern Wahlmöglichkeiten haben. Sie haben verschiedene Schulen vor Ort. Die bieten Verschiedenes an. Und ich kann jetzt sehen, was ich denke, was ist für mein Kind denn das Beste.
Und am Ende des Tages gibt es da auch die zentralen Abschlussprüfungen, die auch gucken, wie stark haben die einzelnen Schulen es geschafft, den Kindern den Stoff zu vermitteln. Und dann entsteht eben etwas auch zwischen Schulen, was funktioniert, dass nämlich die Schulwahl durch die Eltern dazu führt, dass es Wettbewerb gibt und oftmals auch so ist, dass die staatlichen Schulen auch sehen müssen: Wenn ich einen schlechten Job mache, dann entscheiden sich die Eltern für andere Schulen. Also muss ich was anders machen oder ich gehe unter. Und was wir natürlich sehen: E.s ist nahezu immer so, dass die Sachen anders und zwar besser machen.
Und dann ist das Spannende eben, dass in so einem System nicht nur die privat oder die nicht staatlich geleiteten Schulen besser werden, sondern eben auch die staatlich geleiteten Schulen viel besser, weil sie auf einmal Anreize haben, es besser zu machen. Interessanterweise deuten die Ergebnisse eher darauf hin, dass gerade benachteiligte Kinder eine Stimme kriegen, weil, wenn die Eltern sich entscheiden, dass ihr Kind jetzt auf eine andere Schule geht, dann wandert das Geld eben mit da hin, dass das gerade diesen Kindern besonders mehr Beachtung schenkt und die gerade besser werden.
Die Kulturhoheit der Länder
Pindur: Herr Wößmann, wir haben das eben schon kurz gestreift. Ist die Kulturhoheit der Länder noch zeitgemäß? Oder ist das eben genau das, was Sie ja fordern, ein zeitgemäßer Wettbewerb auch?
Wößmann: Man kann da verschiedener Meinungen zu haben. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht mehr ganz zeitgemäß, dass wir 16 separate einzelne Schulsysteme haben. Wir leben in einer zunehmend globalisierten Welt. Es ist manchmal leichter, ins europäische Ausland umzuziehen als Eltern mit Kindern in der Schule, als in ein anderes Bundesland. Das dürfte eigentlich nicht mehr so sein. Aber andersrum gedreht ist es natürlich einfach Verfassungsrealität. Das ist bei uns im Grundgesetz festgeschrieben, dass die Länder die Kultushoheit haben und damit vor allem für die Schulen zuständig sind. Da werden wir auch nichts dran geändert kriegen in der nahen Frist. Insofern, glaube ich, müssen wir auch damit leben.
Und ich glaube, man kann da auch gut mit leben. Das Entscheidende daran ist eben, dass wir tatsächlich so was wie einen föderalen Wettbewerb gekommen müssen. Nur, damit Wettbewerb funktioniert, braucht man auch einen Vergleichsmaßstab. Sonst weiß man ja gar nicht, wer macht es denn gut und wer macht es nicht gut. Genau das ist es, was wir im Bildungsbereich eben zumeist nicht haben und viel mehr bräuchten.
Wenn wir das bekommen, dann können wir…
Pindur: Das wären dann bundesweite Standards sozusagen, die erfüllt werden müssten.
Wößmann: Genau. Wir haben nach und nach über die 2000er Jahre in verschiedenen Bereichen bundeseinheitliche Bildungsstandards eingeführt. Die gelten eigentlich in ganz Deutschland. Das heißt, man hat sich, die Bundesländer haben sich drauf geeinigt: Was an Kompetenzen müssen eigentlich die Schüler in verschiedenen Fächern erlernen?
Was wir eben nicht haben, sind einheitliche Prüfungen, die das testen. Wir haben so Stichprobenprüfungen hin und wieder, allerdings de facto auch nur alle sechs Jahre, wo dann rauskommt, dass das schon sehr unterschiedlich ist, was Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Bundesländern können. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt im Abiturbereich bleiben, ist das natürlich so, dass jedes Bundesland sein eigenes Zentralabitur hat. Und ich glaube, wir müssten zumindest dahin kommen, dass ein Kern des Abiturs deutschlandweit einheitlich ist.
Wir haben vom Aktionsrat Bildung mal einen Reformvorschlag gemacht. Das haben wir genannt: "gemeinsames Kernabitur". Da wäre es so: Ins Abitur gehen ja zunächst mal die Noten der letzten beiden Schuljahre ein. Das wäre auch weiter so. Und dann gibt’s eben den Bestandteil, der durch die Abiturprüfungen bestimmt wird, und auch nur ein Teil dieser Abiturprüfung. Aber eben zumindest in diesen Kernfächern Deutsch, Mathe, Englisch sollte ein gewisser Teil der Prüfung am selben Tag mit den identischen Aufgaben in ganz Deutschland geschrieben werden. Das wäre sicherlich in der Praxis möglich und würde dazu führen, dass wir mehr Vergleichbarkeit haben.
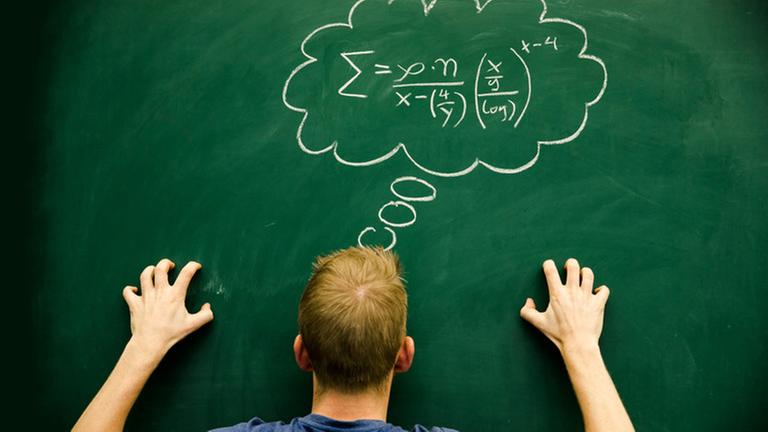
Matheunterricht ist für viele Kinder und Jugendliche in der Schule eine besondere Hürde © Lucas1989 | photocase.de
Das ist dann noch nicht perfekt. Dann kann auch jedes Bundesland auch noch sagen, wir haben hier andere Schwerpunkte. Und die anderen Bundesländer sagen, wir haben dort andere Schwerpunkte. Aber zumindest bei diesen Kernkompetenzen, die so wichtig sind eigentlich für das weitere Leben der Jugendlichen, würden wir da hinkommen, dass wir da wirklich eine Einheitlichkeit und mehr Vergleichbarkeit hätten.
Und wir haben im letzten Jahr zum ersten mal gehabt, dass in nahezu allen Bundesländern tatsächlich am selben Tag die Mathematikprüfungen geschrieben wurden im Abitur - wovon Kultusminister vor zehn Jahren gesagt haben, das ist völlig undenkbar, dass wir am selben Tag in ganz Deutschland Abitur schreiben würden. Es ist kein Problem. Man hat es jetzt gemacht.
Ich hoffe, man hat jetzt viele Erfahrungen gemacht, dass das alles geht. Man muss jetzt aber auch bereit sein, diesen Schritt weiterzukommen. Wenn wir in dem bleiben, wo wir jetzt sind, dann haben wir immer noch nicht Vergleichbarkeit.
Man kann zum Beispiel jetzt mal drüber sprechen. Wir hatten Anfang des Jahres das Urteil vom Bundesverfassungsgericht über den Numerus Clausus in den medizinischen Fächern. Was de facto so ausgelegt wurde, ist, dass solange die Abiturprüfungen so wenig vergleichbar sind zwischen den Bundesländern, die Unis das nicht heranziehen dürfen, um den Zugang vergleichbar zu machen. Aber das ist derzeit eigentlich das, was sie juristisch einzig machen können.
Das heißt, wir werden entweder da hinkommen, dass das ganze System zerbricht und man vielleicht einheitliche Medizinertests, spezifische Tests machen würde. Oder aber wir müssen da hinkommen, dass es wirklich mehr Vergleichbarkeit gibt. Das werden wir aber nur schaffen, wenn wir sagen, wir machen in den Kernfächern einheitliche Prüfungen. Und ich glaube, das wäre kein Problem. Es hätte aber genau diesen Effekt, dass wir insgesamt die Anreize haben, es gut zu machen.
Auch wirtschaftlich "keine Weltklasse"
Pindur: Sie haben ja in Ihren Forschungen auch belegt, wie wichtig die Korrelation ist zwischen den naturwissenschaftlichen, mathematischen, IT- und Technikkenntnissen und dem Zustand und dem Erfolg einer Volkswirtschaft. Jetzt schaue ich mir aber das mal an und sage: Wenn Bildung so wichtig ist für den Wohlstand einer Gesellschaft, dann müsste das deutsche Bildungssystem ja eigentlich immer noch erstklassig sein aufgrund unseres wirtschaftlichen Erfolges, der das ja zu belegen scheint.
Tatsächlich setzt uns PISA aber im Mittelfeld an. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
Wößmann: Zwei Sachen dazu: Das Erste ist, wir sind ja auch nicht wirtschaftlich Weltklasse. Wenn Sie sich mal das Bruttosozialprodukt pro Kopf angucken, liegt Deutschland etwa auf Platz zwanzig. Wir müssen uns nicht vormachen, dass wir das reichste Land der Welt sind. Das sind wir nicht annähernd. Aber viel wichtiger ist tatsächlich, dass natürlich vieles andere auch wirtschaftlichen Erfolg ausmacht – institutionelle Rahmenbedingungen in der Wirtschaft, vieles mehr –, wir aber insgesamt fragen müssen: Wie ist es langfristig? Inwiefern sozusagen wirken sich da möglicherweise Schülerleistungen aus oder nicht?
Kurzfristig können die sich sowieso nicht auswirken. Wenn Sie jetzt Ihr Schulsystem verbessern, dann wird die Wirtschaft für diese Wahlperiode oder für die nächsten vier Jahre kein bisschen sich ändern, weil diese Kinder und Jugendlichen noch überhaupt nicht am Arbeitsmarkt sind. Daran wird sich erst Stück für Stück, Jahrgang für Jahrgang etwas ändern. Ein Jahrgang wird in Rente gehen, ein neuer, jüngerer, besser ausgebildeter Jahrgang reinkommen. Das heißt, Sie brauchen locker vierzig Jahre, wenn nicht länger, bis sich solche Reformen komplett wirtschaftlich auswirken.
Also, wenn Sie kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg haben wollen, ist Bildungspolitik sicherlich nicht der richtige Ansatzpunkt. Aber wenn Sie bereits sind, langfristig zu schauen, dann ist es eben spannend. Dann schauen Sie sich mal an, wie haben sich über vierzig oder fünfzig Jahre die durchschnittlichen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf in verschiedenen Ländern der Welt entwickelt. Dann können Sie mit einem ganz simplen Modell, was nur das Ausgangsniveau des Bruttoinlandsprodukts und diese Testleistungen reinnimmt, nahezu achtzig Prozent der Variationen zwischen den Ländern erklären. Mit einem Modell, wo Sie zum Beispiel statt der Testleistungen nur die Schuljahre reinnehmen, erklären Sie nur ein Viertel.
Soll heißen: Es geht eben nicht darum, wie lange Leute im Schulsystem sind, sondern was sie wirklich gelernt haben. Aber dann, und dann nutzen vielleicht quasi die PISA-Vorgängertests, um so ein Maß der Kompetenzen – Mathematik, Naturwissenschaften – zu haben. Dann hat das extrem starke Vorhersagekraft für das Wirtschaftswachstum.
Die Bildung und das Wirtschaftswachstum
Pindur: Nennen Sie mal ein Beispiel im internationalen Vergleich.
Wößmann: Am schönsten ist eigentlich, wenn man so richtig das große Bild nimmt, wenn man sich vorstellt, wir stehen 1960 da und sollen vorhersagen, welche Weltregionen werden sich denn jetzt schnell entwickeln und welche nicht. Es ist so, dass eben die Menschen in Ostasien heute etwa neunmal so wohlhabend sind wie ihre Großeltern vor zwei Generationen, die in Lateinamerika nur etwa zweieinhalbmal. Das heißt also, es hat einen Riesenunterschied in der wirtschaftlichen Entwicklung gegeben. Wenn Sie das hätten vorhersagen sollen 1960, da wäre niemand drauf gekommen, weil in vielen der Indikatoren, auch der durchschnittlichen Bildungsjahre der Bevölkerung Lateinamerika viel besser dastand als Ostasien.
Es gibt sehr viel Forschung und Ideen dazu, was das denn erklären könnte. Und nichts davon ist empirisch sehr haltbar. Aber wenn wir einfach nur mit reinziehen, wie die Menschen in diesen Ländern in diesen Bildungstests damals abgeschnitten haben, dann erklärt das nahezu den kompletten Unterschied zwischen Ostasien und Lateinamerika in dem Sinne, dass die Schülerinnen und Schüler eben viel höhere Kompetenzen erworben haben, viel mehr gelernt haben. Und wir sehen das im Vergleich der Weltregionen. Wir sehen das im Vergleich der einzelnen Länder innerhalb von Kontinenten. Wir sehen das auch im Vergleich nur zwischen den entwickelten Ländern.
Wenn Sie zwischen den OECD-Ländern verstehen wollen, warum sind einige in diesen vierzig, fünfzig Jahren schnell gewachsen, andere langsam. Sie haben jeweils diese sehr enge Beziehung zwischen den Kompetenzen der Bevölkerung und dem langfristigen Wirtschaftswachstum.
Pindur: Bildung sollte nicht nur ein Wohlstandsvehikel sein. Es sollte auch ein Werkzeug sein, um den Menschen aus der "selbst verschuldeten Unmündigkeit" zu führen, also, die Emanzipation des Einzelnen zu befördern. – Sind Sie angesichts von Brexit, von Trumpismus, von Le Pen, von AfD, von FPÖ und was es auch immer noch für Phänomene gibt der populistischen Art, sind Sie als Bildungsforscher immer noch zuversichtlich, dass Bildung uns zu einer emanzipierteren Gesellschaft und zu emanzipierteren Individuen führen kann?
Wößmann: Ich bin da schon optimistisch. Natürlich ist das nicht per se gegeben. Und natürlich kann es jederzeit so sein, dass sich Menschen verführen lassen, dass viel Unsinn bei rauskommt. Aber ich glaube, die einzige Chance, da langfristig besser rauszukommen, ist einfach nur sicherzustellen, dass möglichst viele Menschen eine möglichst gute Bildung bekommen und dementsprechend hinterfragen können, weiterdenken können. Ich glaube, da haben auch gerade wir als Wissenschaften eine ganz große Verantwortung, das eben hochzuhalten und zu sagen: Nein, Fake News sind Fake News! Und es gibt bestimmte Wahrheiten, die wir belegen können. Und wenn das falsch ist, dann müssen wir dagegen anreden.
Und am Ende des Tages, glaube ich, sind solche wissenschaftlich fundierten Antworten die besseren Antworten. Das wird sich langfristig hoffentlich auch durchsetzen und wird auch für den Einzelnen der beste Weg sein, seinen eigenen Wohlstand, aber auch seine Partizipation, seine Selbstbestimmung durchsetzen zu können.
Dass wir da immer mal wieder enttäuscht werden, ich glaube, das müssen wir uns auch als gebildeter Bürger bewusst machen, dass wir damit leben können müssen. Aber ich glaube, die Alternative, wenn wir eben ein sehr schlechtes Bildungssystem hätten, wäre noch deutlich schlimmer.





