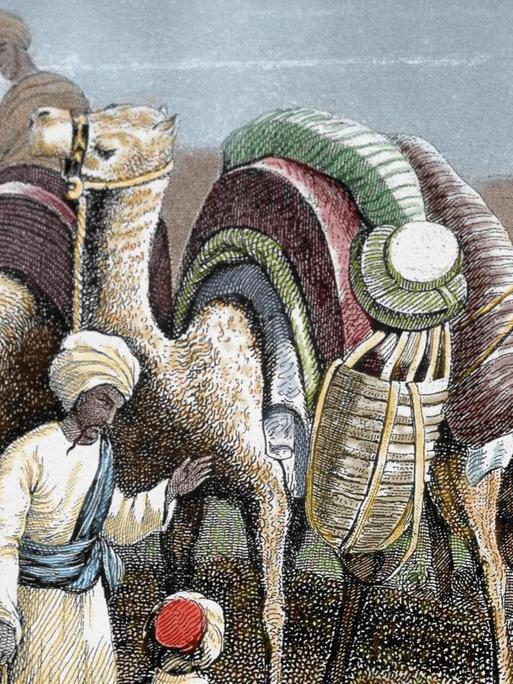Start-up in der Oberlausitz

Seidenproduktion in einer ehemaligen Stallanlage: Die Seidenspinnerraupen ernähren sich von Maulbeerblättern. © Iris Milde
Seide aus sächsischer Produktion
10:01 Minuten

Bis heute ist China der größte Exporteur von Seide. Aber auch in Deutschland wurde der Stoff hergestellt. Ein kleines Start-up in Ostsachsen will daran anknüpfen. Um Kleidung geht es aber nicht.
Udo Krause steht neben einem raumhohen Container aus Stoff. Drinnen tummeln sich in zwei Plastikkisten Tausende graue, etwa zwei Zentimeter lange Larven. Es sind die Larven des Seidenspinners.
Udo Krause ist Biologe. „Ich habe lange Zeit in der Forschung gearbeitet“, sagt er. Schon als Kind habe er sich der Schmetterlingszucht zugewandt. „Ich arbeite jetzt noch als Innovationsmanager und auch freiberuflich in der Beratung für grüne Technologien für die Landwirtschaft oder für die Industrie.“
Udo Krause will die Seidenraupenzucht und die Seidenproduktion wieder nach Deutschland bringen. Gegenwärtig wird der Großteil der Rohseide hierzulande aus Asien importiert. Vor allem aus China, dem Ursprungsland der Seide.
Seide begleite die Menschen seit 5000 Jahren, erzählt der Insektenzüchter. Sie habe auch wirtschaftlich und kulturell eine riesige Bedeutung erlangt. „Es war erst der Stoff der Kaiserinnen und Kaiser und Könige, die Seidenstraße kennt auch jeder.“
Wenn man einen Seidenkokon abwickelt, erhält man Faden, der etwa einen Kilometer lang, sehr stabil und gleichzeitig elastisch ist. „Die ersten OPs vor 2000 Jahren in Ägypten wurden auch mit Seide gemacht“, sagt Krause.
"Die ersten sächsischen Kokons"
Erst ab dem 18. Jahrhundert gab es auch in Deutschland eine nennenswerte Seidenindustrie. Während des Zweiten Weltkriegs diente Seide vor allem als Ausgangsmaterial für Fallschirme. Kleingärtner waren aufgefordert, selbst Seidenraupen zu züchten und Maulbeerbäume für Futter zu pflanzen.
Seit den 1950er-Jahren wird in Deutschland keine Seide mehr produziert. Das soll sich mit der 2020 gegründeten „Seidenkokon Native Silk GmbH“ ändern. Im ostsächsischen Nebelschütz hat Udo Krause sich in eine ehemalige Stallanlage eingemietet. Lange Hallen, in denen er Anzuchttische aufstellen will.
„Auf so einen Tisch passen dann 10.000 Raupen vielleicht. Und am Ende kommt dann so ein Gestell drüber, wo die dann sich drinnen verpuppen.“ Aus 10.000 Raupen können etwa 3,5 Kilogramm Rohseide gewonnen werden. Udo Krause öffnet ein schwarzes Schächtelchen, in dem eine Handvoll Kokons liegen: wachteleigroße, weiße, wollige Knöllchen. „Das sind die ersten sächsischen Kokons.“
Wundheilung 14 Tage schneller
Landläufig wird unter Seide Stoff verstanden, der sich angenehm leicht auf der Haut anfühlt, kühlt und wärmt gleichzeitig und etwa 30 Prozent seines Eigengewichts an Wasser aufnehmen kann, ohne dass er sich nass anfühlt.
Udo Krause hingegen möchte in erster Linie medizinische Seide herstellen. „Es gibt Wundauflagen aus Seide und man weiß, dass die Wundheilung etwa 14 Tage schneller passiert, weil das einwachsen kann. Die Seide nimmt sich nach anderthalb Jahren dann aus dem Gewebe raus und man sieht also keine Spuren mehr.“
Seide wird im Körper abgebaut
Auch als Nahtmaterial für Operationen könnte Naturseide wieder Verwendung finden. Thomas Flietner, Facharzt für Chirurgie und Facharzt für Plastische und ästhetische Chirurgie in Hannover, kann sich noch gut erinnern, wie er in den 80er-Jahren mit Naturseide operiert hat. Um die Jahrtausendwende sei diese von synthetischen Materialien abgelöst worden.
„Das synthetische Material, das wir verwenden, das müssen Sie sich wie so einen glatten Plastikstrang vorstellen – also, der saugt nichts auf.“ Entscheidend sei, wie auf dem glatten Faden ein Knoten hält und wie er sich auflöst.
„Naturseide ist vom Handling her sehr schön. Und das Interessante ist, das Seide sich auch resorbiert.“ Das heißt, sie wird langsam im Körper abgebaut. Je nach gewünschtem Effekt könne das eine oder das andere Material medizinisch sinnvoll sein.
Thomas Flietner sitzt im Beirat der „Seidenkokon Native Silk GmbH“. Er befürwortet das Projekt auch, weil man so unabhängig von Zulieferern aus dem Ausland werden könnte. „Es gibt bislang kein chirurgisches Nahtmaterial, das komplett von der Rohstoffherstellung bis letztendlich Produktion, Verarbeitung und Herstellung des fertigen Nahtmaterials in Deutschland hergestellt wird. Das wäre dann das erste.“

Udo Krause hat in Nebelschütz Maulbeerbäumchen gepflanzt. Sie wachsen in Bioqualität und die Blätter werden an die Raupen verfüttert. So soll ausgeschlossen werden, dass die Seide über das Futter der Seidenraupen verunreinigt wird. © Iris Milde
Doch an Medizinprodukte werden hierzulande hohe Anforderungen gestellt. Auch Naturmaterialien müssen hundertprozentig steril sein und dürfen keinen Qualitätsschwankungen unterliegen, was dazu führt, dass gegenwärtig kein Produkt aus Naturseide in Deutschland zugelassen sei, so Udo Krause.
Raupen unter sterilen Bedingungen aufziehen
Er hat in der Gemeinde Nebelschütz landwirtschaftliche Fläche gepachtet und darauf Maulbeerbäumchen gepflanzt, die dort in Bioqualität wachsen, um Verunreinigungen über das Futter der Seidenraupen auszuschließen. Die Raupen sollen unter „möglichst sterilen Bedingungen“ aufgezogen werden, nicht in einer Massenzucht.
„Der nächste Schritt ist, dass wir, wenn wir die Seide hier ernten, ein patentiertes Verfahren verwenden werden.“ Das Patent sei angemeldet. „Dieses Verfahren erlaubt es uns, die Seide so zu reinigen, dass sie dann für die Medizintechnik zugelassen werden kann.“
Udo Krause führt in einen Nebenraum der Raupenzuchtanlage. Dort hat er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner, einem Ingenieur, eine kleine Anlage aufgebaut, mit einer Waschkammer in der Mitte und zwei Garnspulen. Beim Verpuppen verklebt die Seidenraupe den Faden mit einem natürlichen Leim: Sericin.
„In Deutschland beispielsweise ist man da sehr restriktiv und sagt: Wenn ich Seide zulasse für die Medizin, muss dieses Eiweiß, was da auf dem Faden sitzt, komplett runtergewaschen werden.“ Das sei eine Herausforderung.
Im Alter noch ganz zarte Hände
Udo Krause ist optimistisch, dass er und sein Partner diese Vorgaben mit der neuen Technologie erfüllen können. Doch nicht nur aus der Medizin-, auch aus der Kosmetikbranche erreichen die beiden Tüftler derzeit viele Anfragen.
„Es ist gegenwärtig so, dass das Seidenprotein tatsächlich eine Renaissance bekommt. Die Frauen, die damit in Asien den ganzen Tag hantieren, da hat man sich gewundert, warum die im hohen Alter noch so zarte Hände haben. Sericin bindet beispielsweise dreimal mehr Wasser als Glycerin, was sonst in Kosmetik vorhanden ist, um das Wasser zu halten.“
Das ausgewaschene Sericin wäre ein Nebenprodukt. Genauso wie der Kot der Raupen, der als Dünger wiederverwendet werden soll. Die abgetöteten Puppen können als Futter in einer benachbarten Garnelenzucht eingesetzt werden.
„Wenn wir den ganzen Faden abwickeln wollen, den einen Kilometer, da wird die Puppe, die dann in dem Kokon sich befindet, wird abgetötet. Für die OP-Fäden, ist, glaube ich, jedem klar, keiner will einen Knoten im OP-Faden haben, brauchen wir die Länge.“
Doch etwa für Wundauflagen versuchten sie, aus der Seide ein Vlies herzustellen. Das heißt, die Schmetterlinge können dann schlüpfen. Allerdings: „Diese Schmetterlinge wurden gezüchtet auf Seide“, erklärt Udo Krause. „Die können also nicht mehr fliegen. Wenn die schlüpfen, paaren sie sich noch und sterben nach drei Tagen.“
Schöne Produkte jenseits des Medizinischen
Die Seidenmanufaktur Eschke im westsächsischen Crimitschau hofft, bald Seide aus Nebelschütz beziehen zu können. Bisher bezieht die Weberei, die sich auf die Rekonstruktion historischer Seidenstoffe konzentriert, etwa für Schlösser, Seide ausschließlich aus dem Ausland.
„Wir als Edelflächenbildner kümmern uns darum, dass wir sagen: Alles, was nicht in das Medizinische reingeht, werden wir dann zu schönen Produkten verarbeiten“, sagt Torsten Bäz mit Blick auf die geplante Seidenproduktion in Nebelschütz. Er und seine Frau sind als Gesellschafter des Unternehmens „Seidenkokon“ von Anfang an dabei.
Es gebe in der Region zwei Landwirtschaftsbetriebe, die eine Seidenproduktion aufbauen wollten. „Wenn man eine Riesenfarm hat, ist man angreifbar, auch durch Insekten. Hat man dezentrale Stellen, ist an nicht so angreifbar.“
Seidenraupen in Schulen
Zwei Wochen nach dem Schlüpfen kann ein Teil von Udo Krauses Raupen an die beiden Landwirte abgegeben werden.
Udo Krause möchte viele Menschen in der Region mit seiner Faszination für die Insekten anstecken: Zuchtmaterial entwickeln für die Schulen oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung, damit die sich mit der Seidenraupe beschäftigen können.
„Man hat einen Monat Zeitraum vom Ei bis zum Kokon, man kann den Schmetterling begleiten, der Schmetterling kann schlüpfen.“ Und mit dem Kokon könne man auch noch etwas Schönes machen: etwas basteln, bauen oder Schmuck gestalten.