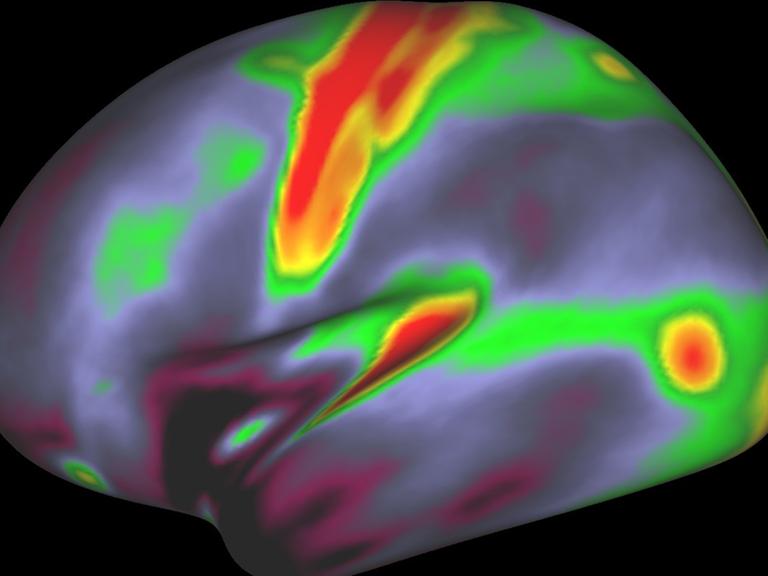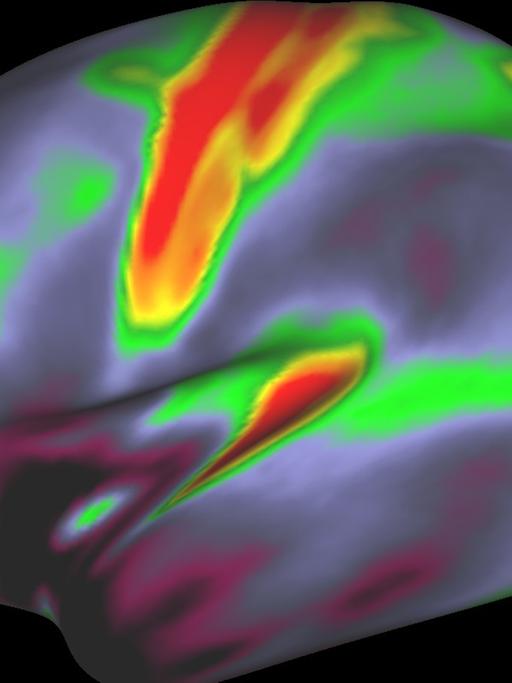Aleida Assmann: Formen des Vergessens
Wallstein Verlag, 2016
224 Seiten, 14 Euro
Vom Vergessen, Sterben und Neu-Denken

Etwas vergessen ist schlimm. Gar nichts mehr vergessen können noch schlimmer. Formen des Vergessens: ein Schwerpunkt bei "Sein und Streit". Außerdem: Wann ist man tot? Und: Muss man schwarze Haut haben, um schwarz zu sein?
Eine US-Amerikanerin wurde vor ein paar Jahren weltberühmt für etwas, das sie nicht kann. Jill Price kann nichts vergessen, was sie einmal erlebt hat. Keinen einzigen Tag. Sie erinnert sich lückenlos, auch an alle Gefühle, die sie jederzeit erneut durchleben kann. Weil sie an einer seltenen kognitiven Störung leidet, die sich für sie so anfühlt, als säße ihr immer eine Kamera auf der Schulter.
Vergessen ist eine ziemlich ambivalente Angelegenheit. Die meisten von uns ärgern sich, wenn sie im Alltag ihren Regenschirm irgendwo liegenlassen. Aber gar nichts vergessen ist auch keine Lösung.
Warum wir vergessen müssen, darüber sprechen wir in "Sein und Streit" mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann. Ihr Buch "Formen des Vergessens" ist gerade im Wallstein Verlag erschienen.
Außerdem in der Sendung:
Kleine Leute, große Fragen
Unsere kleinen Philosophen beschäftigt diese Woche die Frage: Wie wäre es, eine andere Hautfarbe zu haben?
Philosophischer Wochenkommentar
Sterben müssen wir alle, so viel ist klar. Die Frage ist, wann wir aus dem Leben gehen.
Eine junge Britin wollte den Tod nicht einfach hinnehmen. Schließlich war sie gerade mal 14 Jahre alt, hatte das Leben noch vor sich, als sie unheilbar erkrankte. Unheilbar zumindest nach dem heutigen Stand der Medizin. Vielleicht sieht das ja in Zukunft anders aus! Die Jugendliche aus London hat sich deshalb vor Gericht das Recht erstritten, direkt nach ihrem klinischen Tod eingefroren zu werden.
Kryonik, so nennt sich die Wissenschaft, die sich mit diesem Auf-Eis-Legen des Körpers beschäftigt. Über die philosophischen Fragen, die sich damit verknüpfen, denkt der Philosoph Philipp Hübl nach im philosophischen Wochenkommentar.
Négritude – ein Konzept aus der Kolonialzeit in der postkolonialen Gegenwart
Das Konzept der "Négritude" stammt aus den 1930er-Jahren. Es war beeinflusst von der Harlem Renaissance in den USA, wurde aber in Paris erdacht: Als künstlerisch-kulturelles Konzept der Selbstbehauptung der Schwarzen gegen den Anspruch der Kolonialmacht Frankreich, dass die Afrikaner sich "französisieren" sollten.
Der senegalesische Philosoph Suleymane Bachir Diagne ist derzeit einer der wichtigsten Denker, die sich mit dem Verhältnis von schwarzen und nicht-schwarzen Identitäten beschäftigen. Er plädiert dafür, das Konzept der Négritude und der Identität neu zu denken: Man müsse keine schwarze Haut haben, um schwarz zu sein.
Dirk Fuhrig hat Suleymane Bachir Diagne getroffen.
Unsere Drei Fragen gehen diesmal an den Pianisten Pierre-Laurent Aimard.