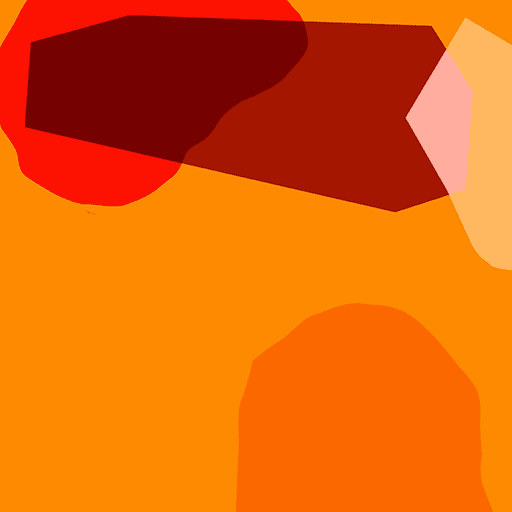Von der Bekenntniswut der Autoren

Das eigene Leiden auszustellen ist keineswegs neu. Der Schmerz als Versicherung der eigenen Existenz ist Teil der abendländischen Tradition in Literatur und Kunst. In jüngerer Zeit fällt jedoch auf, wie sehr der Bekenntnismut umschlägt in regelrechte Bekenntniswut.
"Und gewiß ist: ja, die einzige Gewißheit ist: es tut weh, also bin ich. Es blutet, also bin ich. Ich blute, also bin ich." In diesem Bekenntnis zum Schmerz als Beweismittel der eigenen Existenz gipfelt die Dankesrede, die Arnold Stadler 1999 für den Büchner-Preis hielt. Stadler hat im Vatikan Theologie studiert, ist jedoch Schriftsteller und nicht Priester geworden. Er überträgt die pathetische Auferstehungsgeste von Christus in die Welt der Fiktion. Seht meine Wunden, ich lebe.
Das eigene Leiden auszustellen, gehört zur Tradition der abendländischen Literatur, von Augustinus über Rousseau bis hin zu Michel Leiris oder Josef Winkler. In jüngster Zeit jedoch übersteigt und verkrampft sich der Bekenntnismut von Autoren zu einer Bekenntniswut. Christoph Schlingensief etwa inszeniert sein Leiden live. Er vermarktet sein Sterben direkt. Er verrührt sein Blut mit Kuchen. "Das kann Jesus euch nicht bieten."
Ruthard Stäblein ist dem Phänomen in seinem Feature "Zeig her deine Wunden. Der Autor als Bekenner und Märtyrer " auf der Spur.