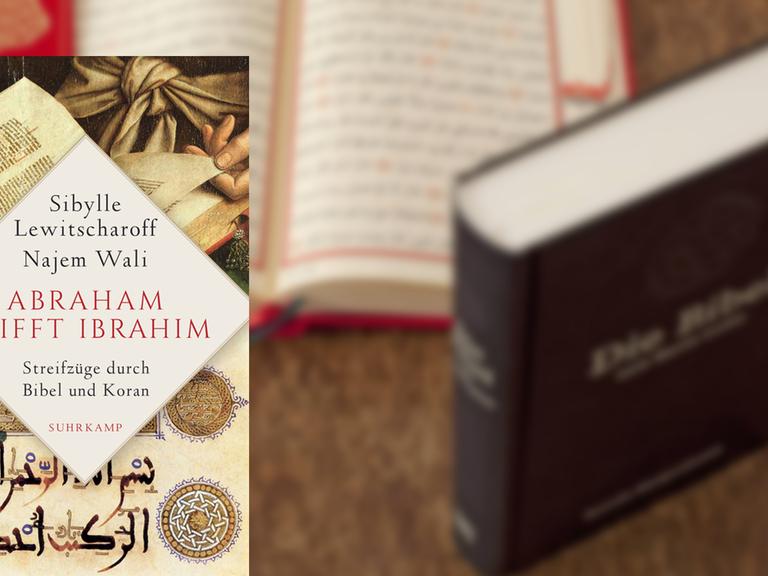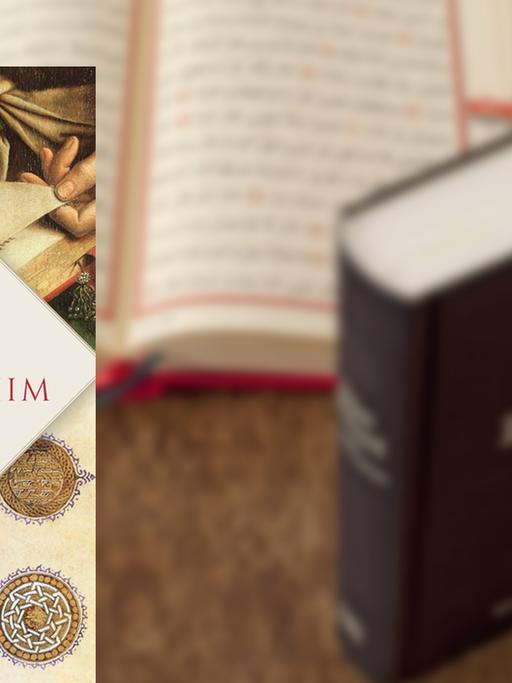Sibylle Lewitscharoff: "Von oben"
Suhrkamp Verlag, Berlin 2019
230 Seiten, 24 Euro
Pointierter Fabulier- und Beobachtungsrausch
06:31 Minuten

Das heutige Berlin steht in Sybille Lewitscharoffs Roman "Von oben" im Focus. Der Ich-Erzähler scheint sich zwischen Himmel und Erde zu bewegen und vor kurzem gestorben zu sein. Lewitscharoff gelingt ein humorvoller, pointierter Blick auf unser Leben.
Dies ist ein anarchisches, exzentrisches, ein verzweifeltes, aber auch hochkomisches Buch. Und das fängt schon bei der Frage an, in welchem Aggregatzustand sich der Ich-Erzähler eigentlich befindet.
Denn der Anfang ist spektakulär. Der hier spricht, scheint sich irgendwo zwischen Himmel und Erde zu bewegen, er scheint vor kurzem gestorben zu sein. Die Reste seines Körpers liegen offenkundig unten in einem Sarg. Aber es gibt etwas, das weiter existiert, und die Wortverknüpfungen mit dem Begriff der "Seele" spielen deshalb eine große Rolle.
Letzte Fragen werden behandelt
Es liegt natürlich nahe, dass dabei auch theologische, existenzielle Fragen behandelt werden, letzte Fragen also. Aber das Entscheidende ist, wie das geschieht. Im Vordergrund steht eindeutig die Wortlust der Autorin, ihr Fabulier- und Beobachtungsrausch, und was zunächst wie eine religiös fundierte Versuchsanordnung anmutet, stellt sich bald als eine literarisch tiefschürfende Gegenwartsanalyse heraus.
Es sind sehr poetische, aber dabei auch ironisch gebrochene Formulierungen, mit denen das hier sprechende Ich versucht, seine augenblickliche Existenz zu fassen: Es ist eine "flottierende Wesenheit mit unklaren Konturen", in dem das vergangene Leben auf nicht recht greifbare Weise weiterwirkt und das "von oben" auf die früheren Freunde schauen kann, was sie gerade so treiben. Und das die Stadt Berlin im Blick hat, in der der Ich-Erzähler als Philosophieprofessor an der Freien Universität arbeitete.
Die Neugier reicht nur für kurze Beobachtungsintervalle
Die Neugier dieses diffusen Seelenwesens reicht nur "für kurze Beobachtungsintervalle", deswegen besteht dieser Roman aus kurzen, skizzenhaften, wie hingehauchten oder mitunter auch kräftig ausgepinselten Kapiteln. Meistens geschehen diese Beobachtungsflüge nachts, und sie brechen immer ab, wenn die Energie erschöpft ist, dann hört das Kapitel auf und das Ich kehrt "zurück ins Ungefähr".
Die kurzen Beobachtungsintervalle: Das war schon immer die große Stärke der Romanautorin Sibylle Lewitscharoff. Da ist sie in bester Form, und so ergibt es sich sehr schnell, dass das Ganze vor allem auch eine literarische Feldstudie ist, ein hochriskantes Abenteuer, das dem nachhorcht, was Literatur vermag und wozu sie eigentlich da ist – nämlich Zwischenräume und Grenzgebiete auszuloten, wo sonst nichts hinreicht.
Kafkas "Jäger Gracchus" als Vorbild
Nicht von ungefähr erscheint Kafkas "Jäger Gracchus" als Vorbild für die Schwebe- und Existenzbewegungen der Lewitscharoffschen Ich-Figur. Aber mindestens genauso frappierend sind Milieu- und Charakterstudien aus dem heutigen Berlin, in der typisch kraftvoll-strotzenden und originellen Sprache dieser Autorin: Bekannte Straßenzüge und Kneipen tauchen auf, und man erkennt, wenn man will, Personen aus dem kulturellen und universitären Milieu wieder.
Das ist zum Teil satirisch hinreißend, zu einem anderen Teil auch nachdenklich und fragend. Der abgründige Humor dieser Prosastücke ist einzigartig: nie pathetisch oder schwülstig, selbst wenn es um christliche Kabbalisten und Jesusbilder geht, aber immer scharf und pointiert.