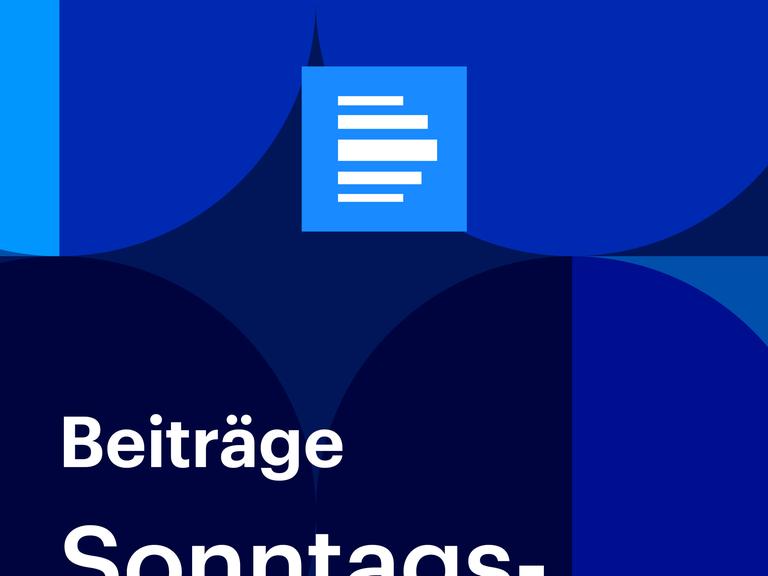Boliviens legendäre Schatzkammer

Der „Cerro Rico“, übersetzt der „Reiche Berg“, erhebt sich bis auf 4800 Meter Höhe im bolivianischen Niemandsland. Zinn, Blei, Kupfer, vor allem Silber haben viele Menschen seit Jahrhunderten reich gemacht – aber zu welchem Preis?
Eintritt in die Dunkelheit des „Cerro Rico“. Ein Einstieg in den bolivianischen Berg, der über Jahrhunderte das spanische Kolonialreich finanzierte, der unzählige Menschen verschluckt hat, der das Schicksal eines ganzen Landstriches bis heute bestimmt.
Schon wenige Meter nach dem Eingang des Stollens wird es stockdunkel. Die Grubenlampe am Helm wirft nur ein schwaches Licht in die finsteren Gänge. Das Wasser im Schacht steht knöcheltief, es wird wärmer je tiefer man in den Berg vordringt. Die Enge bedrückt. Ein mulmiges Gefühl kommt auf. Beto weiß noch genau, wie es ihm erging, als er mit 10 Jahren zum ersten Mal in den „Cerro Rico“ musste.
„Als ich die ersten Male hier richtig arbeiten musste, dachte ich mir: Oh Gott, ich will das nicht, ich kann das nicht. Das ist Knochenarbeit. Dazu die Dunkelheit. Aber mit der Zeit hat sich der Körper daran gewöhnt, die Schufterei hat ihn abgehärtet. Und jeder Kumpel hier ist stolz auf seinen Job. Dank unserer Arbeit, dieser Plackerei im Berg, bringen wir Bolivien und Potosí ein wenig voran.“
Zinn, Blei, Kupfer und Silber trotzen die Kumpel dem Berg ab
Beto ist 27 Jahre alt. Eigentlich heißt er Luis Alberto Montes, aber alle rufen ihn nur mit seinem Kosenamen. Der „Cerro Rico“, übersetzt der „Reiche Berg“, ist die legendäre Silberschatzkammer der spanischen Kolonialherren im Altiplano, dem bolivianischen Hochland. Bis auf 4800 Meter Höhe erhebt sich der kahle, sandfarbene Berg, thront über Potosí, der Stadt, die eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat. Zinn, Blei, Kupfer, vor allem aber Silber trotzen die Kumpel dem Berg ab, seit fast 500 Jahren, bis heute. Beto ist mit dem „Cerro Rico“ aufgewachsen, er kennt die stockfinsteren Stollen des Berges von Kindesbeinen an.
„Mit 11 Jahren, eher schon mit 10, ging ich in die Miene, half dort gelegentlich meinem Vater. Mit 12 Jahren sagte er mir: Du musst mich ab jetzt immer unterstützen. Sicher ist es manchen Vätern nicht unbedingt recht, wenn ihre Kinder so früh zu Bergarbeitern werden, aber die finanzielle Lage lässt einem oft keine andere Wahl. Ich musste von klein auf meinem Vater helfen, so wie dieser meinem Großvater geholfen hatte.“
Die Silbermine von Potosí in Bolivien begründete im 16. und 17. Jahrhundert den Reichtum der spanischen Krone. Über Jahrhunderte wurden vor allem Ureinwohner, Indios als Zwangsarbeiter in den dunklen Stollen eingesetzt. Noch heute arbeiten etwa 11.000 Kumpel im „Cerro Rico“ unter zum Teil unmenschlichen Bedingungen, darunter auch einige hundert Kinder und Jugendliche. So wie Beto, der schon als Kind seinem Vater helfen musste.
Vorsichtig tastet sich Beto durch die dunklen Stollen des „Reichen Berges“ vor. Die Luft ist voller Staub. Der Atem geht schwer, er kämpft mit dem Hustenreiz. Plötzlich bleibt der junge Mann stehen, richtet den Schein der Helmlampe an die Wand und
Silber hat die Spanier magisch angezogen
Deutlich ist die Silberader zu sehen. Sie ziehe sich den Berg durch, von Nord nach Süd, erklärt Beto. Es ist das Silber, das die Spanier magisch angezogen hat, das Silber, das die Indios in den dunklen Stollen des „Cerro Rico“ zu Hunderttausenden dahingerafft hat.
„Es muss eine unmenschliche Plackerei gewesen sein. Dieser Berg hat ja auch einen anderen Namen: „Der Berg, der Menschen frisst“. Hier in Potosí starben unglaublich viele Indios. Ureinwohner aus Bolivien, Peru, Ecuador. Ja sogar schwarze Sklaven aus Afrika. Sie waren an diese Bedingungen nicht gewohnt, gingen hier zugrunde. Und alles zum Wohle der spanischen Krone.“

Kinderarbeiter bringen die Mineralien und das Gestein nach draußen.© Deutschlandradio – Julio Segador
Taygata, ein kleines Dorf auf dem bolivianischen Hochland, zwischen Sucre und Potosí. Leonida Orellana, gekleidet in der typischen bolivianischen Tracht mit der Pollera, dem weiten farbenprächtigen Kaskaden-Rock und dem steifen, schwarzen, runden Melonen-Hut, schlägt mit einem Reisigbündel die Dornen von Kakteen ab.
Leonida Orellana, die der indigenen Gemeinschaft Sotomayor angehört, hat das Silber des „Cerro Rico“ arm gemacht. Der Verkauf der Kakteen-Früchte ist praktisch ihre einzige Einnahmequelle. Ihr Gemüse ist auf den umliegenden Märkten nicht konkurrenzfähig – es ist verseucht mit dem Gift des „Cerro Rico“. Und das bringt der Río Pilcomayo, der nahe Potosí verläuft. Der Fluss sei schuld an der Misere, berichtet die Indio-Frau in der Quechua-Sprache.
„Die Verunreinigung des Flusses macht uns große Sorge. Vor allem wegen der Pflanzen. Früher bauten wir Karotten und noch anderes Gemüse an. Aber jetzt ist alles vertrocknet. Nichts wächst mehr. Die Weinreben sind verdorrt und auch die Feigenbäume. Sie sollen endlich diese Miene schließen.“
Es sind die giftigen Chemikalien des Silberabbaus am „Cerro Rico“ die in den Pilcomayo-Fluss gelangen, über das Grundwasser, über kleinere Zuflüsse. Hochgiftige Metallverbindungen wie Arsen, Kadmium, Quecksilber, Blei, Zink und Antimon, die den Oberlauf des Pilcomayo zu einem der am stärksten belasteten Flüsse der Welt machen. Umwelt-Ingenieurin Apolonia Rodriguez hat sich in verschiedenen Untersuchungen mit der Kontaminierung des Flusses beschäftigt, der für insgesamt vier Departements im Südwesten Boliviens lebenswichtig ist.
„Es sind diese sechs Schwermetalle, die aus Sicht der Umwelt, der Menschen und auch aufgrund der Bio-Diversität Sorge bereiten. Untersuchungen haben ergeben, dass innerhalb dieser Gruppe die Werte von Arsen, Kadmium, und Antimon deutlich – und zwar sehr deutlich – über den zugelassenen Grenzwerten liegen, die unsere Umweltgesetze für Flüsse vorsehen.“
Jedes Jahr fließen 400.000 Tonnen toxische Schlacke in den Fluss
Die Menschen entlang des Pilcomayo-Flusses waren gezwungen, ihre Lebensgewohnheiten zu ändern. In vielen Dörfern muss das Trinkwasser nun mit LKW angeliefert werden. Es gibt Schätzungen, wonach pro Jahr rund 400.000 Tonnen hochtoxische Schlacke aus den Bergbaubetrieben rund um Potosí in das Gewässer fließen. Die Proteste, die im Bezirk Gewerkschaftssekretär Clemente Jacomen Yujra organisierte, hatten keinen Erfolg.
„Uns hat das Wasser des Flusses seit je her Leben gegeben. Wir haben mit dem Wasser unser Gemüse versorgt, wir haben es getrunken. Das können wir nicht mehr machen. Dieses verunreinigte Wasser gibt kein Leben mehr. Und Schuld tragen die Bergarbeiter. Sie töten uns.“
Der Protest der Menschen aus Taygata und vielen anderen Dörfern entlang des Rio Pilcomayo verhallt nahezu ungehört. Die ganze Region ist abhängig vom Bergbau, zigtausend Menschen leben direkt oder indirekt davon. Bolivien gilt als das Armenhaus Südamerikas, und Potosí ist eine der ärmsten Städte des Landes. 170.000 Menschen leben dort. Die Straßen sind holprig, überzogen mit Schlaglöchern, zum Teil nicht geteert. In einigen Vierteln der Stadt gibt es kein Wasser und Gas, keinen Strom. Eines aber hat sich nicht geändert. Noch immer thront der 4800 Meter hohe „Cerro Rico“ über Potosí, und noch immer haucht er der Stadt Leben ein.
Etwa 11.000 Kumpel schuften noch heute in dem Berg, auf der Suche nach Silber, oder besser gesagt, auf der Suche nach dem was die Spanier davon übrig ließen. Immer tiefer dringen die Bergarbeiter dabei in die Eingeweide des „Cerro Rico“ ein, bearbeiten das harte rostbraune Gestein. Zum Teil mit Methoden, die sich kaum von jenen der Zwangsarbeiter in früheren Zeiten unterscheiden.

Stalaktiten in einem der Schächte des „Cerro Rico“.© Deutschlandradio / Melanie Croyé
Aus einem kleinen, engen Seitenstollen dringen Klopfgeräusche, die beiden Brüder Richard und Félix arbeiten hier. Die Luft ist voller Staub, das Atmen fällt schwer. Die Lampen an den Helmen erleuchten das Gestein im Staubnebel. Es schnürt einem die Kehle zu. Richard schlägt mit einem klobigen, schweren Hammer und einem langen Meißel eine etwa 30 Zentimeter lange Röhre in den Fels.
„Ich vergrößere das Bohrloch, um dort den Sprengstoff für die Explosion zu platzieren. Es fehlen noch einige Zentimeter. Das ist harte Arbeit. Dann wird gesprengt und wir haben rund eine Tonne loses Gestein. Und mit dem kleinen Wagen dort befördern wir es nach draußen.“
Die Mine hat ihn ernährt – und zerstört
Félix schuftete schon als kleiner Junge in der Mine, inzwischen ist er 60 Jahre alt. Eigentlich dürfte er gar nicht mehr leben, denn die durchschnittliche Lebenserwartung der Kumpel im „Cerro Rico“ liegt bei gerade mal 50 Jahren. Félix leidet seit langem an einer Staublunge, dazu hat er Tuberkulose im Anfangsstadium. Die Mine hat ihn ernährt, sie hat ihn aber auch zerstört.
„Wenn einer überleben will, dann muss er irgendetwas arbeiten. Und hier in Potosí arbeiten die meisten Männer eben in der Mine. Es gibt fast keine andere Arbeit. Leider Gottes setzt der Berg den Menschen schwer zu. Aber: Es ist unsere einzige Möglichkeit Geld zu verdienen. Wir können hier nicht anders überleben.“
Rund 300 Kooperativen gibt es im „Cerro Rico“. Wie in einem Ameisenhaufen durchdringen sie den Berg, bearbeiten alte Stollen, sprengen sich – wenn diese nichts mehr hergeben – im weiter vor. Die Angst ist dabei ein steter Begleiter der Mieneros. Immer wieder verunglücken Kumpel in dem Stollen-Labyrinth des Berges. Jede Woche gibt es einige Tote und Verschwundene, die nie wieder auftauchen. Wie viele Stollen es gibt, weiß keiner. Das Berginnere sei nicht kartografiert, meint Beto.
„Der Berg ist wie ein Schweizer Käse, voller Löcher im Inneren. Und irgendwann einmal wird er einstürzen. Aber nicht wie bei einem Erdbeben. Wie ein Haus, das plötzlich einstürzt. Nein so wird es nicht sein. Als Mienero weiß ich, dass er langsam einstürzen wird, Stein um Stein. Ganz langsam; und das wird sich hinziehen. Der Fels ist nämlich irrsinnig hart; wir Kumpel wissen es. Wir kommen ihm ja nur mit Sprengstoff bei.“

Felix arbeitet seit über 40 Jahren im „Cerro Rico“, immer auf der Suche nach Silber. Er begann dort schon als kleiner Junge. © Deutschlandradio / Julio Segador
Die Sorge um den „Cerro Rico“ ist begründet. Der Berg, 1978 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt, ist einsturzgefährdet. Wie aus Chroniken hervorgeht, notierten die ersten Messungen Mitte des 16. Jahrhunderts seine Höhe noch deutlich über 5000 Meter, inzwischen sind es nicht einmal mehr 4800 Meter. Der Berg hat nachgegeben, und er gibt weiter nach. Der Abbau oberhalb von 4400 Metern ist inzwischen verboten, auch wenn sich viele Kumpel nicht daran halten. Der „Cerro Rico“ ist ein Symbol Boliviens, ein Symbol des verhassten Kolonialismus, er steht als Mahnmal für den Reichtum und die Armut des Andenlandes. Staatspräsident Evo Morales mahnte erst kürzlich bei einem Besuch in Potosí zur Vorsicht.
„Was den Berg anbelangt sollten sich eigentlich die Menschen in Potosí einigen. Viele Bergleute wollen den Berg nicht aufgeben. Ich hoffe, dass die Mieneros hier den Kopf nicht verlieren. Ich habe immer wieder gesagt: Es dürfen keine weiteren Risiken eingegangen werden. Wir können die Kumpel ja nicht mit der Polizei aus dem Berg holen. Ich appelliere hier an die Vernunft der Leute in Potosí.“
Die Anhängigkeit vom Berg verringern
Als mögliche Alternative hat Präsident Evo Morales vorgeschlagen, den Tourismus in der Stadt anzukurbeln, um dadurch die Abhängigkeit vom Berg zu verringern. Man sollte die geheimen unterirdischen Verbindungsgänge von den Kirchen in Potosí zum „Cerro Rico“ erforschen und erschließen. Solche Geheimgänge würden zweifellos zur Touristenattraktion, so der präsidentielle Ratschlag. Arnolfo Gutierrez, in der Stadtverwaltung von Potosí zuständig für die Minen und damit auch für den „Cerro Rico“, hält davon nicht so viel. Schließlich sei der Berg der wichtigste Arbeitgeber weit und breit, und das seit Jahrhunderten. Für ihn kommt eine Schließung des „Cerro Rico“ nicht in Frage.
„Man kann den Kollegen nicht ihre Arbeit wegnehmen. Das ist unsere Haltung hier in Potosí. Wir müssen aber darauf achten, dass in den einsturzgefährdeten Zonen nicht mehr gearbeitet wird. Damit nicht noch mehr Fels wegbricht und die Bergspitze sich nicht weiter senkt.“
Es ist der Fluch des Silbers. Über Jahrhunderte hat der Cerro Rico einen Teil seines Reichtums abgegeben, aber keiner weiß, wie viel Silber die Mieneros dem „Cerro Rico“ noch abtrotzen können; Doch die Frage ist, zu welchem Preis? Mieneros, deren Gesundheit durch die jahrelange Schufterei in den dunklen Stollen ruiniert ist, eine Umwelt, die durch die Folgen des Silberabbaus schwer geschädigt wird. Und die Armut in Bolivien hat der Reichtum des Berges auch nicht ausgelöscht. Ganz im Gegenteil. Rosario Tapia, die in Potosí an einem Umweltinstitut arbeitet, plädiert für eine ehrliche Rechnung.
„Es wäre gut, einen Vergleich aufzustellen: Wie viel Gewinn generiert der Bergbau? Und wie hoch sind die Verluste in der Land- und Viehwirtschaft. Wir wissen doch, dass nur einige wenige die Gewinne einstreichen. Klar ist: Der Bergbau schädigt das Ökosystem, ebenso die Landwirtschaft, auch die Gesundheit der Lebewesen. Es sind endliche Ressourcen, die da abgebaut werden. Irgendwann ist nichts mehr da. Dann gibt es kein Silber, keine Lebensmittel und auch die Gesundheit nimmt Schaden.“