Kristin Shi-Kupfer leitet den Forschungsbereich Politik, Gesellschaft und Medien am Mercator Institute for China Studies in Berlin. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sinologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Von 2007 bis 2011 berichtete sie unter anderem für "ZEIT Online", "taz" und epd aus Beijing (Peking). 2017 wurde Shi-Kupfer in die Expertengruppe der deutsch-chinesischen Plattform Innovation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung berufen. Seit 2019 ist sie auch Mitglied in der deutsch-chinesischen Arbeitsgruppe zu digitalen Geschäftsmodellen im Rahmen der Plattform Industrie 4.0.
"Taiwan rückt ins Visier Chinas"
29:05 Minuten
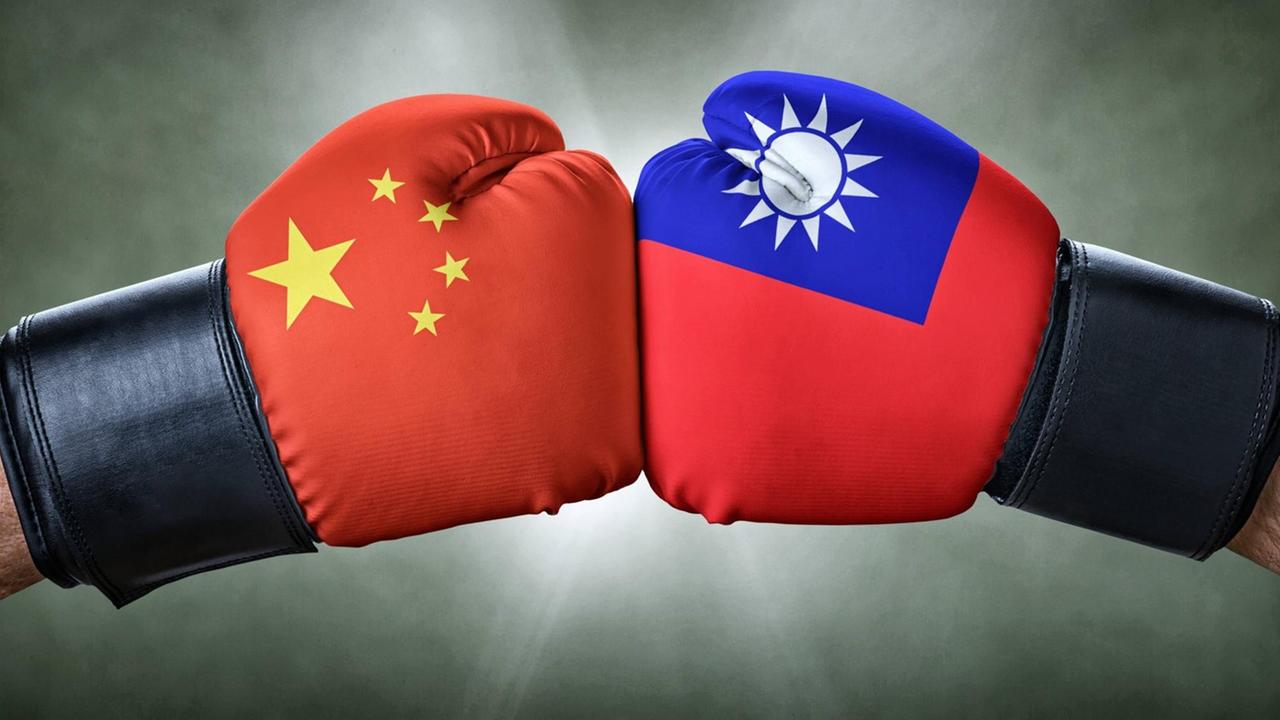
China erhöht den Druck auf die Demokratiebewegung in Hongkong. Und auch gegenüber Taiwan, für China eine abtrünnige Provinz. Deutschland und Europa sollten dem Inselstaat den Rücken stärken, sagt die Sinologin Kristin Shi-Kupfer.
Offenbar gibt es sowohl auf der politischen als auch der militärischen Ebene Anzeichen dafür, dass China Taiwan verstärkt ins Visier nimmt - und dass die Regierung in Peking ihre Begehrlichkeiten zunehmend deutlicher und aggressiver formuliert. Davor warnt Kristin Shi-Kupfer, Forschungsleiterin Politik und Gesellschaft des Mercator Institute for China Studies.
Chinesische Kampfjets verletzen den taiwanesischen Luftraum, chinesische Politiker lassen beim seit Jahrzehnten mantrahaft vorgetragenen Bekenntnis zur friedlichen Wiedervereinigung der Volksrepublik mit dem Inselstaat Taiwan neuerdings das Wörtchen "friedlich" weg.
Hinzu komme, beobachtet die Sinologin Shi-Kupfer, ein wachsendes Gefühl eigener Identität der Taiwaner, politisch wie kulturell. Das sei auch eine Folge der Art, wie Peking die Demokratiebewegung in Hongkong unterdrückt: "China hat das Autonomieversprechen gebrochen, das kann man nicht anders sagen." Und das gebe Vielen auf Taiwan zu denken.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Zwar haben sich die USA vertraglich verpflichtet, Taiwan vor Angriffen von außen zu schützen. Doch sind die Vereinigten Staaten derzeit rund um den Präsidentschaftswahlkampf sehr mit ihren inneren Konflikten beschäftigt, was Peking natürlich beobachtet. "Einige Kräfte innerhalb Chinas aus dem Militär haben gesagt: ‚Wenn nicht jetzt, wann dann?‘ Und die drücken schon seit Jahren die chinesische Regierung zu einem härteren Vorgehen gegenüber Taiwan", sagt Kristin Shi-Kupfer.

Die EU sollte Taiwan im sich anbahnenden Konflikt mit China den Rücken stärken, meint Sinologin Kristin Shi-Kupfer.© Imago Images / Jürgen Heinrich
Denn Taiwan als freiheitliche, demokratische Gesellschaft sei ein Dorn im Auge der chinesischen Führung: "Es geht bei Taiwan und Hongkong letztlich schon um eine Demonstration: Das ist Teil des chinesischen Territoriums, das ist etwas, wo der Machtanspruch der kommunistischen Partei auf jeden Fall durchgesetzt werden muss."
Dass Deutschland und andere europäische Staaten die aggressive Politik Chinas mittlerweile deutlicher kritisieren als bisher, begrüßt Shi-Kupfer: "Das ist absolut angemessen". Nicht nur in Bezug auf Taiwan und Hongkong, sondern auch hinsichtlich der brutalen Unterdrückung muslimischer Uiguren in der nordwest-chinesischen Provinz Xinjian.
Mehr als "reine Rhetorik"
Dabei müssten die EU und Deutschland "über die reine Rhetorik hinaus" konkrete Maßnahmen ergreifen, etwa eine unabhängige Untersuchung der Menschenrechtslage in Xinjian, oder bestehende Auslieferungsgesetze mit Hongkong außer Kraft setzen, bis hin zu Sanktionen gegen chinesische Politiker.
Und dabei solle der Westen auf die Wirtschaftsbeziehungen zu China keine übertriebene Rücksicht nehmen: "Man sollte sich nicht von diesem ‚wir sind von China zu abhängig‘-Narrativ, was so nicht stimmt aus meiner Sicht, in den Optionen beschränken lassen gegenüber China." Denn die wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen Europa und China sei durchaus wechselseitig.
Von Tschechien lernen
Um Taiwan gegenüber dem großen Nachbarn den Rücken zu stärken, sei eine diplomatische Anerkennung des Inselstaats nicht zu empfehlen, findet Kristin Shi-Kupfer. Eher sollte sich Deutschland als EU-Ratspräsident für eine Aufnahme Taiwans in die Weltgesundheitsorganisation einsetzen. Und die Regierung in Taipeh durch hochrangige Besuche aufwerten, wie das gerade Tschechien getan hat – sehr zum Ärger Pekings.
(pag)
Das Interview in ganzer Länge:
Deutschlandfunk Kultur: Diese Woche war Herr Wang zu Besuch in Berlin. Wang Yi ist der Außenminister der Volksrepublik China und seine Gespräche mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas liefen nicht unbedingt harmonisch, etwa beim Thema Hongkong, wo die Pekinger Führung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit immer weiter einschränkt. Und es könnte sich weiteres Ungemach zusammenbrauen in dieser Weltgegend.
Das meint jedenfalls meine heutige Gesprächspartnerin Kristin Shi-Kupfer. Sie ist Sinologin. Als Forschungsleiterin Politik und Gesellschaft am Mercator Institute for China Studies in Berlin, Frau Shi-Kupfer, beobachten Sie seit Jahren die Situation und Entwicklung in und um China. Vor einigen Tagen haben Sie in einem Zeitschriftenartikel gewarnt, China könne, nachdem es Hongkong ja immer stärker an die Kandare nimmt, sich nun auch Taiwan vorknöpfen. Taiwan, dieser Inselstaat vor der chinesischen Küste, den die Volksrepublik als "abtrünnige Provinz" ansieht. Warum glauben Sie, dass die Führung in Peking jetzt verschärft Taiwan ins Visier nimmt?
Kristin Shi-Kupfer: Taiwan war und ist ja immer ein wichtiges Ziel gewesen der chinesischen Politik. Es geht territoriale Zugehörigkeit. Es geht natürlich ganz grundsätzlich auch um Demonstration von Stärke. Und wir haben in den letzten Monaten da auch substanzielle Änderungen beobachten können. Jetzt relativ aktuell im Mai auf dem Nationalen Volkskongress, wo erstmals im Regierungsbericht des Ministerpräsidenten Li Keqiang das Wort "friedlich" im Kontext von ursprünglich, "wir streben die friedliche Wiedervereinigung an mit Taiwan", rausgefallen ist. Das war ein Indikator, der darauf hingedeutet hat politisch, dass China Taiwan doch mehr ins Visier nimmt.
Und wir haben auch in den letzten Monaten seit Januar beobachten können, dass es vermehrt militärische Manöver, Überflüge gegeben hat, also auch bewusst Überflüge der inoffiziellen Luftgrenze, des Luftraums Taiwans, den China auch mehr oder weniger akzeptiert prinzipiell. Also, wir haben sowohl auf der politischen Ebene als auch der militärischen Ebene Anzeichen in den letzten Monaten, dass Taiwan doch verstärkt ins Visier eines möglicherweise auch selbstbewussteren bis hin zu aggressiveren Vorgehens Chinas gerückt ist.
Deutschlandfunk Kultur: Rekapitulieren wir kurz mal die Fakten. Die Insel Taiwan ist flächenmäßig etwa so groß wie Baden-Württemberg, hat 23 Millionen Einwohner, ist de facto ein unabhängiger Staat, der aber von den allermeisten Ländern der Welt, inklusive Deutschland, diplomatisch nicht anerkannt wird, und zwar, weil China das nicht will. Denn für Peking ist Taiwan bloß ein abtrünniger Teil der Volksrepublik, der früher oder später mit Festland-China vereinigt werden muss. Bisher hieß es, wie Sie sagten, "friedlich", jetzt legt man auf "friedlich" nicht mehr so großen Wert.
Das ist der Stand der Dinge. Mit dem hatten sich die beiden Chinas und der Rest der Welt in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich ganz gut arrangiert. Das kommt jetzt ins Rutschen. – Warum?
Shi-Kupfer: Neben dem Faktor China spielt natürlich auch die Situation in Taiwan da eine relativ große Rolle. Wir haben ja jetzt einen Regierungswechsel gehabt schon seit einiger Zeit in Taiwan. Die amtierende Präsidentin ist ja jetzt auch bestätigt worden im letzten Jahr. Die Demokratische Partei Taiwans, also nicht mehr die Partei Kuomintang, die ja noch eine gewisse Zugehörigkeit hatte mit China - sie waren geflüchtet in den 40er-Jahren im Kontext des Bürgerkriegs auf dem Festland - das ist eine Partei, die zunehmend vorangetrieben hat und auch wahrgenommen hat innerhalb der Gesellschaft, dass es eine eigene Identität gibt auf Taiwan. Eine eigene politische Identität, teilweise auch sicherlich eine Identität, die mehr in den kulturellen Raum hineinspielt, obwohl es da natürlich schon auch noch Verbindungen gibt. Aber dieses Gefühl aus der Gesellschaft heraus in Taiwan, natürlich jetzt auch mit Blick auf die Ereignisse in Hongkong, "nein, wir haben eine eigene Identität, wir haben auch …"
Taiwanesisches Nationalgefühl
Deutschlandfunk Kultur: Würden Sie auch sagen, ein Nationalgefühl, ein taiwanesisches?
Shi-Kupfer: Ich würde schon auch sagen, durchaus ein Nationalgefühl, was, wie gesagt, durch äußere Einflüsse, gerade durch die Wahrnehmung, was eben um Taiwan herum passiert, auch entstanden ist. Aber auch ein inneres Gefühl: Man ist auch stolz – denke ich – zurecht auf die demokratischen Prozesse, auf die transparente Kommunikation, auf den Pluralismus, der auch in Taiwan existiert, anders als in der Volksrepublik. Taiwan war beispielsweise auch das erste Land, das die Ehe für Homosexuelle legalisiert hat. Das hat man auch als Bestätigung einer pluralistisch-modernen Gesellschaft gefeiert. – Also, kurzum, in der Tat eine eigene Identität, die in Taiwan gewachsen ist und die die Regierung aufgenommen hat und dann eben auch sukzessive politisch zunehmend selbstbewusster kommuniziert hat: "Wir sind wirklich etwas anderes als die Volksrepublik."
Ein Fenster der Gelegenheit?
Deutschlandfunk Kultur: China auf der anderen Seite betreibt ja auch eine Politik der diplomatischen und auch militärischen Nadelstiche, wie Sie das gerade dargelegt haben. Aber hat China eigentlich nicht derzeit genügend Probleme: die Corona-Krise, deren wirtschaftliche Folgen sind ja noch nicht ausgestanden, den Handelsstreit mit den USA, überhaupt problematische Beziehung zu den USA, die Kritik des Wesens an der Hongkong-Politik. – Warum sollte Peking jetzt in und um Taiwan noch ein Fass aufmachen?
Shi-Kupfer: In der Tat natürlich, das ist eine Betrachtungsweise, dass die massiven internen Probleme China genau davon abhalten könnten, jetzt wirklich noch Konfrontation zu suchen, dann natürlich auch mit den USA, die Taiwan ja vertraglich auch Unterstützung zugesagt haben.
Eine andere Betrachtungsweise ist aber auch: Man nutzt, um von internen Krisen abzulenken, dann eben ein militärisches Scharmützel, einen militärischen Konflikt, um dann an den Nationalismus in China zu appellieren und dann eben genau von diesen internen Problemen abzulenken. Peking könnte ja durchaus auch denken, die Beziehungen mit den USA sind sowieso jetzt im Kontext nicht mehr zu retten. Die USA sind vielleicht auch abgelenkt. Dann, je näher wir an die Wahlen rücken, da ist möglicherweise ein Fenster der Gelegenheit, wie das immer so schön heißt. Die Welt ist auch noch grundsätzlich natürlich mit Covid-19 beschäftigt.
Also, einige Kräfte innerhalb Chinas, auch das haben wir lesen können in den letzten Wochen und Monaten aus dem Militär, verschiedenste Generäle haben gesagt: "Wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt." Und die drücken schon seit Jahren die chinesische Regierung zu einem generell härteren Vorgehen auch gegenüber Taiwan.
Deutschlandfunk Kultur: Die USA haben reagiert. Sie haben gleich zwei Flugzeugträger-Kampfgruppen in die Region geschickt. – Könnte das zu einer militärischen Konfrontation führen – und sei es auch nur aus Versehen?
Shi-Kupfer: Das ist zumindest das, was viele Militärexperten und Beobachter durchaus befürchten – nicht unbedingt jetzt bewusst, aber in der Tat aufgrund eines Zusammenstoßes. Das hatten wir auch schon in den 90er- und 2000er-Jahren auch zwischen China und den USA, dass zwei Flugzeuge bewusst oder unbewusst kollidiert sind. Wir hatten Fischerboote, die kollidiert sind. Das ist also durchaus ein Szenario, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist, und dass das möglicherweise eskalieren könnte. Also, die Gefahr, denke ich, besteht durchaus.
Präsident Xi Jinping "zunehmend unter Druck"
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben von Hardlinern gesprochen, gerade im chinesischen Militär, die sagen: "Wann, wenn nicht jetzt?" – Wie schätzen Sie die Haltung des starken Manns in China ein, Präsident Xi Jinping? Es gibt ja die These, dass der in seiner Amtszeit die Wiedervereinigung auf jeden Fall noch erleben möchte. Und er ist immerhin schon 67 Jahre alt.
Shi-Kupfer: Ja, das ist in der Tat eine These, die man auch in auslands-chinesischen Medien lesen konnte, gerade als er ja diese Amtszeitbegrenzung für sich als Präsidenten zumindest, nicht als Parteivorsitzendem, aber als Präsidenten Chinas ausgehebelt hat, dass er das bewusst gemacht hat, damit garantiert ist, dass Taiwan sozusagen noch eingegliedert werden kann in das Territorium der Volksrepublik.
Also, Xi ist grundsätzlich auch, denke ich, zunehmend unter Druck, wirtschaftspolitisch vor allen Dingen. Zu den jetzt aktuellen Krisenphänomenen kommen ja die massiven strukturellen Probleme, der Überschuldung, jetzt auch natürlich der Gegenwind, den er bekommt für Infrastrukturprojekte weltweit. Die Seidenstraßen-Initiative, sein Lieblingsprojekt, da klaffen Wunsch und Realität zunehmend auseinander. Viele Länder, die es ursprünglich unterstützt haben, ja auch in Osteuropa, haben sich davon abgewandt.
Also, kurzum: Er gilt nach dem, was man weiß, jetzt nicht per se als Hardliner oder als Militär, er ist aber sicherlich, glaube ich, in einer solchen Krise auch zugewandt Stimmen, die sagen: "Das ist jetzt noch ein Erfolg, wo du mal Erfolg möglicherweise beweisen kannst, wo du Härte beweisen kannst – ähnlich wie in Hongkong." Das ist ja auch ein Bereich. So lesen es auch manche Beobachter in China, soweit man die noch lesen kann, dass er das bewusst gemacht hat, weil er in anderen politischen Bereichen nicht mehr so erfolgreich ist und deswegen Hongkong gewählt hat als Politik der Stärke, um da noch mal ein Signal zu setzen: "Nein, ich habe die Sache noch im Griff und ich bin ein Mann der Tat."
Chinas Machtanspruch über Hongkong und Taiwan
Deutschlandfunk Kultur: Geht’s da auch um Ideologie? Sie haben ja gerade Taiwan dargestellt als eine, ja lupenreine Demokratie, als eine sehr offene freiheitliche Gesellschaft. Damit dementieren, widerlegen die Taiwaner ja eigentlich die Behauptung Chinas: "Demokratie passt nicht in unseren Kulturraum".
Shi-Kupfer: Das ist sicherlich auch ein Aspekt, also, ganz grundsätzlich im Kontext des Wettbewerbs der Systeme, den China ja auch so formuliert. Das ist ja nicht nur etwas vonseiten der liberalen Demokratien, der EU, die sagt, "China ist auch ein Rivale". Sondern China sieht schon auch sein System und damit natürlich auch die Gesellschaftsform, wie Gesellschaft kontrolliert wird oder eben nicht, bei uns zumindest sehr viel weniger. Das ist sicherlich schon auch ein Faktor. Aber ich glaube, das ist nicht der Hauptfaktor. Es geht bei Taiwan und bei Hongkong letztlich schon dann auch um eine Demonstration: Das ist Teil des chinesischen Territoriums. Das ist etwas, wo der Machtanspruch der kommunistischen Partei auf jeden Fall durchgesetzt werden muss.
Deutschlandfunk Kultur: Wie weit kann das gehen? Eine militärische Invasion der Hauptinsel Taiwan wäre für China sicherlich mit einigen Risiken verbunden, vor allem, was die USA betrifft, die ja eigentlich Taiwans Sicherheit garantiert haben. – Welche Möglichkeiten hat Peking noch unterhalb der Stufe wirklich der Invasion, Taiwan unter Druck zu setzen?
Shi-Kupfer: Das haben ja Militärexperten, Beobachter relativ detailliert analysiert schon seit Jahren. Es gibt dort verschiedenste Elemente, die aus Sicht dieser Militärexperten denkbar sind, zum einen eine schnelle Besetzung von vorgelagerten Inseln, die also auch von der südöstlichen Küste der Volksrepublik dann gut und schnell erreichbar wären – möglicherweise auch erst mal relativ unbemerkt.
Insel-Besetzungen, Seeblockade, Cyber-Attacken
Deutschlandfunk Kultur: Sind die unbewohnt?
Shi-Kupfer: Die sind relativ unbewohnt. Da gibt es schon auch einzelne Fischer, aber das sind jetzt keine dicht besiedelten Inseln – genau, in der Tat. Seeblockade ist ein weiterer Faktor, also eine Seeblockade, um dann Taiwan sozusagen auch abzuschneiden von Zulieferungen. Und ein weiterer Faktor, der oft auch genannt wird, ist, dass die – davon geht man aus – verdeckten Mitarbeiter der chinesischen Regierung, des chinesischen Geheimdienstes in Taiwan mobilisiert werden, um dann wirklich auch kritische Infrastrukturen außer Gefecht zu setzen. Stichwort Cyber-Attacke.
Also, diese Elemente – Besetzung der vorgelagerten Inseln, Seeblockade um Taiwan herum und dann eben diese Cyber-Attacken auf der Insel - in Kombination dann mit diesem schon besprochenen Zeitfenster, wenn möglicherweise die USA eben abgelenkt ist aufgrund der Turbulenzen um die Wahlen herum und dann auch eben nicht schnell agieren kann, weil sie einfach nicht handlungsfähig sind.
Schutzmacht USA
Deutschlandfunk Kultur: Apropos USA: Die engagieren sich in letzter Zeit verschärft in Taiwan. Es gibt neue Waffenlieferungen. Gerade war der amerikanische Gesundheitsminister zu offizieller Visite in Taipeh, was Peking mächtig ärgert. – Was haben die USA mit Taiwan vor, Ihrer Einschätzung nach?
Shi-Kupfer: Ich glaube, es gibt schon große Teile – und das auch jetzt parteiübergreifend – in beiden Parteien, die sagen: "Wir müssen auch, gerade um China sozusagen Kontra zu bieten, um unsere US-amerikanischen Interessen auch in der Region zu wahren, wir müssen Taiwan stärker aktiv unterstützen." Die USA sind ja ganz grundsätzlich – im Gegensatz zu auch europäischen Ländern – vertraglich durch diesen Taiwan Relations Act, also eine Art Pakt im Falle eines Angriffs von Taiwan, verpflichtet, Taiwan zu unterstützen und auch immer durch entsprechende Rüstungslieferungen dafür zu sorgen, dass Taiwan auf einem Niveau ist, in dem es sich verteidigen kann.
Ich glaube, man will durch diesen Besuch oder generell durch diese Signale, die man setzte, doch mal sehr viel stärker auch in Richtung Peking natürlich demonstrieren: "Wir sind sehr gewillt, uns an diese vertraglich verbrieften Unterstützungsforderungen zu halten. Und wir werden das auch tun. Glaubt nicht, dass wir uns durch die Beziehung mit euch oder durch irgendetwas anderes davon abbringen lassen."
Chinas Blick auf die US-Wahl
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben schon verschiedentlich die Präsidentschaftswahlen in den USA am 3. November erwähnt, das große Fragezeichen, das hinter vielen Themen steht. – Was erwartet denn die chinesische Führung von dieser Wahl? Hofft sie, dass Joe Biden gewinnt und dann bessere Zeiten anbrechen?
Shi-Kupfer: Ich glaube, ganz grundsätzlich ist das für die chinesische Führung so eine Frage zwischen der schlechteren und der noch schlechteren Wahl. Man beobachtet in Peking nach dem, was wir lesen können, schon auch, dass auch innerhalb der Demokratischen Partei sich grundsätzlich eher der Ton wenig verändern wird gegenüber China, also, dass man schon auch davon ausgeht, dass es eine relativ harte, nach wie vor auch auf Rivalität angelegte Politik geben wird.
Natürlich geht man – vermute ich – auch in Peking davon aus, dass es mit Joe Biden möglicherweise einfacher im Umgang wird. Man kann sich verlassen auf bestimmte Bedingungen. Ich denke schon, dass man sich möglicherweise erhofft, dass man den Handelskonflikt etwas leichter, einfach rationaler beilegen kann, weil man dann nicht mehr ein Gegenüber hat, der also auch willkürlich für alle in dieser Welt seine Positionen, die ihm seine Berater nahegelegt haben, über den Haufen wirft. – Also, ich glaube, Biden ist schon vom Verhandlungsgegenüber auch aus Sicht Chinas eine etwas bessere Wahl. Aber ich glaube, man macht sich auch keine Illusionen, dass sich an der China-Politik dadurch grundlegend etwas ändern würde in den USA. Also, man geht, denke ich, schon nach wie vor davon aus, dass es eine schwierige Beziehung bleiben wird, eine Rivalität, aber unter einem Präsidenten Joe Biden möglicherweise ein etwas rationaleres Fahrwasser bekommen wird.
Deutschlandfunk Kultur: Frau Shi-Kupfer, reden wir über Europa, reden wir über Deutschland. Chinas Außenminister Wang hat, wie erwähnt, gerade eine Europareise absolviert mit Berlin als letzter Station. Es ging ihm dabei wohl darum, die Beziehungen Chinas zu Europa zu festigen, gerade jetzt, wo es so viel Ärger mit den USA gibt. – War das aus chinesischer Sicht eine erfolgreiche Europareise?
Shi-Kupfer: Das kommt natürlich sehr drauf an, welche Erfolgskriterien die chinesische Regierung anlegt. Wenn das Erfolgskriterium ist, möglichst harsch, auch möglichst mit wenig diplomatischer Rhetorik Drohungen in alle europäischen Länder zu entsenden, dann ist es möglicherweise ein Erfolg. Aber von den Reaktionen, die Wang ja eigentlich in allen Ländern mehr oder weniger bekommen hat, also, brüske Zurückweisung und auch ein alles andere als Sich-Einschüchtern-Lassen, sei es jetzt in Norwegen, sei es in Holland oder in Dänemark und dann auch in Deutschland, ist es kein Erfolg in der Hinsicht, dass man es aus chinesischer Sicht, glaube ich, nicht geschafft hat, die Europäer davon zu überzeugen, sich enger an China zu binden oder doch möglicherweise eben auch im Folgeschluss sich noch stärker von den USA zu distanzieren.
Also, es kommt auf das Kriterium an, aber ich denke ganz grundsätzlich: Wenn es darum ging, die Europäer wieder näher an China heranzuführen, ist diese Reise ein sehr, sehr zweifelhafter Erfolg.
Europa als Zünglein an der Waage
Deutschlandfunk Kultur: Wie wichtig ist Europa denn für China gerade jetzt in der derzeitigen Lage mit den USA und mit der Corona-Krise? Und wie wichtig ist Deutschland?
Shi-Kupfer: Also, Europa ist oder war immer, ist jetzt natürlich auch noch mal mehr immer ein bisschen so das Zünglein an der Waage gewesen für China, gerade was die Beziehung zu den USA angeht. Die Beziehungen zu den USA waren und sind sicherlich immer die wichtigsten Beziehungen, die die Volksrepublik China hatte. Man hat deswegen, um diese Beziehung etwas auszubalancieren oder sozusagen da noch mehr Gewicht für sich selbst hineinzubringen, ja immer bewusst versucht, Europa, die EU auch etwas zu spalten bzw. das hauptsächlich bilateral auszutragen. Man hatte auch am Anfang der Amtszeit von Xi Jinping Erfolg in der Hinsicht, dass man gerade die osteuropäischen Länder hat stärker an sich binden können, eben mit Infrastrukturprojekten.
Grundsätzlich Westeuropa und Deutschland, das sieht China natürlich auch, das sind die Treiber, jetzt auch, was die Wirtschaftspolitik angeht, natürlich auch die politischen Schwergewichte. Ich glaube, die sind jetzt gerade, wo die Beziehungen zu den USA noch schwieriger geworden sind und wo natürlich Peking schon auch die transatlantischen Spannungen wahrnimmt, schon noch mal wichtiger geworden. Weil man sich dadurch erhofft hatte, jetzt keine Bündnispartner zu gewinnen, so naiv ist sicherlich Peking auch nicht, aber noc hmal mehr Gewicht in die eigene Waagschale zu bekommen. Und man hatte, glaube ich, auch mehr darauf gesetzt, dass man die Europäer und Amerikaner doch noch etwas mehr auseinanderdividieren kann.
Deutschlandfunk Kultur: Dabei geht’s ja wahrscheinlich nicht nur um Politik, sondern auch um die Wirtschaftsbeziehungen gerade in Corona-Zeiten. Chinas Wirtschaft scheint sich ja einigermaßen zu berappeln nach dem Einbruch wegen der Pandemie. Deutsche Autos werden wieder gekauft im Reich der Mitte. – Rücken Europa und China jetzt wirtschaftlich enger zusammen angesichts der Corona-Krise und dem Handelskonflikt mit den USA?
Shi-Kupfer: Das glaube ich eher nicht. Ich glaube zum einen, in Europa ist auch das Bewusstsein gewachsen, gerade noch mal durch die Corona-Krise, wie wichtig es auch ist, gewisse – das fängt jetzt an bei natürlich auch Maskenproduktion, aber dann natürlich auch bei dann grundsätzlichen Infrastrukturen, was jetzt auch natürlich mit medizinischer Versorgung zu tun hat, aber auch darüber hinaus - wie wichtig das ist, das doch mehr oder weniger in der eigenen Hand zu haben. Gerade in solchen Krisen hat sich ja - leider kann man auch sagen - gezeigt, dass erst mal jedes Land, jede Region auf sich schaut, natürlich wenn dann auch Handelsfluss international unterbrochen war.
Aber ich glaube, das hat eher das Bewusstsein auch in Europa gestärkt, dass diese zunehmend strukturellen Probleme, die man ja mit China in den letzten Jahren immer hatte und da auch eine gewisse Frustration eingetreten ist, dass eigentlich jetzt diese Diversifizierung von Lieferketten, auch andere Standorte, auch wieder näher eben an Europa, in Osteuropa, aufzubauen. Ich glaube, das Bewusstsein ist eher gewachsen.
Auch in China ist es ja im Moment eine sehr interessante Debatte wirtschaftspolitisch, die zwei Zirkulationen ist das neue Stichwort. Es geht um eine innere Zirkulation, also, wie man den Binnenmarkt nutzen kann, um Dynamik zu erzielen, und wie man aber auch nach wie vor die internationale Zirkulation, also internationalen Handel, Export natürlich vor allen Dingen, nutzen kann, um wieder neue Dynamik hineinzubekommen.
Auch in China geht die Tendenz, auch nicht nur gegenüber den USA, sondern ganz grundsätzlich, jetzt auch in der wirtschaftspolitischen Ausrichtung schon auch mehr auf Autonomie, Eigenständigkeit und so ein bisschen – soweit das möglich ist – eben auch Stärkung der eigenen Industrien und Entkopplung etwas stärker von internationalen Handels- und Wirtschaftsströmen.
Das Ende der sanften rhetorischen Kritik
Deutschlandfunk Kultur: Wir haben darüber gesprochen, dass die Reise des Herrn Wang durch Europa nicht so besonders harmonisch war. Auch der Bundesaußenminister hat kritische Worte gefunden beim Besuch seines chinesischen Kollegen in Berlin: Kritik an der Unterdrückung der Uiguren in West-China, Kritik am wachsenden chinesischen Druck auf Hongkong, namentlich das neue Sicherheitsgesetz, mit dem Chinas Behörden massive Durchgriffs-Rechte in Hongkong bekommen. – Halten Sie die deutsche Kritik für angemessen, für ausreichend?
Shi-Kupfer: Also, angemessen absolut. Das ist ja etwas, was lange deutlich geworden ist, dass sich Europa, also Deutschland, aber auch Europa allgemein in diesen Fragen ja sehr, sehr stark zurückgehalten haben. Und was sicherlich auch von chinesischer Seite dazu geführt hat, dass man diese sanfte rhetorische Kritik, der ja dann auch wenig konkrete Taten gefolgt sind, dass man das nicht so ernstgenommen hat und man sich nicht sozusagen bemüßigt sah, da irgendetwas zu verbessern oder sich zurückzuhalten. Sondern Peking ist davon ausgegangen, "das bringt uns jetzt nicht konkrete Konsequenzen ein. Wir können so weitermachen".
Deswegen: Das ist absolut angemessen, ganz besonders in Xinjian. Wir haben erdrückende Beweise dafür, auch von Leuten, die ja selber in diesen Lagern waren, dass es sich nicht um Bildungs-, Fortbildungsstätten handelt, sondern wirklich um Zwangslager, wo Menschen gefoltert werden. Da ist Kritik absolut wichtig, angebracht. Auch im Falle Hongkongs natürlich. China hat das Autonomieversprechen gebrochen, das kann man nicht anders sagen, mit dieser nationalen Sicherheitsgesetzgebung, die seit Anfang Juli, seitdem das Gesetz in Kraft ist, wirklich sich auf alle Teile der Hongkonger Gesellschaft schon ausgewirkt hat. Wir hatten schon einige Verhaftungen in verschiedensten Bereichen.
Das ist sicherlich etwas, was die internationale Gemeinschaft und Deutschland noch mal sehr viel klarer und stärker benennen sollte und auch konkret überlegen muss aus meiner Sicht, was sie auch tun kann, was sie tun will über die reine Rhetorik hinaus.
Deutschlandfunk Kultur: Aber was kann sie tun über die reine Rhetorik hinaus?
Shi-Kupfer: Das kommt natürlich jetzt sehr auf das konkrete Problem an oder den konkreten Konflikt. Heiko Maas hat ja auch zu Recht gefordert, und das zum ersten Mal sehr deutlich, dass es eine unabhängige Untersuchungskommission geben soll in Bezug auf Xinjian.
Von der China-Politik der USA lernen
Deutschlandfunk Kultur: Xinjian, um das noch mal zu sagen, ist die Provinz, wo die muslimische Minderheit Uiguren lebt, die unterdrückt wird.
Shi-Kupfer: Richtig, genau, in Nordwest-China, wo wir eben diese Internierungslager haben. Natürlich dann auch eine Überprüfung – und das geht in Richtung Wirtschaft – der Zulieferer dort, mit Zwangsarbeit verknüpft, also, natürlich auch Umsetzung bestehender Bestimmungen von Unternehmen. Das ist sicherlich auch eine wichtige Forderung. In Bezug auf Hongkong, die Wahlen durchzuführen, das Auslieferungsgesetz weiterhin auszusetzen oder vielleicht auch ganz aufzuheben, was Europa und was ja auch Deutschland mit Hongkong hat. Auch die Einstellung und noch mal die stärkere Überprüfung von Exportgütern, die Deutschland und Europa nach Hongkong schicken, die eben dann auch eingesetzt werden können, um Menschen dort zu unterdrücken.
Ich glaube, auch ganz grundsätzlich sollte sich Europa mit dem Instrumentarium beschäftigen, was die USA zur Verfügung hat, dass man also ein einen Reviewprozess hat auch innerhalb des Parlaments, was den Autonomiestatus Hongkong angeht und was dann möglicherweise auch mit Sanktionen gegenüber chinesischen Politikern zu tun hat, so wie die USA das ja jetzt auch angeregt und teilweise auch umgesetzt hat.
Deutschlandfunk Kultur: Nun ist aber die China-Politik der Europäischen Union keine besonders konsistente. Da gibt’s ganz unterschiedliche Interessen. Manche Staaten schielen dann doch mehr auf die Geschäftsbeziehungen, darauf, vielleicht bei der Seidenstraße mitspielen zu dürfen. – Muss Deutschland sich dann doch mehr oder weniger auf einen Alleingang einstellen?
Shi-Kupfer: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Deutschland hat jetzt natürlich gerade die Chance als Ratspräsident, auch teilweise, muss man ja auch ganz offen sagen, aufzuholen, was andere Länder ja schon vorgemacht haben.
Nehmen wir mal das Beispiel Taiwan. Da ist ja schon auch sehr, sehr erstaunlich und bewundernswert, dass jetzt beispielsweise Tschechien da so aktiv geworden ist. Das ist ja etwas, ganz konkret: Besuch von hochrangigen Politikern, wo auch Deutschland – auch im Kontext der EU, denke ich – nachziehen könnte. Das ist ein Symbol natürlich, aber es ist eine konkrete Tat. Es ist ein Zeichen der Unterstützung, was – glaube ich – auch relativ leicht zu planen und umzusetzen ist. Ich glaube schon auch, dass man da auch noch andere Verbündete gewinnen kann.
Denn wir hatten ja aus dem Europäischen Parlament heraus auch über die Länder hinweg eine Petition eben auch, sich einzusetzen beispielsweise für den Beitritt Hongkongs zur Weltgesundheitsorganisation. Also, ich denke, Deutschland kann da schon auch ein bisschen, jetzt ganz konkret auch in Bezug auf Taiwan, aber sicherlich auch in Bezug auf Hongkong jetzt noch mal stärker das Momentum ergreifen, was man schon auch hat in einigen europäischen Ländern, und sollte da auch etwas aktiver bündeln und dann gewisse Zeichen – sei es Besuchsdiplomatie – umsetzen.
Das falsche "Wir-sind-von China-zu-abhängig-Narrativ"
Deutschlandfunk Kultur: Besuchsdiplomatie wie der Besuch der tschechischen Delegation auf Taiwan, der hat ja in Peking mächtigen Ärger ausgelöst. Jetzt wird man ja vielleicht auch sehen können, ob es da nur beim Geschimpfe bleibt oder ob es auch wirtschaftliche Konsequenzen hat. Weil, es heißt ja immer, wir sollten China vielleicht nicht zu sehr verärgern, weil, das kann die Wirtschaftsbeziehungen negativ beeinflussen.
Shi-Kupfer: Das ist aber natürlich auch nur eine Seite dieses Narratives wirtschaftliche Abhängigkeit. Zum einen muss man sagen, das ist im Falle Deutschlands natürlich vor allen Dingen eine bestimmte Branche, die Autoindustrie, die von China massiv abhängig ist. Es gibt andere Branchen, die haben sehr viel früher, sehr viel stärker diversifiziert oder sind da wesentlich weniger abhängig. Damit ist die Frage: Wollen wir uns en gros davon so – sage ich mal – dann auch beeinflussen lassen?
Und zum anderen aber auch, was diese Branche angeht, und ganz grundsätzlich, China ist ja auch abhängig von Europa oder von Investitionen, die auch aus Europa kommen, die auch in China natürlich Arbeitsplätze bedeuten. Das ist ja nicht nur eine einseitige Abhängigkeit. Und ich glaube, man sollte sich zumindest nicht von diesem Wir-sind-von China-zu-abhängig-Narrativ, was so nicht stimmt aus meiner Sicht, man sollte sich da nicht zu sehr in den Optionen beschränken lassen, die man China gegenüber signalisiert. Das ist ja immer der Anfang. Aber natürlich muss man dann eben auch bereit sein, in einzelnen Branchen ganz konkret wirtschaftspolitisch auch allmählich zu diversifizieren, um dann auch den Handlungsspielraum noch mal zu vergrößern, den man natürlich dann auch braucht.
Taiwan stärken
Deutschlandfunk Kultur: So ähnlich hat der Autor Alexander Görlach diese Woche in unserem Programm argumentiert, der gerade ein Buch über Hongkong herausgebracht hat. Der sagt: Wenn die freie Welt sich nicht klar gegen das Vorgehen Chinas in Hongkong positioniert, dann können auch andere Demokratien in der Region fallen, zum Beispiel auch Taiwan. – Was sollte Deutschland jetzt konkret für Taiwan tun – im Konzert mit der EU oder vielleicht auch allein – Taiwan diplomatisch anerkennen?
Shi-Kupfer: Ich glaube, bevor das ein Thema sein könnte, gibt es schon noch eine Menge von anderen Maßnahmen, die Deutschland eben gerade auch als EU-Ratspräsident tun kann. Ich glaube, zwei wichtige Punkte wären, zum einen die Aufnahme Taiwans in die Weltgesundheitsorganisation mit voranzutreiben, das ist ein wichtiger Beitrag, den Taiwan geleistet hat jetzt auch im globalen Kontext der Bekämpfung von Covid-19. Das wäre natürlich schon auch ein wichtiger Durchbruch für eine stärkere Anerkennung Taiwans als Akteur in der internationalen auch politischen Gemeinschaft.
Zum anderen denke ich schon, dass man jetzt durch wirklich auch relativ hochrangige Besuchsdelegationen signalisiert: Wir nehmen Taiwan schon auch als politischen Gegenüber wahr, als jemanden, mit dem man eben über Dinge auch ganz anders, sehr viel besser kommunizieren kann. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt. Und ein weiterer, den ich noch hinzufügen möchte ist, schon auch mal – Stichwort Diversifizierung, Lieferketten – zu überlegen, auch mit Taiwan zusammen Initiativen, die ja Japan beispielsweise angestoßen hat, jetzt auch im südostasiatischen Raum, also, was dort Standorte von beispielsweise Batterieproduktion oder auch Chips angeht. Also, das mit Taiwan zusammen als Vermittler, als Akteur, was diese grundsätzliche Verlagerung, dann eben auch weg von China in andere Länder, dass man das auch gemeinsam mit Taiwan planen und auch voranbringen könnte.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.




