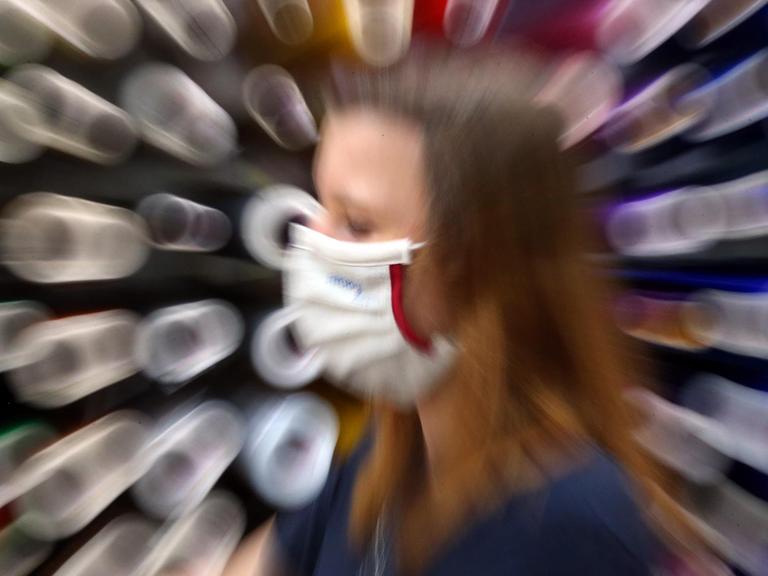Stefan Sell, geboren 1964, ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialforschung an der Hochschule Koblenz. Er ist ausgebildeter Krankenpfleger, hat das Arbeitsamt in Tübingen geleitet und war im Kanzleramt als Referent für Arbeitsmarktpolitik zuständig.
"Viele werden abgehängt"
29:30 Minuten

Die Coronakrise hinterlässt tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Betroffen sind vor allem Soloselbstständige und Geringqualifizierte im Dienstleistungssektor. Auch Ausbildungsplätze werden gestrichen. Viele Jugendliche könnten den Anschluss verlieren.
Seit dem Beginn der Coronakrise ist die Arbeitslosigkeit stark gestiegen, über 600.000 Jobs sind verloren gegangen. Zwar hat sich die Lage inzwischen etwas beruhigt, vor allem die Industrie hat sich dank staatlicher Überbrückungshilfen und Kurzarbeitergeld stabilisiert. Doch für eine Entwarnung sei es zu früh, warnt der Sozialforscher Stefan Sell. Vor allem kleine Firmen und Soloselbstständige hätten wenig Reserven und könnten Einnahmeausfälle nicht lange kompensieren. Vielen Firmen drohe die Insolvenz. "Dort verfestigen sich jetzt die Beschäftigungsprobleme."
Sorge bereitet dem Sozialwissenschaftler auch, dass sich durch die Coronakrise die Berufsperspektiven vieler Jugendlicher verschlechterten, weil Betriebe Ausbildungsplätze gestrichen hätten. Im Einzelhandel, bei Hotels und Gaststätten seien die Rückgänge dramatisch. Jugendliche, die jetzt ihren Job verlören oder keinen Ausbildungsplatz bekämen, würden schnell den Anschluss verpassen. "Die werden dann abgehängt", warnt Sell.
Er begrüßt, dass die Bundesregierung den Zugang zu Hartz-IV-Leistungen erleichtert habe, um den finanziellen Absturz vor allem von Soloselbstständigen abzufedern. So wird inzwischen keine Vermögensprüfung mehr vorgenommen. Sell spricht sich auch dafür aus, den Hartz-IV-Satz um 100 Euro zu erhöhen.
Eine vollständige Umstellung der sozialen Absicherung lehnt er dagegen ab. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie es jetzt in Deutschland in einem dreijährigen Modellversuch erprobt werden soll, sei zwar für die Bezieher eine schöne Sache. Die Umstellung sei aber kompliziert, würde Jahrzehnte dauern und koste viel Geld. Und viele Fragen seien ungeklärt. Sollten andere Leistungen dann im Gegenzug gestrichen werden? Dann "wäre das ein gigantisches Verarmungsprogramm", warnt Sell. Sinnvoll sei dagegen, die sozialen Sicherungssysteme, etwa die Rentenversicherung, durch zusätzliche Steuergelder zu stabilisieren und dadurch drohende Altersarmut zu bekämpfen.
Das Gespräch mit Stefan Sell im Wortlaut:
Deutschlandfunk Kultur: Die Coronakrise und die Folgen für die Beschäftigten, für den Berufsalltag und den Arbeitsmarkt, das ist unser Thema heute in Tacheles. Ist das deutsche Beschäftigungswunder vorbei? Kehrt die Massenarbeitslosigkeit zurück oder haben wir das Schlimmste schon überstanden?
Darüber wollen wir reden, heute mit Stefan Sell. Er ist Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung an der Hochschule Koblenz. – Guten Tag, Herr Professor Sell.
Stefan Sell: Guten Tag, Herr Schröder.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Professor Sell, die Wirtschaftsleistung ist seit dem Ausbruch der Coronakrise um knapp zehn Prozent in Deutschland eingebrochen. 600.000 Erwerbstätige weniger, das ist der größte Rückgang seit der Wiedervereinigung. Das sagen uns die Statistiker. – Als wie dramatisch schätzen Sie die Lage ein?
Sell: Als wir im März den Lockdown hatten und alles runtergefahren wurde, da wurde in den Wirtschaftswissenschaften intensiv diskutiert, was da jetzt als Krise auf uns zukommt. Am Anfang gab es eine – in Anführungsstrichen – optimistische Variante, das heißt: Wir stürzen stark ab, aber dann, in relativ kurzer Zeit bis zum Jahresende, geht das dann wieder nach oben. Das waren die Erfahrungen, die wir gemacht haben in der letzten großen Krise, in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009. Da hatten wir ja auch einen – allerdings von der Größenordnung gar nicht mehr vergleichbar – starken Einbruch. Und dann ging es schon im dritten und vierten Quartal wieder auf die alten Werte hoch, weil die Weltwirtschaft wieder anzog.
"Wir werden eine längere Rezession bekommen"
Dieses Modell hatte man übertragen. Dann wurde man im Laufe der letzten Monate aber unsicher, weil wir einen ganz entscheidenden Unterschied zur Finanz- und Wirtschaftskrise haben. Damals war vor allem die Industrie betroffen. Wir hatten in der Spitze zum Beispiel 1,4 Millionen Kurzarbeiter, überwiegend in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, der Chemie. Und als die Aufträge wieder anzogen, wurde das dann schnell wieder abgebaut.
Diesmal sind ja Bereiche betroffen, die damals überhaupt nicht eingeschränkt wurden, nämlich vor allem die Dienstleistungen – Gastronomie, Einzelhandel usw. Das hat dann die Prognosen verändert, sodass man zwischenzeitlich davon ausging: Wir werden also eine längere Rezession bekommen.
Deutschlandfunk Kultur: Die Bundesagentur für Arbeit sagt mit Blick auf die Juli-Zahlen: "Das Schlimmste ist eigentlich, wenn wir nur auf die Coronakrise schauen, vorüber." – Sind Sie da auch so optimistisch? Geben das die Zahlen her? Die Effekte des Lockdowns, des Ausbruchs der Krise, die haben wir schon überwunden?
In der Spitze acht Millionen Menschen in Kurzarbeit
Sell: Wir haben zurzeit in den letzten drei, vier Monaten über 630.000 Arbeitslose coronabedingt mehr. Und jetzt betone ich: "registrierte" Arbeitslose, die also auch in den Statistiken auftauchen. Denn gleichzeitig haben wir eine viel größere faktische Arbeitslosigkeit. Die wird nur verdeckt dadurch, dass immer noch eine bislang in der Wirtschaftsgeschichte unseres Landes unvorstellbare Zahl an Menschen, an Arbeitnehmern in Kurzarbeit sind. Wir hatten in der Spitze über acht Millionen Menschen in Kurzarbeit. Nach Schätzungen des IFO-Instituts haben wir im vergangenen Monat, im Juli immer noch 5,6 Millionen Menschen in Kurzarbeit gehabt.
Also, das zeigt ja, dass sozusagen durch dieses Auffanginstrument der Kurzarbeit faktische Arbeitslosigkeit überbrückt wird.
Deutschlandfunk Kultur: Jetzt ist ja die Frage: Wer ist am stärksten davon betroffen? Sie haben gesagt, "anders als zu Zeiten der Finanzkrise, wo die Industrie vor allem betroffen war, trifft es jetzt auch den gesamten Dienstleistungsbereich". Aber wir sehen, auch die Autoindustrie ist stark betroffen – Kurzarbeit auch bei VW, bei Daimler etc. Auch da weiß man nicht, wie schnell ist die Krise vorüber. – Also zieht sich das nicht doch durch alle Bereiche?
Sell: Wer waren denn die ersten großen Verlierer, die also arbeitsmarktlich wirklich ins "Bergfreie" geschubst wurden, wie man im Ruhrgebiet sagen würde? Das waren schon im März über 330.000 Mini-Jobber, also geringfügig Beschäftigte, vor allem in der Gastronomie, im Hotelbereich, im Einzelhandel, die also als erste auf die Straße gesetzt wurden. Das ist das Problem. Während jetzt die Beschäftigung in den Industriebereichen sich stabilisiert – manche Optimisten sagen, es wird jetzt wieder aufwärtsgehen,– haben wir große Bereiche der Dienstleistung, und dort vor allem, wo Soloselbstständige unterwegs sind, deren Geschäftsgrundlage, deren Existenz weggerissen wurde aufgrund der Einschränkungen, die ja teilweise immer noch gelten. Dort verfestigen sich jetzt die Beschäftigungsprobleme.
Soloselbstständige können Ausfälle kaum überbrücken
Das muss uns auch sehr große Sorge machen, weil das eben oftmals Existenzen sind, die kaum oder keine Rücklagen haben und die längere Zeiten der Beschäftigungslosigkeit auch schwer überbrücken können.
Deutschlandfunk Kultur: Soloselbstständige haben Sie genannt. Man kann auch noch Leiharbeiter erwähnen. Das sind diejenigen, die jetzt auch als Erstes ihren Job verlieren, Menschen mit befristeten Verträgen, Werkverträgler. Also kann man sagen, die Coronakrise verschärft die Spaltung auf dem Arbeitsmarkt, macht sie noch deutlicher?
Sell: Die Leiharbeiter, die Werkvertragsarbeitnehmer, das sind die flexiblen Belegschaftsschichten. Und diese zweite Belegschaftsschicht, die in einigen Unternehmen zehn, zwanzig, aber auch dreißig Prozent der Beschäftigten ausmacht, die dient der Stabilisierung der Beschäftigungsverhältnisse der Insider in diesen Unternehmen, die meistens dann auch noch tariflich gut abgesichert sind, betriebliche Sozialleistungen bekommen.
Die haben jetzt ihre Funktion erfüllt, sage ich jetzt mal so ganz technisch kalt, dass man sich von ihnen mit relativ wenig Kosten schnell und effektiv trennen kann.
Deutschlandfunk Kultur: Die Bundesregierung steuert ja jetzt vor allem mit kurzfristigen Maßnahmen dagegen. Das Kurzarbeitergeld haben Sie genannt. Überbrückungshilfen kommen dazu. Die Frage ist: Wie lange reicht diese Brücke? Kann sie tatsächlich wie 2008/2009 helfen, dass Unternehmen, die eigentlich gesund sind, aber nicht so viele Rücklagen haben, um die Krise zu überstehen, hier auch durch die Corona-Krise durchzukommen?
Kurzarbeit kann Beschäftigung stabilisieren
Sell: Kurzfristig und vielleicht auch noch mittelfristig, also, wenn wir über einige Monate reden, ist die Kurzarbeit ein nicht nur volkswirtschaftliches, sondern auch gesellschaftspolitisch total gutes, innovatives Instrument, denn es stabilisiert bestehende Beschäftigungsverhältnisse.
Deutschlandfunk Kultur: Aber?
Sell: Es kann aber nur eine Brücke bauen über ein Tal, was ein absehbares Ende hat. Also wenn wie 2009 nach ein paar Monaten die Konjunktur wieder anspringt, dann ist die Kurzarbeit genau das richtige Instrument. Jetzt haben wir aber gerade dieser Tage erfahren, dass die Bundesregierung – auch auf massiven Druck nicht nur der Gewerkschaften, sondern auch der Wirtschaft – das Kurzarbeitergeld bis auf 24 Monate verlängern will.
Deutschlandfunk Kultur: Kritiker sagen ja, da werden auch Unternehmen durchgepäppelt, die eigentlich schon gar nicht mehr rentabel sind, deren Geschäftsmodell gar nicht mehr funktioniert. – Ist das eine reale Gefahr, dass wir hier Geld verpulvern für Unternehmen, die besser vom Markt verschwinden würden?
Sell: Es mag im Einzelfall solche Unternehmen geben. Aber ob das wirklich ein Flächenproblem ist, das wage ich zu bezweifeln. Und der entscheidende Punkt ist: Der Bundesarbeitsminister hatte ja eigentlich angedacht, die Verlängerung und auch die generöse Erstattung der Sozialbeiträge zu verknüpfen mit einer Verpflichtung, dass dann die Kurzarbeiter qualifiziert werden in dieser Zeit. Das wäre ja sozusagen eine offensive Verknüpfung. Das wäre sicherlich ein klares Signal gewesen, dass man hier nicht nur eine Art Stilllegungsprämie fortschreibt.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben die Soloselbstständigen genannt, die wenig Rücklagen haben, die also auch schon zwei, drei, vier Monate mit weniger Umsätzen nur schwer überstehen können. Die profitieren nicht von der Kurzarbeit. – Wie müsste denen denn geholfen werden? Oder steht uns da unweigerlich eine große Pleitewelle in den nächsten Monaten bevor?
Sell: Es gibt Soloselbsständige, die unheimlich viel Geld verdienen. Denken Sie an die IT-Berater oder so. Aber in diesen personenbezogenen Dienstleistungen haben wir sehr viele prekäre Existenzen, die jetzt noch nicht mal eine eigene Alterssicherung finanzieren können aus ihren kargen Honoraren und die auch kaum finanzielle Rücklagen haben. Da haben wir jetzt ein richtiges Dilemma.
Erleichterter Zugang zu Hartz-IV-Leistungen
Denken Sie zum Beispiel an Soloselbstständige, die im Messebau unterwegs waren und die viele Aufträge hatten – bis der Lockdown kam. Die sind von einem Moment auf den anderen von Hundert auf Null gefahren worden durch staatliche Anordnungen. Die haben gar keine Möglichkeit, auszuweichen oder Alternativen zu finden. Und eigentlich, nach dieser Logik, hätte man sozusagen diese Selbständigen stabilisieren müssen, indem man ihnen das ausfallende Honorar bezahlt. Das hat der Staat nicht gemacht und auch nicht machen können wahrscheinlich. Also hat der Staat zu einer Maßnahme gegriffen. Er wollte wenigstens die Existenz sichern, indem er den Zugang für diese Menschen in das Hartz-IV-System, also in die Grundsicherung, deutlich erleichtert hat, indem die Hürden, die genommen werden müssen, abgesenkt werden. Aber das ist natürlich nur eine partielle Antwort auf die Notlage.
Deutschlandfunk Kultur: Muss man hier nicht dann schlicht und nüchtern, wenn es auch kaltherzig erscheint, sagen: "Diese Unternehmen sind schwer zu retten."
Sell: Ja. Anders formuliert: Sie können große Unternehmen wie Lufthansa oder TUI mit gewaltigen Beträgen retten. Das kann man kritisch sehen, aber da gibt’s auch viele Argumente dafür. Aber diese Hunderttausenden von völlig heterogenen Geschäftsmodellen, die wir hier haben, das ist für den Staat wirklich sehr, sehr schwer irgendwie auf die Reihe zu bekommen.
Insofern müssen wir wohl leider davon ausgehen, dass es dort zahlreiche Existenzen gibt, die über die Wupper gehen werden.
Deutschlandfunk Kultur: Müssen wir davon ausgehen, dass wir in nächster Zeit – Corona wird ja so schnell nicht verschwinden –, dass wir mit einer dauerhaft höheren Arbeitslosigkeit leben müssen?
Bis zu 60 Prozent weniger Ausbildungsplätze
Sell: Theoretisch müsste dieser Effekt eintreten, dass wir eine höhere als sonst zu erwartende Arbeitslosigkeit auch für die nächsten zwei, drei Jahre haben werden. Bei der Ausbildung sehen wir jetzt Rückgänge im Durchschnitt von zehn Prozent, aber in vielen Dienstleistungsberufen haben wir teilweise dreißig bis sechzig Prozent Rückgänge bei Ausbildungsplätzen in bestimmten Branchen.
Aber die Leute, die jetzt in diesem Moment coronabedingt dann keine Ausbildung angetreten haben oder die jetzt ihren Job verloren haben und die nächsten Monate nicht in einen neuen reinkommen, die werden dann, das wissen wir aus der Vergangenheit, leider oftmals abgehängt. Das heißt, selbst wenn die Beschäftigung dann wieder anzieht, werden die schlichtweg vom Arbeitsmarkt nicht aufgenommen oder vom Ausbildungsmarkt. Die bleiben dann erst mal als individuelle, aber eben auch als gesellschaftlich relevante Gruppe als Opfer dieses Einbruchs – selbst, wenn er nur ein Jahr dauern sollte – übrig.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Sell, die Coronakrise verändert ja auch ganz konkret unseren Arbeitsalltag. Viele arbeiten seit Monaten im Homeoffice, von zuhause aus. Viele sagen: "Endlich, endlich ist ja möglich, was jahrelang schwierig war." "Endlich" mehr Homeoffice, mehr mobiles Arbeiten?
Im unteren Einkommensbereich spielt Homeoffice keine Rolle
Sell: Ich spiele jetzt hier an dieser Stelle gern mal den Spielverderber und werde Ihnen sagen: Das, was wir gerade am Beispiel Homeoffice erleben, wird uns zweierlei Dinge lehren. Erstens: Auch Homeoffice ist eine sozial hoch selektive Angelegenheit. Wir wissen aus den Untersuchungen schon vor Corona, aber jetzt verstärkt auch in der Krise, dass, je höher der Bildungsgrad, desto höher ist nicht nur die Wahrscheinlichkeit, sondern auch der tatsächliche Einsatz und die Inanspruchnahme von Homeoffice. Bei denjenigen, die im unteren Einkommensbereich sind, spielt Homeoffice so gut wie keine Rolle.
Homeoffice ist für einen Müllwerker, für eine Pflegekraft, für eine Verkäuferin im Einzelhandel, für einen Polizeibeamten schlichtweg eine Phantomdiskussion. Das ist der erste Punkt.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Professor Sell, das versteht sich ja von selber, dass man auch Autos am Fließband montieren muss und nicht von zu Hause aus dem mobilen Homeoffice heraus. Aber für diejenigen, wo das möglich ist, ist das ja ein Fortschritt. Viele sagen auch: "Das erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Arbeiten". Die Vorteile liegen doch auf der Hand.
Sell: Auch hier ein kritischer Einwand: Wir werden sehen, und das schält sich auch in den neueren Umfragen heraus, dass die Menschen schon begreifen, es hat zwar Vorteile, ich habe auch umweltpolitische Vorteile, Pendelzeit, die verkürzt wird, Vereinbarkeit. Aber so einfach ist es dann in der Praxis nicht. Und die Sehnsucht nach dem Betrieb, nach dem gemeinsamen Arbeiten, die ist sehr stark und die wird auch wieder stärker werden, sodass sich das Pendel dann irgendwann in der Mitte treffen wird.
Wir werden einen stärkeren Einsatz bei einem Teil der Belegschaften sehen, was mobiles Arbeiten zu Hause angeht. Aber das wird sich wieder zurückbilden von dieser Euphorie, die wir jetzt teilweise haben …
Rechtsanspruch auf Homeoffice?
Deutschlandfunk Kultur: Herr Professor Sell, die Frage ist ja auch: Wie muss das geregelt werden? Viele Beschäftigte merken ja jetzt auch, das ist nicht nur ein Traum, von zu Haus aus zu arbeiten, sondern hat viele Nachteile – Entgrenzung von Arbeit und Zeit. Man kann nicht mehr genau trennen. Wo endet der Job? Wo beginnt das Privatleben? Viele arbeiten zu Hause vielleicht am Küchentisch, haben kein Arbeitszimmer. – Muss das geregelt werden? Muss auch zum Beispiel geregelt werden, wie wird die Arbeitszeit erfasst? Müssen Beschäftigte hier auch vor Überforderung geschützt werden?
Sell: Ja, natürlich. Diese Diskussion hatten wir ja interessanterweise kurz vor Corona schon sehr intensiv. Ich darf daran erinnern, der Bundesarbeitsminister Heil hatte im Frühjahr des vergangenen Jahres angeregt, einen Rechtsanspruch auf Heimarbeit einzuführen – wohlgemerkt für die Arbeitnehmer – und eine Beweislastumkehr zu Ungunsten der Arbeitgeber. Die sollten also das nur verweigern können, wenn sie begründen können, warum das nicht möglich ist.
Deutschlandfunk Kultur: Aber die konkrete Frage ist ja: Was muss da geregelt werden? Oder kann man das den Beschäftigten und dem Arbeitgeber selbst überlassen, dass die das untereinander ausmachen?
Schutz vor Ausbeutung
Sell: Na ja, das eine sind die notwendigen Regulierungen, um die Arbeitnehmer auch vor einer Überausbeutung zu schützen, die immer wieder beobachtet wird, dass die Arbeitszeit verlängert wird und so weiter. Das heißt, sie müssten auch im Lichte des Urteils des EuGH, was die Arbeitszeiterfassung angeht, müssten sie natürlich die Arbeitszeit zu Hause erfassen. Dann wirds dann aber schwierig. Das wird viele Unternehmen, das kann man auch positiv sehen, vor große Herausforderungen stellen – Vertrauensarbeitszeit et cetera pp.
Aber auf der anderen Seite würden enorme Kosten auf Arbeitgeber zukommen, zum Beispiel die Ausstattung eines Heim-Arbeitsplatzes. Dann muss der auf einmal diesen teilweise wichtigen, aber teilweise auch diskussionsbedürftigen deutschen Arbeitsschutzvorschriften, was die Ausstattung von Arbeitsplätzen angeht, entsprechen. Das werden sehr große Investitionen sein. Wir dürfen ja nicht vergessen, Homeoffice jetzt in der Krise wurde als Kriseninstrument, als Notlösung, als Übergangslösung gemacht und oftmals unterhalb der schon heute vorhandenen Regulierung.
Also, das allein, dieser Regulierungsbedarf und die Regulierungsnotwendigkeit wird sozusagen am Ende die dann faktischen Ausbreitungen von Homeoffice tendenziell – so meine Hypothese – begrenzen auf die Arbeitnehmergruppen, die sowieso schon auch vor Corona aufgrund ihres Mangelcharakters an den Arbeitgeber die Forderung auch gestellt haben, nicht dauernd, aber zumindest tageweise auch zu Hause arbeiten zu können. Dem wird man nun stärker entgegenkommen.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Professor Sell, weil jetzt viele unverschuldet in die Arbeitslosigkeit rutschen, viele gleich auch auf Hartz IV angewiesen sein könnten, hat die Bundesregierung einige Maßnahmen beschlossen, damit der Absturz nicht zu hart ist. Zum Beispiel ist die Vermögensprüfung für Hartz-IV-Bezieher ausgesetzt. Ist das pragmatisch oder nicht schon auch ein Eingeständnis, dass Hartz-IV eigentlich nicht zumutbar ist in der Form?
Sell: Gut ist, dass man erkannt hat, man muss die bestehenden Zugangshürden in die vorhandene Grundsicherung in unserem Land absenken. Und das sind ja nicht nur die noch 432,00 Euro Regelsatz für einen Alleinstehenden im Monat, sondern im Durchschnitt 397,00 Euro Mietkosten, die übernommen werden, und die Krankenversicherung wird finanziert vom Job-Center, das ist ja das Paket, dass man absenkt.
Da hat man nicht nur den Verzicht auf eine Vermögensüberprüfung gemacht, die sehr arbeitsaufwendig ist, sondern man hat vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, man hat verzichtet auf eine Anrechnung von zu hohen Mieten. Denn wir haben ja die Situation in der Vergangenheit, im vergangenen Jahr: Es werden ja nur die Mietkosten übernommen, die "angemessen" sind. Das hat dazu geführt, dass die Hartz-IV-Empfänger im vergangenen Jahr über 600 Millionen Euro – das muss man sich mal vorstellen – aus ihrem kargen Regelsatz für Mietkosten bezahlen mussten, die vom Amt nicht übernommen wurden.
Die Grundsicherung armutsfest gestalten
Auch da hat man drauf verzichtet. Also, man ist den Leuten ja entgegengekommen.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Professor Sell, da ist ja jetzt die Frage: Wenn das in der Krise gut ist, warum sollte man das dann wieder abschaffen? Oder sollte man das dann nicht generell einführen? Auch in weniger krisenhaften Zeiten geraten Menschen unverschuldet in Arbeitslosigkeit.
Sell: Diese Maßnahmen hat man gemacht, um den Jobcentern Bürokratiearbeit zu ersparen und schnell helfen zu können. Es berührt aber Grundsatzfragen. Und die 5,9 Millionen Hartz-IV-Empfänger, die wir in diesem Land haben, stellen zu Recht die Frage, ob sie dann nicht auch so entlastet und behandelt werden müssen.
Das Problem, was ich an dieser Stelle nur sehe, ist: Dann müssen wir jetzt – und das tut die Politik tatsächlich nicht – rauskommen aus einem Kriseninstrument und darüber diskutieren: Wie können wir die vorhandene Grundsicherung armutsfester gestalten?
Deutschlandfunk Kultur: Was schlagen Sie vor?
100 Euro mehr für Hartz-IV-Empfänger?
Sell: Im April, im Mai auf dem Höhepunkt der negativen Auswirkungen haben nicht nur Sozialverbände, sondern auch Wissenschaftler wie ich gefordert, dass man wenigstens vorübergehend den Hartz-IV-Empfängern 100 Euro mehr im Monat zahlt. Denn die waren ja auch sehr, sehr hart betroffen von den Kostenanstiegen usw.
Die Regelsätze, die ja jetzt auch angehoben werden um sensationelle sieben Euro für einen Alleinstehenden ab dem kommenden Jahr, die sind definitiv zu klein gerechnet. Aber dafür bräuchten wir eine systematische Diskussion über Hartz IV, die im vergangenen Jahr – denken Sie an die Vorschläge von Robert Habeck von den Grünen, teilweise angedeutet – angestoßen wurde, aber letztendlich im Sand verlaufen ist.
Deutschlandfunk Kultur: Seit langem wird ja auch schon darüber diskutiert: Sollte es Sanktionen geben? Sollte das Existenzminimum gekürzt werden? In diesen Tagen verstärkt sich eine Diskussion, ob man da nicht grundsätzlich umsteuern muss – Stichwort "bedingungsloses Grundeinkommen", also ein Grundeinkommen für alle ohne Bedingungen, ohne Sanktionen, ohne Einkommensprüfung. – Würden Sie das befürworten, dass das bedingungslose Grundeinkommen nochmal genauer unter die Lupe genommen wird?
Sell: Also, ich würde auch hier eine Kompromissposition versuchen zu formulieren. Es wurde ja schon mal in einem Land, was auch sehr wohlhabend ist, darüber abgestimmt, ob so etwas eingeführt werden soll. Im Juli 2016 gab es eine Volksabstimmung in der Schweiz. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Abend. 23 Prozent, das waren überraschend viele, haben dafür gestimmt, die große Mehrheit dagegen.
Schweizer lehnen bedingungsloses Grundeinkommen ab
Und dann wurden Leute befragt nach der Abstimmung, warum sie dagegen gestimmt haben. Da ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben. Da hat einer gesagt: "Ja, er hätte da natürlich dagegen gestimmt, weil, die Zeit ist noch nicht reif." – Der Man ist pragmatisch gewesen. Der hat erkannt, dass in der jetzigen Situation ein Systemwechsel zum bedingungslosen Grundeinkommen aus vielerlei Hinsicht, nicht nur, was die Finanzierung angeht, sondern auch, was die bestehenden sozialen Sicherungssysteme angeht, schwer bis überhaupt nicht umsetzbar ist.
Deutschlandfunk Kultur: Warum?
Sell: Weil sozusagen sie enorme Finanzvolumina aufbringen müssten zur Finanzierung dieses Instruments und man nicht argumentieren kann, wie viele Befürworter: "Ja, wir geben doch schon eine Billion Euro für Sozialleistungen aus, dann schichtet man das einfach um". Da sind die ganzen Krankenversicherungsleistungen, die Pflegeversicherung, die Hilfe für mehrfach Schwerstbehinderte drin. Da sind ganz viele Leistungen, auf die wir doch wohl nicht verzichten wollen. Ansonsten wäre das ja ein gigantisches Verarmungsprogramm. Das heißt, wir bräuchten enorme Finanzvolumina, von denen ich nicht sehe, wo und wie sie von wem organisiert werden sollen.
Deutschlandfunk Kultur: Jetzt sagen viele, Herr Professor Sell: "Auf lange Sicht ist der sozialversicherungspflichtige Job in Vollzeit, vierzig Jahre lang" nicht mehr unbedingt das Maß der Dinge. Gerade durch die Digitalisierung kommen auch flüchtigere Arbeitsverhältnisse auf uns zu – ohne soziale Absicherung. Müssen wir da nicht darüber nachdenken, ob unser soziales System noch die Zukunft ist oder ob wir da nicht doch über ein steuerfinanziertes Grundfinanzierungsmodell nachdenken müssen.
Sell: Herr Schröder, diese Diskussion hatten wir doch schon in den 80er-Jahren und in den 90er-Jahren.
Deutschlandfunk Kultur: Das muss ja nicht heißen, dass sie falsch ist.
Sell: Nein. Aber man muss, glaube ich, auch bei aller Berechtigung darüber nachzudenken, welchen Formenwandel gibt es, auch zur Kenntnis nehmen, dass wir in den vergangenen Jahren trotz der Digitalisierung, Roboterisierung eben nicht diese Beschäftigungseinbrüche hatten.
Schlechte Bezahlung in Dienstleistungsberufen
Was wir haben, und das ist mein Punkt, der mich eher umtreibt, ist: Wir haben nicht weniger Beschäftigung, auch weniger bezahlte Beschäftigung, aber wir haben einen Formenwandel, der höchst bedenklich ist, innerhalb der Beschäftigung. Wir haben nämlich neben einem tatsächlich starken Wachstum auch bei den gut bezahlten Jobs in der Industrie, in der öffentlichen Verwaltung und so weiter, eben diesen starken Anstieg gerade im Dienstleistungsbereich und darunter gerade bei sehr, sehr wichtigen Dienstleistungsberufen, nicht nur Pflege und Betreuung, sondern auch Lkw-Fahrer, Verkäuferinnen und so weiter, wo die Menschen, die dort arbeiten, abgehängt worden sind von der recht guten Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung. – Das müssen wir korrigieren. Sozusagen da müssen wir wieder zu einer deutlichen Aufwertung der Entlohnung, aber auch der Arbeitsbedingungen in diesem unteren Bereich kommen. Ich glaube, dass mit diesem gezielten Ansatz mehr gewonnen würde.
Deutschlandfunk Kultur: Wie wollen Sie denn das erreichen? Für die Aufwertung von Jobs, für eine bessere Bezahlung sind die Tarifparteien zuständig und offenbar bislang nicht in der Lage. Die Gewerkschaften sind vielleicht auch zu schwach, um das durchzusetzen. Also, wie wollen Sie das erreichen?
Sell: Was wir natürlich in diesem unteren Bereich sehen, ist ein gewaltiges Versagen der dafür zuständigen Tarifparteien, also Gewerkschaften und Arbeitgeber. Wir haben ja auch eine Tarifflucht der Arbeitgeber in diesen Bereichen. Denken Sie an den Einzelhandel und so weiter.
Wenn man eine gezielte Strategie bevorzugt, dann müssten wir uns ganz klar darüber verständigen, dass wir in bestimmten Branchen, in denen das Arbeitsmarktungleichgewicht zu Ungunsten der Arbeitnehmer so vorangeschritten ist, wie wir das heute in der Pflege, im Einzelhandel haben, dann muss man auch tatsächlich ausnahmsweise über staatliche Eingriffe wie Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen reden und streiten. Die müssen wir möglich machen.
Und da könnte man natürlich schon was erreichen im Sinne einer konkreten Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen.
Wachsende Altersarmut
Das ändert aber nichts daran, dass ich unabhängig davon der Meinung bin, dass das von Ihnen angesprochene Ziel, die soziale Sicherung in unserem Land generell ein Stück weit oder stärker wegzunehmen von der reinen Anbindung an Arbeit und vor allem an Lohnarbeit und dann auch noch begrenzt bis zur Beitragsbemessungsgrenze, dass das ein richtiger Ansatz ist – spätestens angesichts der steigenden Zahl an altersarmen Rentnern im unteren Bereich, die also unterdurchschnittlich verdient haben ihr Leben lang. Da wird sich von alleine die Notwendigkeit einer stärker steuerfinanzierten Sicherung stellen.
Da kann man dann Grundgedanken des bedingungslosen Grundeinkommens, nämlich eine gewisse Armutsfestigkeit der Absicherung, nutzen, um gezielt in unserem bestehenden System zu verbessern.
Deutschlandfunk Kultur: Schon jetzt wird ja die Rente zum Beispiel ein Drittel über Steuermittel finanziert. Wäre es da nicht konsequenter dann zu sagen, da schalten wir ganz um?
Sell: Dieses immer genannte ein Drittel der Rentenausgaben aus Steuermitteln, da wird immer so getan, als wenn das ein Zuschuss ist, den man machen muss, weil die Beiträge aus den Löhnen nicht reichen. Der größte Teil der Bundeszuschüsse sind Erstattungen für sogenannte versicherungsfremde oder nicht versicherungsadäquate Leistungen. Also, wenn man den Müttern beispielsweise Erziehungszeiten und auch theoretisch den Vätern zuschreibt von drei Jahren, dann muss das aus Steuermitteln bezahlt werden. Dafür ist auch der Bundeszuschuss gedacht. Also, das muss man, glaube ich, an dieser Stelle einschränkend anmerken.
Umstellung würde vierzig, fünfzig Jahre dauern
Aber der zweite Punkt ist vollkommen der entscheidende und der richtige. Nur, wenn wir jetzt einen stärkeren Übergang zur Steuerfinanzierung haben, für den ich auch plädiere, dann muss man auf der anderen Seite aufpassen und das nicht vermischen mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir hatten das in den 80er-Jahren, denken Sie an Biedenkopf, der hatte auch eine steuerfinanzierte Grundrente vorgeschlagen, aber hat dann darauf hingewiesen: Der Preis dafür wäre dann, die bestehende Rentenversicherung abzuschaffen. Das müssten Sie auch machen. Nur, das Problem ist, was viele nicht sagen oder nicht wissen: Selbst wenn wir diese Entscheidung treffen würden, Herr Schröder, haben wir vierzig, fünfzig Jahre Übergangszeit. Denn all die Ansprüche, die die Menschen hier auf die gesetzliche Rentenversicherung sich erarbeitet haben im Beitragssystem, müssen in den nächsten vierzig, fünfzig Jahren refinanziert werden. Das heißt, wir haben eine Doppelbelastungsstruktur.
Ich kann ja nichts dafür, aber das sind verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsverhältnisse. Wenn ich nur daran denke, dann würde mir wirklich schwindelig werden bei der Frage einer Umsetzbarkeit eine solchen.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Professor Sell, jetzt gibt es dieses Projekt. 120 Menschen bekommen 1.200 Euro Grundeinkommen. Das DIW und andere Wissenschaftler wollen erforschen, welche Wirkung das hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, kann man sich diese Studie sparen.
Sell: Ja, also. Stellen Sie einfach die Frage: Was werden wir wissen nach diesen drei Jahren? Wir werden wissen, dass vielleicht viele der Teilnehmer sich besser fühlen, weil sie sich sicherer fühlen, weil sie eine andere Einkommensquelle noch zusätzlich haben. Ja. Aber wir werden definitiv bei dieser Anlage dieses Versuchs nicht herausbekommen, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen wirklich wirken würde. Dazu müssten Sie tatsächlich einen Systemwechsel machen in einer Region. Sie müssten alle Komponenten, die mit einem bedingungslosen Grundeinkommen verbunden werden, die müssten Sie in einem Experiment simulieren. Dann müssten eben dann auch die anderen Leistungen eingestellt werden. Jeder müsste das bekommen in dieser Region.
Also, Sie ahnen, glaube ich, schon, wenn Sie sich so etwas vorstellen, das wird sehr, sehr schwierig sein. Deswegen gibt es ja auch bislang weltweit noch kein Experiment in Annäherungsform, was den Anforderungen eines Experiments wirklich Genüge tun würde.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Professor Sell, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sell: Danke Ihnen, Herr Schröder.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.