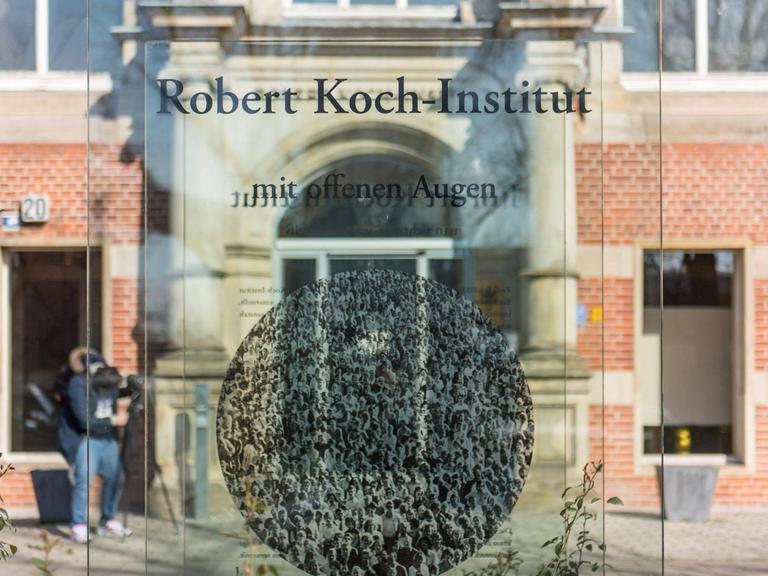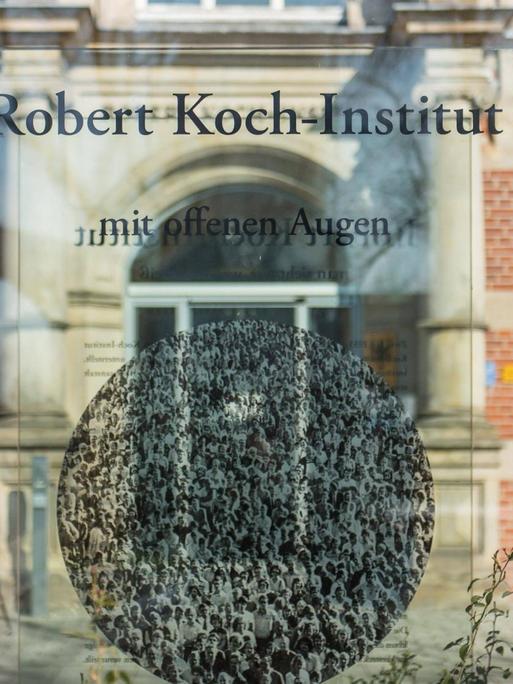Gerald Echterhoff forscht und lehrt als Professor an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Fach Sozialpsychologie. Er hat Psychologie in Köln, später in New York studiert, wo er auch promovierte. Weitere Stationen seiner akademischen Laufbahn waren die Universitäten Bielefeld und Bremen. Echterhoff ist Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.
Was das Coronavirus mit uns macht
28:12 Minuten

Panik oder Party? Corona bringt uns in ein Dilemma, sagt der Sozialpsychologe Gerald Echterhoff. Denn in der Not rücken wir eigentlich instinktiv zusammen. Doch jetzt ist räumliche Distanz gefordert. Das kostet Kraft und Disziplin. Schaffen wir das?
Die Coronakrise ist eine noch nie dagewesene Situation, sagt der Professor für Sozialpsychologie, Gerald Echterhoff. Sie stelle uns auch psychisch vor völlig neue Herausforderungen. Denn während die Menschen in Notzeiten normalerweise näher zusammenrücken, müssen sie nun räumliche Distanz üben, "was unseren sozial völlig in Fleisch und Blut übergegangenen Verhältensweisen total zuwiderläuft". Denn der Mensch sei "die ultrasoziale Spezies".
Um so wichtiger sei es, nur physisch auf Distanz zu gehen, nicht aber emotional, und miteinander in Kontakt zu bleiben. Dabei könne die Krise auch Chancen bieten: "Wollen wir vielleicht Chancen für soziales Experimentieren ergreifen, andere, neue Möglichkeiten der Kontaktaufnahme ausloten?"
"Unser übliches Verhaltensrepertoire gerät ins Schwimmen"
Die Krise bedeute natürlich enormen Stress, für den Einzelnen wie für die Gesellschaft. Es sei wichtig zu akzeptieren, dass "uns unser übliches Verhaltensrepertoire ins Schwimmen gerät." Geboten sei Toleranz sich selbst gegenüber und mit den ebenfalls gestressten und überlasteten Mitmenschen.
Dabei gebe es allerdings Grenzen, bei deren Überschreiten Strafen drohen sollten, sagt Echterhoff mit Blick auf die Diskussion über Ausgangssperren. Aus psychologischer Sicht gebe es eine große Trägheit, eingeübte Verhaltensmuster zu ändern. Doch "die Ereignisse rücken uns jetzt auf die Pelle".
Corona-Partys sieht der Sozialpsychologe als Abwerreaktion gegen Angst und Unsicherheit, auch als eine Form von Trotz gegen Einschränkungen von Freiheiten. Dabei sei auch ein gewisser Zynismus im Spiel.
Eine weitere Art, mit der Unsicherheit umzugehen, sei das Hamstern. Das sei eine Form von Aktionismus, es gebe den Menschen angesichts einer unsichtbaren Gefahr das Gefühl, "einfach mit Handlungen zu reagieren, weil das an anderen Stellen häufig jetzt so ist, dass wir gar nicht mehr wirklich handeln können, sondern dass das Unterlassen von Handlung gerade die Maßgabe in der aktuellen Krisensituation ist".
Das Interview im Wortlaut:
Deutschlandfunk Kultur: Was macht das Coronavirus mit uns? Darüber spreche ich nun mit dem Sozialpsychologen Gerald Echterhoff. Guten Tag.
Gerald Echterhoff: Ja, guten Tag.
Deutschlandfunk Kultur: Am heutigen Samstag stehen wir alle unter besonderer Beobachtung der Behörden. Die Bundesregierung will vom Verhalten der Bürger an diesem Wochenende abhängig machen, ob wegen Corona landesweit Ausgangssperren verhängt werden. Brauchen wir Zwang, um uns vernünftig zu verhalten?
"Es gibt natürlich eine Trägkeit"
Echterhoff: Belohnung und Bestrafung als Mittel der Verhaltensänderung, ich spreche jetzt als Psychologe, sind lange bekannt. Es ist sicherlich so, dass wir in dieser ganz besonderen, ungewöhnlichen Situation alle mit Anforderungen konfrontiert sind, die uns dazu anhalten, veranlassen, bekannte Verhaltensmuster, Routinen und Gewohnheiten zu ändern. Das ist ein träger Prozess. Es gibt da eine Trägheit aus psychologischer Sicht. Wenn wir Dinge sehr gut hoch überlernt haben, wenn sie zu Gewohnheiten werden, dann erfordert es sehr viel Aufwand, diese Gewohnheiten zu ändern.
Nun sind wir natürlich nicht nur trainierte Tiere wie die Ratten im Labyrinth. Vielen ist sicher die Situation schon seit Wochen verstandesmäßig bewusst. So langsam dämmert uns aber auch in unserer Lebenswelt, dass da Änderungen anstehen und dass sich da Dinge zuspitzen. Also, Psychologen, Psychologinnen unterscheiden zwischen einem eher analytisch-rationalen verstandesbezogenem und kühlem Verarbeitungsmodus und einem erlebnisnahen, wahrnehmungsnahen Verarbeitungsmodus.
Die Ereignisse rücken uns jetzt auf die Pelle auch auf der zweiten Ebene. Nachdem wir das vielleicht schon lange analytisch-rational verstanden haben, gibt es also jetzt Dinge, die die wir direkt wahrnehmen können. Ich muss nur ansprechen, völlig klar, die geschlossenen Läden, die leeren Spielplätze, die absonderlichen Verhaltensweisen von Menschen, die wir treffen, weil sie ja Distanz halten, was unseren sozial völlig in Fleisch und Blut übergegangenen Verhaltensweisen total zuwiderläuft. Also, wir merken, dass das ankommt, aber es gibt natürlich eine Trägheit.
Wir merken das, weil wir uns im Alltag auch immer wieder auf diese Situation neu einstellen müssen, immer wieder die Dinge, die passiert sind, in kurzer Zeit ins Bewusstsein rufen müssen und uns immer wieder neu auch kontrollieren müssen.
Natürlich, wenn da eine Trägheit ist, und es ist aus Sicht der Behörden oder der Politik und der Wissenschaftler und der Wissenschaft wichtig zu Verhaltensänderungen beizutragen, das sind eben Mittel, die der Bevölkerung so im Sinne von einer möglichen weiteren Einschränkungen als weitere Mittel vor Augen gestellt werden. Da mag sich mancher infantilisiert fühlen, dass wir dem Lehrmeister, der Behörden, des Staates, der Politik gegenüberstehen, der sagt: "Wenn ihr euch nicht ändert, dann müssen wir weitere Maßnahmen ergreifen".
Deutschlandfunk Kultur: Einige Maßnahmen sind jetzt ja schon angesprochen, nämlich weitgehende Ausgangsbeschränkungen in einigen Bundesländern. Vielleicht kommt das auch bald bundesweit. Kann man denn absehen, was eine flächendeckende Ausgangssperre für die Psyche des Einzelnen, aber auch für das gesellschaftliche Klima bedeuten würde?
"Eine noch nie dagewesene Situation"
Echterhoff: Das ist sicherlich eine noch nie dagewesene Situation. Es werden jetzt natürlich Krisensituationen aus der Geschichte herbei zitiert, wie eben auch die unmittelbare Nachkriegszeit, Vergleiche mit der Pandemie 1918. Da gibt’s natürlich niemanden mehr, der das erlebt hat und uns davon berichten kann. Also greift man auf diese vielleicht ein bisschen näherliegenden Dinge zurück. Aber wir sehen, da hat die Geschichte für uns in den letzten Jahrzehnten nichts wirklich zu bieten.
Deswegen haben wir natürlich eine völlig neuartige Situation. Das nehmen viele Menschen auch so wahr. Natürlich sind sie dabei, auch wenn sie das so verstehen, dauernd natürlich in ihrem Alltag mit den üblichen Dingen beansprucht. Da geraten einige Dinge durcheinander. Diese Maßnahmen laufen ganz klar menschlichen Grundbedürfnissen zuwider. Wie dem Bedürfnis nach sozialem Miteinander, Verbundenheit oder Kontakt, nach gemeinsam geteilten Erlebnissen und Emotionen, die wir häufig auch in physischer Co-Präsenz mit anderen erleben, aber auch dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Autonomie, Kontrolle oder Handlungsfähigkeit – im Englischen "agency".
Deutschlandfunk Kultur: In schweren Zeiten sind wir es ja eigentlich gewohnt zusammenzurücken – im übertragenen Sinne, aber durchaus auch im direkten Sinn. Genau das sollen wir jetzt ja nicht tun. Soziale Distanz ist das Gebot der Stunde. Erklärt das, warum es derzeit vielen schwer fällt, sich an die Vorschriften zu halten, weil das eben völlig konträr ist zu dem, was wir eigentlich so jetzt als Impuls machen möchten, nämlich nah beieinander sein, uns gegenseitig Mut zusprechen?
Distanz widerspricht unseren Grundbedürfnissen
Echterhoff: Was Sie gerade beschrieben haben, ist schon seit Jahrzehnten auch in der sozialpsychologischen Forschung bekannt, dass Menschen in Krisensituationen unter Unsicherheit, Ängstlichkeit zusammenrücken wollen, den Kontakt mit anderen suchen. Man muss dabei berücksichtigen, dass der Mensch unter all den Tieren die ultrasoziale Spezies ist. Ein Großteil des Erfolges der Spezies ist darauf zurückzuführen, dass wir uns miteinander austauschen, Kontakt haben, dass wir gemeinsam Probleme lösen, gemeinsam kleine und große Projekte machen. Die Zivilisation, wie wir sie kennen, ist undenkbar ohne eine hochgradige soziale Vernetzung und Sozialität.
Natürlich ist das jetzt vermutlich die erste Krise, die genau da Widersprüche auslöst. Angehörige der älteren Generation, die es noch erlebt haben, an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückdenken, da hat man sich eben auch unterstützt. Wir kennen auch vielleicht Situationen – ich selbst war in den USA in New York nach 9/11, nach den Terroranschlägen. Da sieht man dann immer wieder diese Muster, dass die Menschen zusammenrücken, sich unterstützen, großes Bedürfnis haben, miteinander zu reden, sich auszutauschen, Menschen, die es sonst nie machen würden. Und das sogenannte social distancing läuft dem natürlich zuwider.
Man muss natürlich vielleicht dazu noch sagen: Kollegen aus den USA haben da, glaube ich, zurecht auch darauf hingewiesen, dass was eigentlich gemeint ist, ist eher die physische Distanz. Das sollte man vielleicht nochmal ganz klar machen im Hinblick auf das, was die Menschen befürchten: Dass sie sich physisch distanzieren sollen, aber dass das nicht bedeutet, dass man sich sozial, emotional von anderen distanzieren muss oder soll.
Deutschlandfunk Kultur: Was wir jetzt hier auch noch sehen, sind die sogenannten Corona-Partys, also Menschen, die sich treffen gegen alle Vorschriften im öffentlichen Raum, in Parks gemeinsam feiern, versuchen, Corona auf die Art die Stirn zu bieten. Was ist das? Ist das Verdrängung? Ist das Ignoranz? Ist das Egoismus?
Corona-Partys als Abwehrreaktion
Echterhoff: Es fehlen natürlich dazu direkt empirische Daten. Ich habe so ein bisschen die aktuellen Umfragen angeschaut. Da findet man dazu nichts direkt. Es sind gerade ganz neue Phänomene, die hier auftreten. Ich würde vermuten, dass bei der Konfrontation mit solchen Situationen von Unsicherheit oder Angst es eine Reaktion gibt, die auch irgendwie allzu menschlich ist. Das ist eine Abwehrreaktion.
Wir wissen aus der Forschung auch im Gesundheitsbereich dazu: Was macht angstauslösende Kommunikation? "Wenn Sie nicht Präventivmaßnahmen ergreifen gegen Ansteckung mit bestimmten Krankheiten", das kennt man sehr gut aus der Forschung zu HIV oder zum Rauchen, "wenn Sie das Rauchen nicht aufgeben, kann das und das passieren."
Wenn solche angstauslösende Kommunikation ein bestimmtes Level überschreitet, dann wird das als Bedrohung empfunden. Wenn die Angst zu stark ist oder wenn sie überwältigend wird oder – das ist ein psychologisch sehr wichtiger Punkt – wir gar kein Licht am Horizont sehen, weil wir nicht wissen, wann ist denn eine Lösung für die Situation in Reichweite, es ist ja gerade gar nicht absehbar, dann wird es wahrscheinlicher, dass Menschen sozusagen in der ersten Reaktion auch defensiv reagieren, das ablehnen, abwehren, den Informationen und dem, was sie eigentlich verstandesgemäß da auch nachher zusammenbauen könnten, dem Ganzen trotzen.
Natürlich kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. In der alltäglichen Lebenswelt, in bestimmten sozialen Gruppen, in bestimmten Altersklassen ist natürlich einfach ganz wichtig, auch in der Situation sozialen Kontakt zu haben, sich zu verständigen, meinetwegen auch darauf: "Oh, jetzt fangen wir uns mal schnell den Virus ein. Dann haben wir es hinter uns." Also, dass es da zum Teil auch vielleicht zynische Verhaltensweisen gibt, das mag ich gar nicht in Abrede stellen. Die werden natürlich dann auch medial nochmal besonders selektiv auch berichtet.
Deutschlandfunk Kultur: Der Kollege Lenz Jakobsen von der Wochenzeitung "Die Zeit" hat einen Begriff geprägt – "Wohlstands-Trotz". Das heißt, manche weigern sich einfach, ihre hohe Lebensqualität wegen des Virus einzuschränken. Sind Corona-Partys auch Trotzreaktionen einer hedonistischen Gesellschaft?
Trotz gegen die Einschränkung von Freiheiten
Echterhoff: Trotz kennt man als Reaktion, wenn man mit einer sehr stark vorgetragenen Einschränkung der Freiheit konfrontiert ist, wenn einem ganz, ganz klare freiheitseinschränkende Anweisungen gegeben werden. Das kennt man häufig aus dem Erziehungsbereich. Die Eltern bei Kindern, die in einem bestimmten Alter sind, wenn sie sehr klar und deutlich formulieren, dann entsteht in den Phasen, in denen man gerade auch seinen Willen und seine Identität formiert, also Pubertät, Teenager-Alter, gerade der besondere Bedarf danach, die besondere Motivation, dagegen zu halten.
Es kann sein, dass es bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen auch dazu kommt: "Das möchte ich mir jetzt gar nicht vorschreiben lassen." Auch alles vor dem Hintergrund, dass es Grundbedürfnisse gibt, wie ich es genannt habe, nach Selbstbestimmung, Autonomie, Handlungsfähigkeit. Da möchte ich mich nicht einschränken lassen. Bei Menschen, die besonders vielleicht stark gewohnt sind, das auch zu tun, die ein hohes Gefühl von Selbstwirksamkeit und agency haben und damit auch erfolgreich sind, ist vielleicht dieses Gefühl, dass man sich da nicht einschränken möchte, besonders groß.
Ich will dazu nur kurz etwas sagen. Es gibt da ganz schöne Experimente, die zeigen: Wenn man eine klare Anweisung auf ein Schild an eine Häuserwand schreibt, "unter keinen Umständen hier Graffiti anbringen", in der einen Bedingung, in einer anderen Bedingung auf dieses Schild schreibt, "bitte bringen Sie kein Graffiti an", dann ist bei der deutlichen Aufforderung, bei dem klaren Imperativ nachher mehr Graffiti an der Wand.
Wenn wir jetzt besonders mit etwas konfrontiert werden, was wir als ganz starke Freiheitseinschränkung und als Imperativ verstehen, dann ist die Chance für Trotz oder Reaktanz durchaus erhöht.
Deutschlandfunk Kultur: Ein anderes Phänomen dieser Tage sind die Hamsterkäufe. Klopapier, Nudeln, Mehl, in den Länden können die Mitarbeiter die Regale gar nicht so schnell nachfüllen, wie sie leergekauft werden. Dabei herrscht eigentlich kein Mangel. Ist Hamstern irrational, egoistisch? Oder ist das ein altes Verhaltensmuster?
Echterhoff: In Situationen von Unsicherheit und Bedrohung suchen Menschen nach Möglichkeiten sich zu schützen. Jetzt ist natürlich die aktuelle Situation sehr kompliziert für Menschen, die ursprünglich mal eben vor 30-, 40 000 Jahren in ganz anderen Umwelten ihre aktuell immer noch vorhandenen Kompetenzen und ihr neuronales Equipment aufgebaut haben und ihre sozialen Fähigkeiten. Es ist natürlich schwierig, jetzt darauf zu reagieren. Man sieht niemandem an, ob er mich infizieren kann normalerweise. Na gut, jemand hustet, ich halte Abstand, aber das Virus selber ist unsichtbar. Die Warnsignale, auf die wir uns evolutionär eingestellt haben, können wir hier nicht wahrnehmen. Die sind nicht vorhanden.
Es ist natürlich schon eine Situation, in der man dann unter dieser großen Unsicherheit und fehlenden Wahrnehmbarkeit der Bedrohung dann irgendwo vielleicht nach anderen Möglichkeiten sucht, auf die Unsicherheit zu reagieren und wie man mit dieser Bedrohung umgeht.
Deutschlandfunk Kultur: Das ist also eine Art von Aktionismus angesichts der Unsicherheit?
Hamstern ist auch Aktionismus
Echterhoff: Das ist vielleicht Aktionismus, das sind vielleicht Übersprungshandlungen zum Teil. Ich will das jetzt auch gar nicht abtun, weil wir natürlich in so einer Situation der Verunsicherung nach Hinweisen in unserer sozialen Umwelt, in den Medien suchen, was kann ich tun. Wie kann ich mich noch schützen? Die Atemschutzmasken bringen dann wohl nicht so viel. Die sind übrigens überall natürlich ausverkauft oder ich muss einen Monat warten, wenn ich die bei Amazon bestelle.
Dieses soziale oder physische Distancing ist auch erst seit ein paar Tagen oder seit einer Woche wirklich so ein Punkt. Der ist natürlich auch hoch dilemmatisch oder widersprüchlich und schwierig für Menschen, das haben wir ja schon besprochen. Also wird man vielleicht so nach ganz einfachen Anhaltspunkten suchen: Ich höre von Freunden oder lese in Internetblogs oder kriege über WhatsApp Nachrichten aus einer WhatsApp-Gruppe, dass es jetzt vielleicht gerade die Zeit ist, um bestimmte Dinge zu kaufen.
Es gibt auch die Listen, was man sich besorgen soll, um Vorsorge zu treffen. Und weil das Dinge sind, die man relativ einfach umsetzen kann, weil, immer noch kann jeder direkt in irgendeinen Supermarkt oder Geschäft gehen und da irgendwelche Waren kaufen. Das haben dann die Menschen auch gemacht, weil das für sie auch natürlich eine Möglichkeit ist, einfach mit Handlungen zu reagieren, weil das an anderen Stellen häufig jetzt so ist, dass wir gar nicht mehr wirklich handeln können, sondern dass das Unterlassen von Handlung gerade die Maßgabe in der aktuellen Krisensituation ist.
Deutschlandfunk Kultur: Ist das Hamstern auch eine Folge kollektiver Erinnerung? Wir sind ja alle mit den Geschichten unserer Eltern und Großeltern groß geworden, wie im und nach dem Krieg gehamstert wurde. Ist das also auch eine kulturelle Prägung?
Die Rolle kollektiver Erinnerungen
Echterhoff: Wir wissen, dass bestimmte Reaktionsmuster sich zum Teil in gewissem Ausmaß auch intergenerational, also über Generationen hinweg so übertragen können. Das hat der Kollege Harald Welzer ja auch in seinen Studien gezeigt, dass kollektive Erinnerungen da auch mit dazu beitragen können. Das ist durchaus möglich. Ich halte das allerdings nicht für den treibenden Mechanismus dahinter. Was ich eben beschrieben habe, das scheint mir der Ausgangspunkt, die psychologische Triebfeder zu sein.
Es kann sein, dass die Form, die das annimmt, auch durch kollektive Erinnerung noch weiter geprägt wird, dass man dann eben eine bestimmte Art von Handlungen an den Tag legt, dass man sich eben versorgt mit bestimmten Grundnahrungsmitteln, die besonders haltbar sind, und den notwendigsten Mitteln für die alltägliche Versorgung. Das mag schon sein.
Deutschlandfunk Kultur: Einschränkung ist so etwas wie der Schlüsselbegriff oder das Leitmotiv dieser Zeit. Aber wenn wir sehen, wie unmöglich es ist in unserem Land, ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen oder wie den Grünen ihr Vorschlag eines "Veggie Day" in Kantinen um die Ohren geflogen ist, wenn man das alles sieht, scheint Einschränkung zu unserer Vorstellung von Freiheit ja so gar nicht zu passen. Müssen wir angesichts der Pandemie unsere Werte überprüfen oder zumindest die Wertehierarchie?
Sich die eigenen Prioritäten vor Augen zu führen hilft
Echterhoff: Sich die eigenen Prioritäten auch vor Augen zu führen, wenn man nicht gerade gestresst ist im Alltag von den quengelnden Kindern, die zu Hause sind, oder von der sehr verängstigten Schwiegermutter, um die man sich auch kümmern muss, wenn man also mal ruhige Minuten hat, das ist mir über die vergangene Woche auch zunehmend schwer gefallen, die zu finden, dann ist es auch sinnvoll zu überlegen: Was ist der weitere Horizont? Was ist einem wichtig? Worauf kommt es an für mich individuell, aber auch gesellschaftlich? Welche Verantwortung habe ich?
Das ist im Übrigen auch eine wichtige Maßnahme, diese Art von Selbstreflexion und Besinnung auf wichtige Werte, um mit Abwehrreaktionen angesichts von Angst und von verängstigenden Mitteilungen aus der Welt der Politik besser umzugehen und nicht in die eben schon beschriebenen Abwehrreaktionen zu verfallen.
Wenn man sich selbst mit seinen Werten, mit seinen Prioritäten gefestigt fühlt, wird man da nicht so schnell Opfer von solchen Kurzschlussreaktionen oder Abwehrreaktionen. Also, aus rein psychologischer Sicht ist ganz sinnvoll, sich das klarzumachen. Das ist völlig klar, dass wir das nur immer in bestimmten Momenten und begrenzt machen können.
Es wird aktuell natürlich dadurch erschwert, dass wir aus meiner Sicht sehr, sehr stark immer wieder mit Ressourcenbelastungen zu kämpfen haben, weil wir uns dauernd kontrollieren müssen und dann, wie sagt man so schön im psychologischen Jargon, ressourcendepriviert sind. Ressourcendepriviert heißt, wir haben einfach keine kognitiven Ressourcen mehr, um wirklich uns in Ruhe Gedanken zu machen und die Dinge sorgfältig gedanklich auszuloten, also systematisch und reflektiert zu verarbeiten. Wir haben eine Krisensituation. Man sollte alle Möglichkeiten ergreifen, das für sich persönlich zu machen.
"Auch die Chancen sehen, die die Situation bietet"
Ich würde noch einen zweiten Punkt hier für wichtig halten. Es soll jetzt nicht als Vorschlag zur Manipulation rüberkommen, aber wir sollten uns auch klarmachen, dass es analog zur Klimadebatte nicht nur um Verlust und Verzicht geht, sondern dass wir auch die Chancen sehen, die die Situation bietet. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie lax oder ironisch mit umgehen, aber das haben auch Autoren in der New York Times zuletzt mal vorgeschlagen: Wollen wir vielleicht Chancen für soziales Experimentieren ergreifen, andere, neue Möglichkeiten der Kontaktaufnahme ausloten?
Wir haben hier in der Familie selber zuletzt der sich isoliert fühlenden Großmutter geholfen, Skype einzurichten und mit ihr geskypt. Sie wird von den Kindern vermisst und vermisst diese noch viel mehr. Das hat ihr einen ganz schönen Schub gegeben. Gerade noch am letzten Wochenende wurde ein Familientreffen abgesagt. Da wurde dann zu demselben Zeitpunkt viele Nachrichten und Fotos in einer Familiengruppe in einem Onlinemedium als Ersatz sozusagen verschickt.
Was ich selber heute Morgen noch gemacht habe, ist ein Hinweis auf ein YouTube-Video von Alba Berlin, in dem so sehr motivierte, nette junge Leute Bewegungsübungen und so ein bisschen physische Übungen, Motorikübungen für Kinder, Grundschule, Kita zeigen, so dass wir das hier zusammen gemacht haben. Fast parallel dazu kamen Fotos, die das dokumentierten von den anderen Kita-Kindern, von Kindern von Freunden. Und es war plötzlich so ein Gefühl da: Oh, wir haben was gemeinsam.
Deutschlandfunk Kultur: Das ist die andere Seite. Das sind also nicht nur die Corona-Partys und die Hamsterer, also die ein Zeichen für eher egoistisches Verhalten sind, sondern eben auch die vielen Beispiele von Menschen, die versuchen das Beste aus der Krise zu machen, vielleicht sogar neue Formen gegenseitiger Unterstützung und Solidarität zu finden. Ist diese Krise ein Härtetest für unsere gesellschaftliche und individuelle Fähigkeit zu Empathie?
Echterhoff: Es ist sicherlich eine Herausforderung, der wir uns als Einzelne in Gemeinschaft mit anderen jetzt stellen müssen. Wir brauchen in den Gesellschaften, wie wir sie kennen, ich spreche jetzt nicht von utopischen Gesellschaften, eine Balance zwischen dem, was das Individuum für sich als Rechte beanspruchen kann, und dem Gemeinsinn oder der Solidarität.
Dieses fein abgestimmte Gleichgewicht hat in der Nachkriegszeit irgendwann mal offensichtlich sehr gut funktioniert in bestimmten Formen von sozialer Marktwirtschaft, zumindest wenn man sich Analysen – es ist nicht mein Feld, ich bin Psychologe – der goldenen Ära der 50er- bis 80er-Jahre nach Thomas Piketty überlegt. Es hat auch zuletzt in der "Neuen Zürcher Zeitung" ein Kollege aus Bonn darüber geschrieben. Diese Balance wieder zu finden und können wir die wieder erreichen, das steht natürlich jetzt schon auf dem Prüfstein.
Wo finden wir jetzt Formen, dass wir eben von dem Gefühl, dass wir Verluste erleben und die Aversion, die mit Verlust für Menschen verbunden ist, wie können wir damit umgehen? Wir nehmen lieber ein großes Risiko in weiterer Zukunft in Kauf, das ungewiss ist, als einen sicheren geringfügigeren Verlust in der näheren Zukunft. Deswegen weigern sich ja Menschen auch, zum einen was für den Klimawandel zu tun, weil sie sagen: "Na ja, wir pokern mal drauf. Vielleicht gibt’s ja eine Schlüsselinnovation. Und irgendwann verbessert sich das in 20 Jahren schon ganz schlagartig. Vielleicht wird’s ja gar nicht so schlimm in fünf Monaten aussehen."
Wir müssen unsere Abneigung gegen Verzicht ändern
Wir müssen uns aber klarmachen, das hat damit zu tun, dass wir so eine große, große Abneigung gegen die Vorstellung von Verlust und Verzicht. Wir müssen versuchen, jetzt auch da unsere Vorstellung ein bisschen zu adjustieren und zu ändern, andere Schemata aufzubauen, die nicht nur uns dauernd vor Augen führen, was wir alles an Verlust und Verzicht aufbauen. Jetzt spreche ich auch ein bisschen nicht nur empirisch deskriptiv, sondern eben auch stärker normativ oder emphatisch. Das scheint mir in der Tat wichtig zu sein, dass wir versuchen das hinzubekommen. Das ist ein Feld, auf dem wir das jetzt unter verschärften Bedingungen ausprobieren können.
Es gibt einige Parallelen zu dem, was wir kollektiv und individuell leisten müssen, im Hinblick auf den Klimawandel. Das sehen wir jetzt. Unterm Brennglas sehen wir die Herausforderungen, die sich ergeben.
Deutschlandfunk Kultur: Also hängt das eine mit dem anderen zusammen. Erstmal haben wir aber auch vor allem mit Stress zu tun, Stress für den Einzelnen. Viele machen sich berechtigte Sorgen um Job und Einkommen. Dazu kommt die Angst krank zu werden. Die Rund-um-die-Uhr-Betreuung von Kindern ist, gelinde gesagt, anspruchsvoll. Davon können Sie, glaube ich, ja auch ein Lied singen gerade. Andere leiden an Einsamkeit, an Langeweile in der häuslichen Quarantäne. Wie sollen wir mit diesem Stress umgehen als Einzelne und Gesellschaft, damit eben auch diese positiven Aspekte zum Tragen kommen, die Sie erwähnt haben? Was sagen Sie als Psychologe zum Stress?
"Toleranz in der Krisensituation"
Echterhoff: Wir müssen das zunächst anerkennen. Wichtig ist in Krisensituationen unter Belastung, dass wir die Gedanken zulassen, dass wir anerkennen, dass wir gerade unter Stress sind, unter Unsicherheit und uns unser übliches Verhaltensrepertoire ins Schwimmen gerät. Der erste Schritt ist, das zu akzeptieren und das nicht nur für uns persönlich zu akzeptieren, sondern auch für die anderen. Wir müssen akzeptieren und anerkennen, dass die Menschen gerade emotional beansprucht sind, kognitiv beansprucht sind, dass ihnen Ressourcen fehlen, dass handlungssteuernde Prozesse leichter zusammenbrechen, dass Menschen dann eher unüberlegt reagieren gegenüber anderen, nicht mehr gemäß der üblichen Norm vielleicht handeln.
Wir brauchen also Toleranz in der Krisensituation selber, dass wir nicht miteinander zu hart ins Gericht gehen. Es gibt natürlich Grenzen, auf die wir dann entsprechend sicherlich reagieren sollten. Ich habe eben auch angesprochen, dass es offensichtlich Bedingungen gibt, unter denen muss das ganze Bestrafungsrepertoire auch, das wir denen, die uns regieren, zugebilligt haben, denen wir das Vertrauen gegeben haben, qua Mandat Dinge für uns zu entscheiden, die wir nicht alle jetzt selber durch eine Volksabstimmung entscheiden können. Weil, wer weiß, was dabei rauskommen würde. Wir brauchen dieses Vertrauen und eine Toleranz, dass die Dinge jetzt auch umgesetzt werden und dass auch unsere Mitmenschen in unserer sozialen Umwelt vor neuartigen Situationen stehen.
Deutschlandfunk Kultur: Dabei spielt sicher auch eine Rolle, wie lange die Einschränkungen von Bewegungsfreiheit, öffentlichem Leben, teilweise auch Berufstätigkeit dauern. Das kann ja niemand absehen. Glauben Sie, dass der Stress mit zunehmender Dauer stärker wird? Oder könnte es auch Gewöhnungseffekte geben?
Das Prinzip der kleinen Schritte
Echterhoff: Der Mensch ist letztlich auf eine erstaunliche Weise auch anpassungsfähig und adaptiv. Wenn man sich mal die Berichte anschaut von Menschen, die in Krisenzeiten des vergangenen Jahrhunderts gelebt haben, dann haben die natürlich auch ihre ganz normalen Alltagssituationen gehabt und ihre üblichen kleinen Streits in der Familie oder vielleicht die positiven Erlebnisse in ihre unmittelbaren Lebenswelt, mit ihren Mitmenschen.
Wir tendieren dazu, wenn wir weit in die Vergangenheit oder Zukunft gehen, dann simulieren wir die Situation, wir abstrahieren und das Positive erscheint uns noch positiver und das Negative noch schrecklicher. Das nennt man affektives forecasten, affektive Vorhersagefehler. Da hat man mal geschaut, wie schlimm antizipieren Menschen das, wenn sie von ihrem Partner verlassen werden. Die Vorhersagen waren katastrophal. Und als es dann passierte, war das zwar schlimm, aber es gab auch den Alltag.
Wir sind zwar träge, indem natürlich es uns wirklich weh tut im Körper und im Gehirn, unsere Gewohnheiten abzulegen und unsere Automatismen, unseren Autopiloten irgendwie umzujustieren, aber wir sind auch anpassungsfähig, das heißt, gerade wenn die Dinge, die Veränderung kleinschrittig passieren. Man sieht das schon in der Politik, dass da mit dem Prinzip der Kleinschrittigkeit gearbeitet wird.
Das hat der berühmte Sozialpsychologe Stanley Milgram in seinen Studien zu Gehorsam genauso gemacht. Das kennen sicherlich viele auch der Hörer, Hörerinnen. Da sollten auf Anweisung eines angeblichen Lehrers oder Forschers Versuchspersonen einem Schüler, der eine Lernaufgabe hatte, bei falschen Antworten kleine Elektroschocks verabreichen. Bei Zunahme von Fehlern, bei weiteren Fehlern wurde immer um 15 Volt höher geschaltet. Über 60 Prozent aller Versuchspersonen, das hat man auch noch vor wenigen Jahren in den USA repliziert, sind dann bei 450 Volt angekommen, was offensichtlich eine starke Bedrohung für Leib und Leben des angeblichen Schülers war, der da etwas lernen sollte.
Das funktioniert, weil es in kleinen Schritten geht. Also, das graduelle, Kleinschrittige führt dazu, dass wir nachher den großen Schritt, den wir getan haben, gar nicht mehr so wahrnehmen. Damit arbeitet nach meiner Empfindung auch die Politik gerade. Es ist aber auch ein eigener Mechanismus. Das kann natürlich über längere Zeit eintreten. Menschen sind anpassungsfähig, adaptiv, gerade wenn das in kleinen Dosen passiert. Wir antizipieren das natürlich jetzt als eine unglaublich wahnsinnige Situation.
Ich will damit natürlich nicht sagen, dass ein langer Zustand, der unseren Grundbedürfnissen zuwiderläuft, nicht wirklich auch Stress auslöst und wir uns da um so mehr überlegen müssen: Wie können wir mit dieser Belastung dann umgehen? Wo finden wir Ressourcen, um mit unserer fundamentalen Bedürfnisbedrohung umzugehen? Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Kontrolle, sozialem Miteinander, die habe ich schon genannt. Das haben wir eben in der Form noch nicht gehabt. Das ist auf einer individuellen und auch gesellschaftlichen Ebene eine große Herausforderung.
Deutschlandfunk Kultur: Erwarten Sie, dass diese Krise bleibende Veränderungen anstoßen wird, bleibende soziale Veränderungen? Oder kehren wir wieder zur Tagesordnung zurück, sobald das Schlimmste überstanden ist?
"Das wird sicher ins globale kollektive Gedächtnis eingehen"
Echterhoff: Die Vorhersage, die Projektion in die Zukunft, die Futurologie ist eine beliebte Übung, die vielleicht im letzten Jahrhundert irgendwann Konjunktur erlebt hat. Ich bin da sehr vorsichtig, das zu sagen. Es hängt von wirklich unvorhersehbaren Bedingungen der zukünftigen Gesellschaft ab, wie sie das einordnet. Das wird sicherlich ins globale kollektive Gedächtnis irgendwo eingehen.
Was es bedeutet, ob es nachher eine Erfolgsgeschichte ist, ob es die Geschichte ist von einer jahrelangen globalen Wirtschaftskrise und von viel Leid auf der ganzen Welt und von Dingen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, das ist einfach nicht vorhersehbar. Die Zukunft entsteht, indem sie entsteht. Die Vorhersage ist eher so ein Instrument, um mit der Unsicherheit umzugehen, und eher ein Instrument, um für das aktuelle Handeln irgendwo vielleicht ein paar Leitlinien und Leitplanken bereitzustellen oder Bedrohungsszenarien. Das würde ich eher denen, die sich dazu berufen fühlen, überlassen, der Politik.