Spannend und gedankenreich
Diese klug zusammengestellte Textsammlung vereint Kleists vieldeutigen "Marionettentheater-Aufsatz" von 1810, einen Essay des englischen Theaterregisseurs Edward Gordon Graig - und eine Interpretation beider Texte durch den ungarischen Schriftsteller Lászlo Földényi.
Als ich den Winter 1801 in M. zubrachte, traf ich daselbst eines Abends, in einem öffentlichen Garten, den Herrn C. an, der seit Kurzem, in dieser Stadt, als erster Tänzer an der Oper angestellt war, und bei dem Publico außerordentliches Glück machte.
Der Bildungsbeflissene dürfte diesen von Informationen überbordenden Einleitungssatz kennen. Es ist der aus Heinrich von Kleists rätselhaftem Essay "Über das Marionettentheater" von 1810. Darin führt der Erzähler mit einem Bühnentänzer ein philosophisches Gespräch.
Marionetten seien menschlichen Tänzern überlegen, erklärt darin der Künstler, weil der Verstand die natürliche Grazie ihrer Bewegungen nicht verdorben habe. Er sieht seinen Gedanken in einem Vorfall bestätigt, von den ihm der Erzähler berichtet: Ein junger, schöner Mann habe sich einst zufällig vor einem Spiegel einen Splitter aus dem Fuß gezogen und sich dabei an eine antike Statue erinnert gefühlt.
Doch so sehr sich der junge Mann auch bemüht habe, dieselbe anmutige Bewegung später nochmals zu vollziehen, es sei ihm nicht gelungen. Vollendete Anmut und Natürlichkeit, so die These, die beide Gesprächspartner gemeinsam entfalten, besitze derjenige, der entweder gar kein oder ein unendliches, also göttliches Bewusstsein habe.
Seinen Versuch, Kleists vieldeutigen "Marionettentheater-Aufsatz" neu zu lesen, beginnt der ungarische Schriftsteller Lászlo Földényi erfrischend unkonventionell: Denn was die "Verwirrung", "Verlegenheit" und "Zerstreutheit" anbelangt, die Kleist seinen Gesprächspartnern immer wieder andichtet, so ist dies nach Földényi nicht ihrer kühnen These oder einer "gebrochenen Tragik" geschuldet, wie Generationen von Literaturwissenschaftlern behaupteten. Vielmehr entspringe es einer natürlichen Regung des Erotischen: Denn warum, fragt Földényi, unterhalten sich beide Männer in einem Park? Warum im Winter, wenn es kalt ist; und warum am Abend, wenn es dunkel ist?
Spannend und gedankenreich interpretiert Földényi Kleists Text als das "Drama einer gestörten Erotik", in dem sich beide Gesprächspartner dadurch kennen lernen wollen, dass sie einander unglaubliche Geschichten erzählen. Dabei belauern sie sich beständig, weichen einander aber immer wieder aus und streben nur gedanklich nach dem, was auf Griechisch "Eros" heißt: dem Vollkommenen – dem Wahren, Guten und Schönen.
Doch belässt es Földényi nicht dabei, sondern gräbt tiefer in Kleists Vorstellungswelt, legt eine weitere, bislang wenig beachtete Schicht des "Marionettentheaters" frei. Und hierzu verweist er auf den englischen Theaterregisseur Edward Gordon Graig.
Auch Craig redete in seinem 1907 erschienenen Aufsatz "Der Schauspieler und die Übermarionette" den an Fäden hängenden Puppen das Wort; lobte, dass sie "edle Künstlichkeit" und "totenähnliche Ruhe" besäßen, pries, dass sie keine "Schwärmerei", keine "prahlerische Persönlichkeit", keine "wilden, verzweifelten Hoffnungen" zum Ausdruck brächten und forderte gar, dass das Theater Schauspieler verbannen müsse, die ihre Gefühle zur Schau stellen und – dass an deren Stelle ein idealer Schauspieler trete, eine "Übermarionette":
Die Übermarionette wird nicht mit dem Leben wetteifern, sie wird über das Leben hinausgehen. Ihr Vorbild wird nicht der Mensch aus Fleisch und Blut, sondern der Körper in Trance sein.
Craigs Theaterverständnis speiste sich aus der Vorstellung eines "großen Stils", dem an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert viele Vertreter der künstlerischen Avantgarde anhingen: de Chirico mit seinen Marionettenmalereien, Maeterlinck mit seinen Marionettenspielen oder auch die Futuristen mit ihren Beschleunigungsfantasien – all diese trachteten danach, angesichts der wachsenden Großstädte und der sich herausbildenden Massenkultur, die atomisierenden und säkularisierenden Tendenzen der modernen Gesellschaft zu überwinden; suchten die Ursache dieser Phänomene, die aufklärerische Idee des freien und gleichen Individuums in einer neuen metaphysischen Gegenwart aufzulösen. Und das bedeutete: das Subjektive zu verneinen, auf persönliche, psychologisierende und naturalistische Elemente zu verzichten.
Földényi stellt überzeugend dar, Kleist und Craig würden sich hierin treffen: Im Gedanken, dass die abstrakten, unpersönlichen Marionetten auf der Bühne, Trost spenden sollen, angesichts der Verworrenheiten und Zufälligkeiten des modernen Lebens; dass sie den Menschen von seiner transzendentalen Obdachlosigkeit befreien sollen:
Sowohl Kleist als auch Craig bringen ihre Hoffnung zum Ausdruck – die Zuversicht, dass es eine Genesung vom gegenwärtigen Zustand des Sündenfalls geben und der Metaphysik, die den Menschen stets daran erinnert, welchen Platz er im Kosmos einnimmt, welch privilegierte Lage er im Dasein hat, von neuem Geltung verschaffen wird.
Kleist, der vielerorts als deutscher Romantiker gilt, als Apologet des "absoluten Ichs", wie es im Titel einer seiner Biografien heißt, er erweist sich in dieser klug zusammengestellten Textsammlung somit als genuiner Antipode davon: als ein Metaphysiker, der den Individualismus hinter sich zu lassen versuchte und – damit auch als ein Kritiker unserer Zeit.
Edward Gordon Craig, László F. Földényi, Heinrich von Kleist: Marionetten und Übermarionetten. Die Inszenierung des Erotischen
Texte von Heinrich von Kleist und Edward Gordon Craig, kommentiert von László F. Földényi
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2011
Der Bildungsbeflissene dürfte diesen von Informationen überbordenden Einleitungssatz kennen. Es ist der aus Heinrich von Kleists rätselhaftem Essay "Über das Marionettentheater" von 1810. Darin führt der Erzähler mit einem Bühnentänzer ein philosophisches Gespräch.
Marionetten seien menschlichen Tänzern überlegen, erklärt darin der Künstler, weil der Verstand die natürliche Grazie ihrer Bewegungen nicht verdorben habe. Er sieht seinen Gedanken in einem Vorfall bestätigt, von den ihm der Erzähler berichtet: Ein junger, schöner Mann habe sich einst zufällig vor einem Spiegel einen Splitter aus dem Fuß gezogen und sich dabei an eine antike Statue erinnert gefühlt.
Doch so sehr sich der junge Mann auch bemüht habe, dieselbe anmutige Bewegung später nochmals zu vollziehen, es sei ihm nicht gelungen. Vollendete Anmut und Natürlichkeit, so die These, die beide Gesprächspartner gemeinsam entfalten, besitze derjenige, der entweder gar kein oder ein unendliches, also göttliches Bewusstsein habe.
Seinen Versuch, Kleists vieldeutigen "Marionettentheater-Aufsatz" neu zu lesen, beginnt der ungarische Schriftsteller Lászlo Földényi erfrischend unkonventionell: Denn was die "Verwirrung", "Verlegenheit" und "Zerstreutheit" anbelangt, die Kleist seinen Gesprächspartnern immer wieder andichtet, so ist dies nach Földényi nicht ihrer kühnen These oder einer "gebrochenen Tragik" geschuldet, wie Generationen von Literaturwissenschaftlern behaupteten. Vielmehr entspringe es einer natürlichen Regung des Erotischen: Denn warum, fragt Földényi, unterhalten sich beide Männer in einem Park? Warum im Winter, wenn es kalt ist; und warum am Abend, wenn es dunkel ist?
Spannend und gedankenreich interpretiert Földényi Kleists Text als das "Drama einer gestörten Erotik", in dem sich beide Gesprächspartner dadurch kennen lernen wollen, dass sie einander unglaubliche Geschichten erzählen. Dabei belauern sie sich beständig, weichen einander aber immer wieder aus und streben nur gedanklich nach dem, was auf Griechisch "Eros" heißt: dem Vollkommenen – dem Wahren, Guten und Schönen.
Doch belässt es Földényi nicht dabei, sondern gräbt tiefer in Kleists Vorstellungswelt, legt eine weitere, bislang wenig beachtete Schicht des "Marionettentheaters" frei. Und hierzu verweist er auf den englischen Theaterregisseur Edward Gordon Graig.
Auch Craig redete in seinem 1907 erschienenen Aufsatz "Der Schauspieler und die Übermarionette" den an Fäden hängenden Puppen das Wort; lobte, dass sie "edle Künstlichkeit" und "totenähnliche Ruhe" besäßen, pries, dass sie keine "Schwärmerei", keine "prahlerische Persönlichkeit", keine "wilden, verzweifelten Hoffnungen" zum Ausdruck brächten und forderte gar, dass das Theater Schauspieler verbannen müsse, die ihre Gefühle zur Schau stellen und – dass an deren Stelle ein idealer Schauspieler trete, eine "Übermarionette":
Die Übermarionette wird nicht mit dem Leben wetteifern, sie wird über das Leben hinausgehen. Ihr Vorbild wird nicht der Mensch aus Fleisch und Blut, sondern der Körper in Trance sein.
Craigs Theaterverständnis speiste sich aus der Vorstellung eines "großen Stils", dem an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert viele Vertreter der künstlerischen Avantgarde anhingen: de Chirico mit seinen Marionettenmalereien, Maeterlinck mit seinen Marionettenspielen oder auch die Futuristen mit ihren Beschleunigungsfantasien – all diese trachteten danach, angesichts der wachsenden Großstädte und der sich herausbildenden Massenkultur, die atomisierenden und säkularisierenden Tendenzen der modernen Gesellschaft zu überwinden; suchten die Ursache dieser Phänomene, die aufklärerische Idee des freien und gleichen Individuums in einer neuen metaphysischen Gegenwart aufzulösen. Und das bedeutete: das Subjektive zu verneinen, auf persönliche, psychologisierende und naturalistische Elemente zu verzichten.
Földényi stellt überzeugend dar, Kleist und Craig würden sich hierin treffen: Im Gedanken, dass die abstrakten, unpersönlichen Marionetten auf der Bühne, Trost spenden sollen, angesichts der Verworrenheiten und Zufälligkeiten des modernen Lebens; dass sie den Menschen von seiner transzendentalen Obdachlosigkeit befreien sollen:
Sowohl Kleist als auch Craig bringen ihre Hoffnung zum Ausdruck – die Zuversicht, dass es eine Genesung vom gegenwärtigen Zustand des Sündenfalls geben und der Metaphysik, die den Menschen stets daran erinnert, welchen Platz er im Kosmos einnimmt, welch privilegierte Lage er im Dasein hat, von neuem Geltung verschaffen wird.
Kleist, der vielerorts als deutscher Romantiker gilt, als Apologet des "absoluten Ichs", wie es im Titel einer seiner Biografien heißt, er erweist sich in dieser klug zusammengestellten Textsammlung somit als genuiner Antipode davon: als ein Metaphysiker, der den Individualismus hinter sich zu lassen versuchte und – damit auch als ein Kritiker unserer Zeit.
Edward Gordon Craig, László F. Földényi, Heinrich von Kleist: Marionetten und Übermarionetten. Die Inszenierung des Erotischen
Texte von Heinrich von Kleist und Edward Gordon Craig, kommentiert von László F. Földényi
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2011
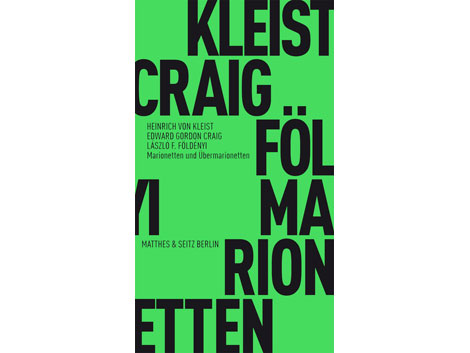
Buchcover: "Marionetten und Übermarionetten" von H. v. Kleist u.a.© Matthes & Seitz Verlag
