Spannendes Panorama eines Landes
Unser einseitiges Bild von der Türkei aufbrechen will der Korrespondent Rainer Herrmann mit seinem Buch "Wohin geht die türkische Gesellschaft?". In der Türkei gehe es derzeit weniger um den Gegensatz zwischen Religion und Säkularität, sondern um die Spaltung des Landes in eine abgehobene urbane Staatselite und eine demografische Mehrheit, die sich nicht länger bevormunden lassen wolle.
Die Türkei befindet sich seit gut einem Jahrzehnt in einem tiefen Wandel. Obgleich die zum Teil dramatischen Veränderungsprozesse mittlerweile die meisten Bereiche der türkischen Gesellschaft erfasst haben, werden sie hierzulande längst nicht in ihrem ganzen Umfang wahrgenommen. Der Blick, besonders seit den Anschlägen des 11. September, hat sich auch im türkischen Fall weitgehend auf den radikalen politischen Islam verengt.
Mit diesem werden denn auch die türkischen Islamisten um Ministerpräsident Tayyip Erdogan hierzulande häufig assoziiert, also ebenfalls unterschwellig als eine Bedrohung betrachtet, insbesondere vor dem Hintergrund eines möglichen EU-Beitritts der Türkei.
Rainer Hermann, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und intimer Kenner des Landes am Bosporus will nun mit seinem Buch "Wohin geht die türkische Gesellschaft? Kulturkampf in der Türkei" dieses einseitige Bild korrigieren. Dies ist dem seit 17 Jahren in Istanbul lebenden Islamwissenschaftler und Diplom-Volkswirt nicht nur gelungen, er hat auch ein hervorragend geschriebenes und spannend zu lesendes geschichtliches und kulturelles Panorama des Landes vorgelegt.
Als Erklärung für diesen Kulturkampf reicht Hermann der viel beschworene religionsbezogene Gegensatz zwischen radikalen Säkularisten und ebenso gesinnten Islamisten nicht aus. Vor allem gehe es hier auch, so die These des Autors, der sich dabei etwa auf die Studien der türkischen Soziologin Nilüfer Göle stützt, um den Gegensatz zwischen einerseits einer westlich orientierten urbanen Elite, die den radikalen säkularistischen Staat und somit ihre privilegierte Stellung mit autoritären und repressiven Mitteln beharrlich verteidigt, und andererseits einer noch traditionell und islamisch geprägten Bevölkerung, die vom Land in die Städte gewandert ist, ohne ihren ursprünglichen ländlich-religiösen Konservatismus zumindest teilweise aufgegeben zu haben. Sie, schreibt Hermann, ist die eigentliche Machtbasis der AKP Erdogans, der "Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung":
"Noch viel mehr als von der Kritik an der Praxis des Säkularismus profitiert die AK Parti von der Spaltung des Landes in eine abgehobene urbane Staatselite und in eine demografische Mehrheit, die sich nicht länger von dieser Staatselite führen lassen will. Diese Mehrheit ist an der Peripherie Anatoliens aufgebrochen und im Zentrum der Städte angekommen. Die AK Parti wurde ihre politische Partei."
Inwieweit hier die demografische Entwicklung, also die Geburtenraten der beiden konkurrierenden Gruppen, eine Rolle spielt, ist indessen nicht ganz klar. Auch über die Ideologie der heute im Land herrschenden Islamisten hätte man gerne mehr erfahren. Dass sich Erdogans Gefolgschaft wesentlich von der älteren und radikalen Islamisten-Generation unterscheidet, die in den späten neunziger Jahren unter der Führung von Necmettin Erbakan an die Macht gekommen war, wird dem Leser deutlich vor Augen geführt.
Ebenso dass sie anders als ihre Vorgänger westlich und neoliberal orientiert ist und keineswegs die Abschaffung des säkularen Staates beabsichtigt, zugleich aber wie die alte Garde sozial engagiert ist. Doch der Inhalt des Programms der AKP, dieser neuartigen hybriden Partei, mit dem die Islamisten einem bis vor kurzem unterprivilegierten Bevölkerungsteil mehr Gerechtigkeit und Wohlstand und die Tolerierung unterschiedlicher Lebensstile versprechen, wird vom Autor nur flüchtig gestreift.
Hier hätte man sich eine detailliertere Darstellung gewünscht, auch was die Schilderung ihrer Rekrutierungsmethoden betrifft. Zu erfahren ist lediglich, dass das AKP-Programm keinerlei Verweis auf den Islam enthält und dass die engagierte und Hunderttausende Freiwillige umfassende Parteibasis auch zwischen den Wahlen aktiv ist - und zwar immer auch vor Ort; ganz anders als die übrigen Parteien, die ihre Aktivisten nur im Wahlkampf auf Tour schicken.
Gleichwohl verweist Hermann in diesem Zusammenhang auf den türkischen Politologen Ziya Önis, der die Popularität der AKP auch darauf zurückführt, dass sie sich die erfolgreiche Lokalpolitik ihrer islamistischen Vorgänger geschickt zunutze zu machen versteht. Zudem, erläutert der Verfasser,
"verpflichtete sich die AK Parti, entschieden gegen die Korruption vorzugehen. Als einzige Partei sprach sie für die Gesellschaft und die Rechte des Einzelnen, die sie gegen den autoritären Staat schützen wollte und will. Selbst wenn ihre Gründer in der islamistischen Bewegung der Türkei groß geworden sind, befand sich die AK Parti näher an den liberalen Grundsätzen Europas."
Tatsächlich ist die Anpassung an die EU-Normen, die die AKP unter Erdogan in den letzten Jahren im rechtlichen und wirtschaftlichen Bereich massiv betrieben hat, aus Hermanns Sicht der eigentliche Grund für ihren anhaltenden Erfolg. Diesen sogenannten EU-Prozess, der mit einem starken Wirtschaftsaufschwung einhergeht, versucht die alte säkularistische Staatselite permanent zu bremsen: Die Stärkung der Menschenrechte bedeutet für sie nämlich Machtverlust, da ihr damit jene herkömmlichen Repressionsmittel, die sie mit der bloßen Berufung auf die Staatssicherheit bislang willkürlich einsetzen kann, entzogen würden.
Die AKP hingegen versteht es, aus dem EU-Prozess auch für sich Kapital zu schlagen und kann neben dem wirtschaftlichen Aufschwung inzwischen auch auf zahlreiche andere Errungenschaften verweisen. So auf die in den Jahren 2002 bis 2004 erfolgte endgültige Abschaffung der Todesstrafe sowie der berüchtigten Staatssicherheitsgerichte - und, wie Hermann näher ausführt,
"modernisiert wurde der Strafvollzug, eingeführt wurden Jugendgerichte; die Folter verschwand in kurzer Zeit aus den Gefängnissen, Ermittlungen gegen Folternde sind nun mit Vorrang zu verfolgen; verbessert wurde das Versammlungsrecht, erschwert wurde das Verbot einer Partei. Es entstand ein neues Strafgesetzbuch, (…) auch eine neue Strafprozessordnung und ein neues Zivilgesetzbuch, das die 'Ehre' der Familie zugunsten der Rechte der Frau aufgibt."
Auch wollen die islamistischen Pragmatiker die Fehler der Säkularisten beim Umgang mit den Minderheiten der Kurden, Aleviten und Christen nicht wiederholen und setzen hier stärker auf Dialog und Integration. Kompromisslos bleiben sie allerdings beim Streit um das Recht der Frauen, das Kopftuch überall zu tragen, und stoßen dabei auf den nicht weniger erbitterten Widerstand der säkularen kemalistische Elite. Diese rekrutiert sich nach wie vor aus Militär und Nationalisten und will die Kontrolle über die religiösen Institutionen nicht abgeben. Dass sie bei der Bekämpfung ihrer Gegner bisweilen von halblegalen paramilitärischen Nationalistengruppen unterstützt wird, deren brutale Methoden in dem Buch anschaulich beschrieben werden, hat sie nur weiter diskreditiert.
Auch Hermanns fesselnde Darstellung der ungeheuer dynamischen und immer pluralistischer gewordenen türkischen Kulturszene macht deutlich, dass das Land einen Weg beschritten hat, von dem es kein Zurück mehr gibt. Jedenfalls solange nicht, wie die Islamisten am EU-Prozess festhalten und die EU ihrerseits ihnen dabei weiter entgegenkommt.
Dies kann sich nach Einschätzung des Autors nur lohnen. Denn der charismatische Erdogan habe es dank seines staatsmännischen Geschicks in kürzester Zeit vermocht, die Türkei in eine allseits geachtete Regionalmacht zu verwandeln. Von deren geostrategischer Lage würde die EU künftig nur profitieren. Und nur profitieren kann auch der Leser von der Lektüre dieses längst überfälligen Buches.
Rainer Hermann: Wohin geht die türkische Gesellschaft?
Kulturkampf in der Türkei
dtv Verlag, München 2008
Mit diesem werden denn auch die türkischen Islamisten um Ministerpräsident Tayyip Erdogan hierzulande häufig assoziiert, also ebenfalls unterschwellig als eine Bedrohung betrachtet, insbesondere vor dem Hintergrund eines möglichen EU-Beitritts der Türkei.
Rainer Hermann, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und intimer Kenner des Landes am Bosporus will nun mit seinem Buch "Wohin geht die türkische Gesellschaft? Kulturkampf in der Türkei" dieses einseitige Bild korrigieren. Dies ist dem seit 17 Jahren in Istanbul lebenden Islamwissenschaftler und Diplom-Volkswirt nicht nur gelungen, er hat auch ein hervorragend geschriebenes und spannend zu lesendes geschichtliches und kulturelles Panorama des Landes vorgelegt.
Als Erklärung für diesen Kulturkampf reicht Hermann der viel beschworene religionsbezogene Gegensatz zwischen radikalen Säkularisten und ebenso gesinnten Islamisten nicht aus. Vor allem gehe es hier auch, so die These des Autors, der sich dabei etwa auf die Studien der türkischen Soziologin Nilüfer Göle stützt, um den Gegensatz zwischen einerseits einer westlich orientierten urbanen Elite, die den radikalen säkularistischen Staat und somit ihre privilegierte Stellung mit autoritären und repressiven Mitteln beharrlich verteidigt, und andererseits einer noch traditionell und islamisch geprägten Bevölkerung, die vom Land in die Städte gewandert ist, ohne ihren ursprünglichen ländlich-religiösen Konservatismus zumindest teilweise aufgegeben zu haben. Sie, schreibt Hermann, ist die eigentliche Machtbasis der AKP Erdogans, der "Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung":
"Noch viel mehr als von der Kritik an der Praxis des Säkularismus profitiert die AK Parti von der Spaltung des Landes in eine abgehobene urbane Staatselite und in eine demografische Mehrheit, die sich nicht länger von dieser Staatselite führen lassen will. Diese Mehrheit ist an der Peripherie Anatoliens aufgebrochen und im Zentrum der Städte angekommen. Die AK Parti wurde ihre politische Partei."
Inwieweit hier die demografische Entwicklung, also die Geburtenraten der beiden konkurrierenden Gruppen, eine Rolle spielt, ist indessen nicht ganz klar. Auch über die Ideologie der heute im Land herrschenden Islamisten hätte man gerne mehr erfahren. Dass sich Erdogans Gefolgschaft wesentlich von der älteren und radikalen Islamisten-Generation unterscheidet, die in den späten neunziger Jahren unter der Führung von Necmettin Erbakan an die Macht gekommen war, wird dem Leser deutlich vor Augen geführt.
Ebenso dass sie anders als ihre Vorgänger westlich und neoliberal orientiert ist und keineswegs die Abschaffung des säkularen Staates beabsichtigt, zugleich aber wie die alte Garde sozial engagiert ist. Doch der Inhalt des Programms der AKP, dieser neuartigen hybriden Partei, mit dem die Islamisten einem bis vor kurzem unterprivilegierten Bevölkerungsteil mehr Gerechtigkeit und Wohlstand und die Tolerierung unterschiedlicher Lebensstile versprechen, wird vom Autor nur flüchtig gestreift.
Hier hätte man sich eine detailliertere Darstellung gewünscht, auch was die Schilderung ihrer Rekrutierungsmethoden betrifft. Zu erfahren ist lediglich, dass das AKP-Programm keinerlei Verweis auf den Islam enthält und dass die engagierte und Hunderttausende Freiwillige umfassende Parteibasis auch zwischen den Wahlen aktiv ist - und zwar immer auch vor Ort; ganz anders als die übrigen Parteien, die ihre Aktivisten nur im Wahlkampf auf Tour schicken.
Gleichwohl verweist Hermann in diesem Zusammenhang auf den türkischen Politologen Ziya Önis, der die Popularität der AKP auch darauf zurückführt, dass sie sich die erfolgreiche Lokalpolitik ihrer islamistischen Vorgänger geschickt zunutze zu machen versteht. Zudem, erläutert der Verfasser,
"verpflichtete sich die AK Parti, entschieden gegen die Korruption vorzugehen. Als einzige Partei sprach sie für die Gesellschaft und die Rechte des Einzelnen, die sie gegen den autoritären Staat schützen wollte und will. Selbst wenn ihre Gründer in der islamistischen Bewegung der Türkei groß geworden sind, befand sich die AK Parti näher an den liberalen Grundsätzen Europas."
Tatsächlich ist die Anpassung an die EU-Normen, die die AKP unter Erdogan in den letzten Jahren im rechtlichen und wirtschaftlichen Bereich massiv betrieben hat, aus Hermanns Sicht der eigentliche Grund für ihren anhaltenden Erfolg. Diesen sogenannten EU-Prozess, der mit einem starken Wirtschaftsaufschwung einhergeht, versucht die alte säkularistische Staatselite permanent zu bremsen: Die Stärkung der Menschenrechte bedeutet für sie nämlich Machtverlust, da ihr damit jene herkömmlichen Repressionsmittel, die sie mit der bloßen Berufung auf die Staatssicherheit bislang willkürlich einsetzen kann, entzogen würden.
Die AKP hingegen versteht es, aus dem EU-Prozess auch für sich Kapital zu schlagen und kann neben dem wirtschaftlichen Aufschwung inzwischen auch auf zahlreiche andere Errungenschaften verweisen. So auf die in den Jahren 2002 bis 2004 erfolgte endgültige Abschaffung der Todesstrafe sowie der berüchtigten Staatssicherheitsgerichte - und, wie Hermann näher ausführt,
"modernisiert wurde der Strafvollzug, eingeführt wurden Jugendgerichte; die Folter verschwand in kurzer Zeit aus den Gefängnissen, Ermittlungen gegen Folternde sind nun mit Vorrang zu verfolgen; verbessert wurde das Versammlungsrecht, erschwert wurde das Verbot einer Partei. Es entstand ein neues Strafgesetzbuch, (…) auch eine neue Strafprozessordnung und ein neues Zivilgesetzbuch, das die 'Ehre' der Familie zugunsten der Rechte der Frau aufgibt."
Auch wollen die islamistischen Pragmatiker die Fehler der Säkularisten beim Umgang mit den Minderheiten der Kurden, Aleviten und Christen nicht wiederholen und setzen hier stärker auf Dialog und Integration. Kompromisslos bleiben sie allerdings beim Streit um das Recht der Frauen, das Kopftuch überall zu tragen, und stoßen dabei auf den nicht weniger erbitterten Widerstand der säkularen kemalistische Elite. Diese rekrutiert sich nach wie vor aus Militär und Nationalisten und will die Kontrolle über die religiösen Institutionen nicht abgeben. Dass sie bei der Bekämpfung ihrer Gegner bisweilen von halblegalen paramilitärischen Nationalistengruppen unterstützt wird, deren brutale Methoden in dem Buch anschaulich beschrieben werden, hat sie nur weiter diskreditiert.
Auch Hermanns fesselnde Darstellung der ungeheuer dynamischen und immer pluralistischer gewordenen türkischen Kulturszene macht deutlich, dass das Land einen Weg beschritten hat, von dem es kein Zurück mehr gibt. Jedenfalls solange nicht, wie die Islamisten am EU-Prozess festhalten und die EU ihrerseits ihnen dabei weiter entgegenkommt.
Dies kann sich nach Einschätzung des Autors nur lohnen. Denn der charismatische Erdogan habe es dank seines staatsmännischen Geschicks in kürzester Zeit vermocht, die Türkei in eine allseits geachtete Regionalmacht zu verwandeln. Von deren geostrategischer Lage würde die EU künftig nur profitieren. Und nur profitieren kann auch der Leser von der Lektüre dieses längst überfälligen Buches.
Rainer Hermann: Wohin geht die türkische Gesellschaft?
Kulturkampf in der Türkei
dtv Verlag, München 2008
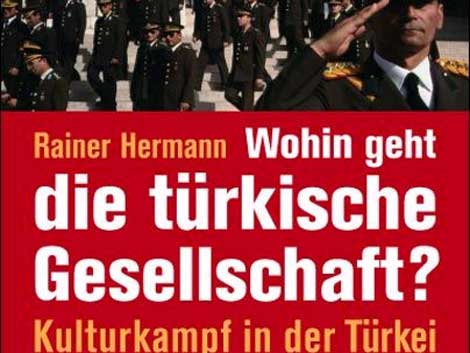
Rainer Hermann: Wohin geht die türkische Gesellschaft© dtv Verlag
