"Wir wollten die Geschichte so wahrhaftig wie möglich erzählen"

Sieben Jahre nach den Morden auf der norwegischen Ferieninsel Utøya kommt nun ein Film darüber in die Kinos. Regisseur Erik Poppe hat sich entschieden, die Geschichte radikal aus der Opferperspektive zu erzählen – in nur einer einzigen Kamerafahrt.
Stephan Karkowsky: Am Donnerstag kommt ein bedrückender Film in die Kinos. Er heißt "Utøya 22. Juli" und beschreibt das Massaker 2011 auf der Ferieninsel aus der subjektiven Sicht der Überlebenden. Der Film ist gedreht in einer einzigen Kamerafahrt und führte auf der Berlinale zu Diskussionen, ob hier Leiden voyeuristisch inszeniert wird. Filmredakteurin Susanne Burg sprach darüber mit dem norwegischen Regisseur, mit Erik Poppe, der sich noch genau an den Tag der Attentate erinnern kann.
Erik Poppe: Ich saß gerade im Auto und fuhr zurück nach Oslo, nachdem ich zwei Wochen Ferien gehabt hatte, als mich meine Assistentin anrief. Sie schrie regelrecht ins Telefon, etwa eine Minute, nachdem die Bombe im Zentrum von Oslo hochgegangen war.
"Geh so schnell du kannst nach Hause"
In dem Gebäude, in dem sie saß, hat alles gezittert, die Fenster waren zerborsten, und ich sagte ihr einfach nur: 'Geh so schnell, wie du kannst, nach Hause.' Daraufhin machte ich das Radio an, aber zuerst waren die Nachrichten noch gar nicht so weit, bis dann die ersten Nachrichtensendungen kamen. Ich fuhr erst mal nach Hause.
Ursprünglich war es geplant, dass ich an diesem Abend auf eine Geburtstagsparty gehe. Ich bin dann auch zu dieser Geburtstagsparty gegangen, aber da saßen eigentlich alle nur herum und verfolgten die Nachrichten. Und plötzlich hörten wir dann eben auch, dass in Utøya, im Norden Oslos auf dieser Insel, Schüsse gehört wurden, Hubschrauber kreisten plötzlich über dem Ort, an dem ich mich befand, weil der befand sich etwa in der Mitte zwischen Utøya und Oslo.
Es war einfach total schockierend, und dann im Verlauf des Abends wurden aus schlechten Nachrichten fürchterliche Nachrichten. Es war einfach eine schreckliche Nacht.
Susanne Burg: Die Ereignisse haben Norwegen schwer erschüttert. Das Ganze ist nun sieben Jahre her. Warum hatten Sie das Gefühl, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist für einen Film?
Erik Poppe: Mir war einfach klar geworden, dass plötzlich ganz andere Themen in den öffentlichen Fokus gerückt waren. Man fragte sich, wie man das Zentrum von Oslo wiederaufbauen solle, wo der Ort für ein Denkmal für die Opfer von Utøya errichtet werden könnte. In der gesamten Diskussion fehlte mir beispielsweise, dass man noch mal genauer analysierte, wo dieser Terrorist herkam.
Keine Diskussion über den Rechtsextremismus
Er war ein Rechtsextremer, und diese Debatte fehlte. Dass sich Rechtsextremismus ausbreitet, darüber gab es überhaupt keine Diskussion.
Wann immer wir in den Medien über Schulmassaker informiert werden oder über weitere Terrorattacken, dann geht es immer nur um die Täter. Das ist natürlich nicht uninteressant, aber was ist mit den Opfern? Und ich wollte mit meinem Film auch emotional reagieren und eine gewisse Wut ausdrücken und einfach Fragen stellen. Und das sind eben Fragen, wie können wir solche Tragödien in Zukunft verhindern? Das ist eine Frage, die müssen wir einerseits den Politikern stellen, aber die müssen wir auch uns selbst stellen.
Burg: Sie haben ja auch beschlossen, den Film radikal aus der Perspektive der Opfer zu erzählen, eines Opfers, der 18-jährigen Kaya, die zusammen mit ihrer jüngeren Schwester im Camp ist.
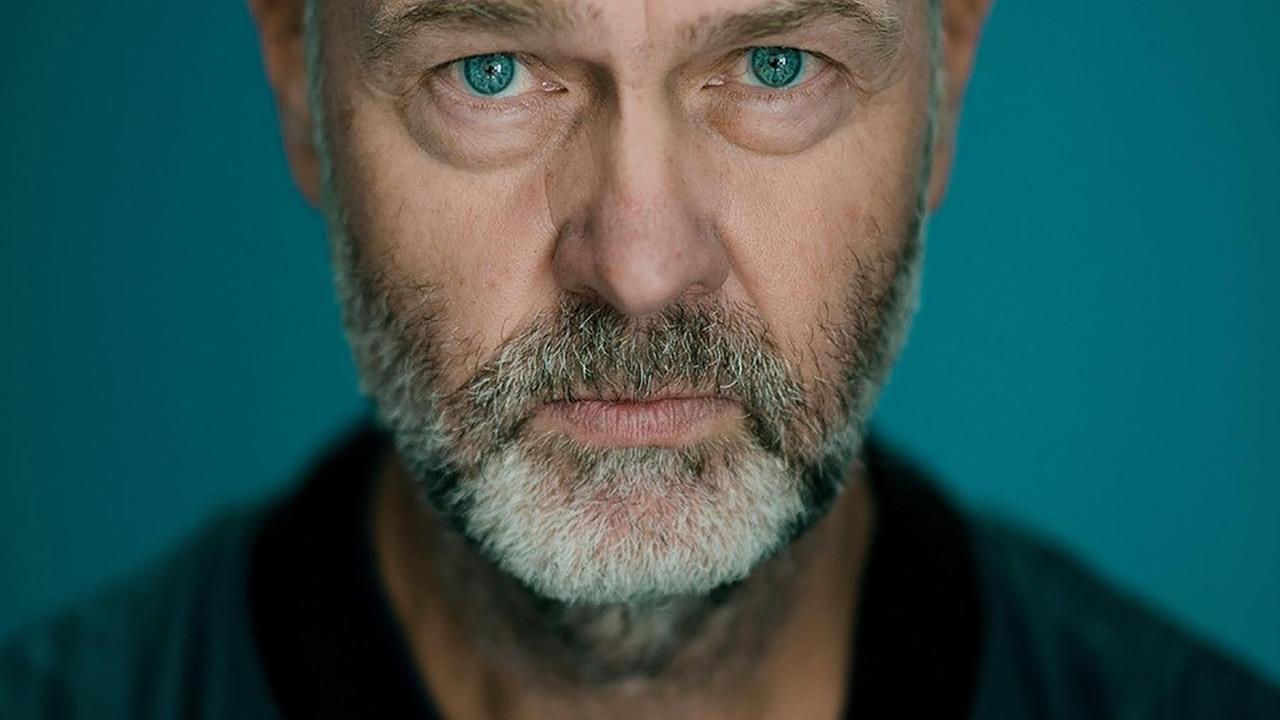
Der norwegische Regisseur Erik Poppe© Erik Burås/Studio B13/Weltkino Filmverleih
Die beiden werden bei dem Angriff getrennt, und Kaya sucht dann ihre Schwester. Alles ist in einer Einstellung gedreht. Warum diese Entscheidung? Warum wollten Sie, dass wir als Zuschauer bei Kayas Perspektive bleiben?
Poppe: Normalerweise, wenn wir Filme sehen, die mit Terrorattacken zu tun haben, dann wird das in einer Art Hollywood-Ästhetik gezeigt. Es wird wild hin und her geschnitten zwischen den Tätern und den Opfern, zwischen den Bösen und den Guten. Aber das schafft letztendlich eine Distanz beim Zuschauer.
Ich habe mich gefragt, wie kann ich es schaffen, beim Zuschauer eine Art Bewusstsein für dieses schreckliche Ereignis zu schaffen, auch, dass man eine Präsenz fühlt, wenn man zuschaut.
Das war der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, das in einer einzigen Einstellung zu drehen, weil die Überlebenden, mit denen ich geredet habe, die haben alle gesagt, dass diese 72 Minuten, die das gedauert hat, sich wie endlos angefühlt haben. Und jetzt war für mich eben die Frage, wie drücke ich diese Endlosigkeit der Zeit aus. Und da blieb mir nicht sehr viel anderes übrig, als das genau in einer Einstellung in genau derselben Zeit, nämlich in 72 Minuten zu erzählen.
Burg: Was waren die Herausforderungen, in einer Einstellung zu drehen?
Gespräche mit vielen Überlebenden
Poppe: Wie gesagt, es ging mir darum, dass ich so ehrlich und wahrhaftig wie möglich erzählen wollte. Ich hatte ja mit sehr vielen Überlebenden gesprochen. Nun bestand natürlich die erste Herausforderung darin, Schauspieler zu finden, die das spielen können, junge Leute, die natürlich auch Amateurschauspieler sind und den gesamten Film tragen müssen.
Das war natürlich schwer, und da machte ich mir Sorgen, ob es genug junge, talentierte, nichtprofessionelle Schauspieler gibt, die das ausdrücken können. Aber wir haben dann den ganzen Sommer geprobt, sind wirklich von Szene zu Szene gegangen. Ich habe auch versucht, sie mental vorzubereiten, nicht dass das irgendwelche Traumata entstehen.
Und dann entstand auch ein weiteres Problem: Wie präsentiere ich diesen Film dem Publikum, damit das nicht wie ein Horror- oder wie ein Genrefilm wirkt, der irgendwie austauschbar ist. Daher waren wir auch sehr dezent, wenn es um das Marketing dieses Films ging.
Burg: Sie sprechen da ethische Fragen an, solche wie: Wie viel sollen wir als Zuschauer sehen? Wie viel können Sie als Regisseur zeigen, ohne dass Sie sich dem Vorwurf aussetzen, das Leiden von Menschen auszuschlachten und voyeuristisch zu sein?
Sie haben sich darüber Gedanken gemacht. Und trotzdem lebt auch Ihr Film natürlich von der Spannung. Als ich im Kino war, haben die Zuschauer fast die Luft angehalten und sich quasi mit Kaya zusammen versteckt, so als seien sie Teil der Szene. Das heißt: Geht das überhaupt, einen Film zu machen, der Spannung erzeugt und nicht gleichzeitig auch Entertainment ist?
Ein Anti-Film, kein Horrorfilm
Poppe: Es gibt viele Spannungselemente in dem Film. Und trotzdem haben wir versucht, das als einen Art Anti-Film zu inszenieren. Wir wollten eben die Geschichte so wahrhaftig wie möglich erzählen. Natürlich, wie unterscheidet man sich dann von einem Horrorfilm? Das hat vielleicht etwas damit zu tun, wie man die Helden zeigt, die ja sonst immer sehr eindimensional dargestellt werden.
Und Kaya ist jemand – ja, sie hilft Leuten, aber sie macht auch Fehler. Sie begegnet diesem Jungen im Zeltlager und schickt ihn einfach nur in den Wald, und das ist die falsche Entscheidung, und wir wissen das auch als Zuschauer.
Wir begegnen diesem Jungen ja noch einmal wieder. Aber mir war es doch sehr wichtig, diese Realität zu zeigen. Natürlich kann man mir die Frage stellen, warum habt ihr diesen Film gemacht, und was erwarte ich von dem Publikum, wenn es aus diesem Film herauskommt. In erster Linie möchte ich, dass man sich Fragen stellt. Man soll sich fragen, wie man in Zukunft so etwas verhindern kann, und deswegen wollte ich dieses gewisse Bewusstsein schaffen.
Burg: Was waren denn die Reaktionen auf den Film, besonders in Norwegen?
Poppe: Zunächst waren doch sehr viele sehr skeptisch. Viele haben auch gesagt, so einen Film könnten sie sich einfach nicht anschauen. Die Leute, die dann den Film sich angesehen haben im Kino, da hat sich das dann auch so ein bisschen herumgesprochen, dass der Film nicht so brutal ist. Das führte dann dazu, dass die Zuschauerzahlen etwas besser wurden. Aber wie gesagt, die Frage, die man sich wirklich stellen soll, ist, wie hätte man sich selbst verhalten, und was kann man tun?
Karkowsky: Erik Poppe über seinen Film "Utøya 22. Juli". Kinostart ist morgen. Und eine längere Version dieses Interviews hören Sie am Samstag in unserer Filmsendung "Vollbild".
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.






