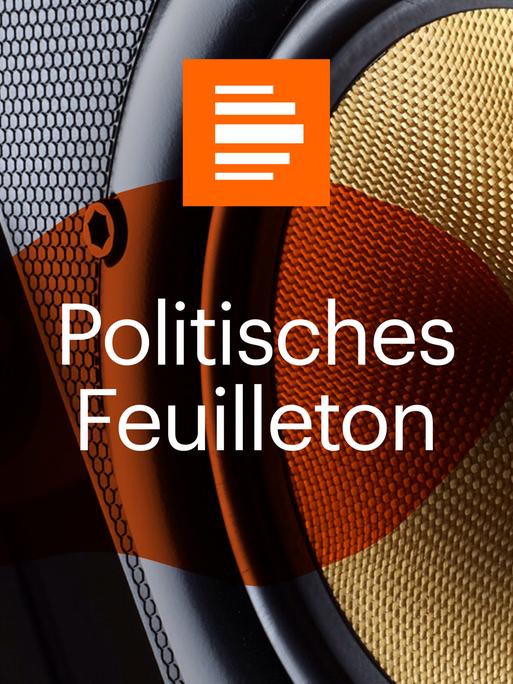Die verbale Waffe "Anti"

Es gibt Wörter, die sind politisch und ideologisch aufgeladen wie Antikapitalismus oder Antifaschismus. Das merken meist aber nur diejenigen, gegen die sie argumentativ eingesetzt werden. Wer eine verbale Waffe nutzen möchte, setzt also am besten ein "Anti" davor.
Das Präfix "anti" kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "gegen". Es bildet Antonyma, was heißt: Es will einen Widerspruch, einen Gegensatz feststellen zum Inhalt des jeweiligen Beziehungsworts. Ein Beispiel sei die Antipathie, zu Deutsch Abneigung, als Gegensatz zur Sympathie, der Zuneigung, oder zur Empathie, der Einfühlung.
"Antipathie" ist insgesamt griechischer Herkunft, anders als etwa das Antidepressivum, der Gemütsaufheller aus der Apotheke. Depression und Depressivum sind lateinische Wörter. Das griechische "anti" hat die Fähigkeit, an Wörter aus anderen Sprachen anzudocken, was auch reichlich geschieht.
So beim Antialkoholismus. Das Wort Alkohol ist arabischen Ursprungs. Antialkoholismus meint den radikalen Verzicht, wenn nicht das Verbot von Ethanol-haltigen Getränken. Alkoholismus hingegen meint den krankhaften Missbrauch von Alkohol, nicht den Genuss schlechthin.
Wir sehen: Zusammensetzungen mit "anti" haben eine Tendenz zur Ungenauigkeit. Dies gilt zumal für Wendungen aus dem politisch-gesellschaftlichen Bereich.
Nehmen wir den Antisemitismus. Er steht als Synonym für Judenhass. Unter "Semitismus" versteht die Sprachforschung seit Beginn des 19. Jahrhunderts die verwandten Idiome aus dem östlichen Mittelmeerraum, voran das Hebräische und das Arabische. Wörtlich genommen, lehnt der Antisemitismus beide Ethnien ab. Eben das tut er nicht.
Mit dem Antifaschismus verhält es sich ähnlich. Faschismus steht eigentlich bloß für die Ideologie und Staatspraxis des italienischen Diktators Mussolini. Er wird gleichermaßen verwendet für den Nationalsozialismus Hitlers, die Falange des spanischen Generals Franco, für die Pfeilkreuzler in Ungarn und die Militärdiktaturen in Lateinamerika.
Ungenau, diffus, beliebig
Die alle haben vieles gemeinsam, identisch sind sie nicht. Derart wird der Begriff aufgeweicht. Er wird ungenau, diffus, beliebig. Gegenwärtig beschimpfen die Separatisten in der Ost-Ukraine das Regime in Kiew als faschistisch. Umfragen ergeben, dass die meisten, die das Wort verwenden, gar nicht wissen, was damit gemeint ist.
Derzeit kann man hören, die Deutschen zeigten eine wachsende Neigung zu Antikapitalismus und Antiamerikanismus. Was will Antikapitalismus hier besagen? Ist damit die radikalmarxistische Gegnerschaft zum Kapitalismus gemeint? Die gibt es gewiss, doch nur mehr vereinzelt, da die sozialistische Planwirtschaft so schmählich scheiterte, weltweit.
Verbreitet ist die Abneigung gegen den zügellosen Neoliberalismus angelsächsischer Prägung, dem die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhardt gegenüber steht. Auch die ist Kapitalismus. Als Wirtschaftsprinzip scheint er derzeit ohne Alternative, was man bedauern mag oder nicht, der Vorwurf "Antikapitalismus" jedenfalls greift ins Leere.
Wenden wir uns dem Antiamerikanismus zu. Hier darf gefragt werden, woran man ihn denn festmacht. Geht es darum, die USA in Gänze abzulehnen? Dies dürfte für Lateinamerika zutreffen, wo die Gringos und ihr Herkunftsland vielfach verhasst sind.
Was soll uns das Wort Antiamerikanismus sagen?
Hierorts wenden sich viele gegen die dort praktizierte Todesstrafe, oder gegen die Außenpolitik von George W. Bush. Ist dies schon Antiamerikanismus? Die nämlichen Leute lieben das große Land mit seinen landschaftlichen Schönheiten und seinen kulturellen Impulsen. Was will dieses Wort besagen?
Zumal das Positivum "Amerikanismus" nicht im allgemeinen Gebrauch ist. Schon dies macht den Antiamerikanismus zu einem konturlosen Ungefähr. Man sollte ihn aussortieren. Überhaupt wäre bei Wörtern, die mit "anti" beginnen, viel mehr Vorsicht geboten. Ich fürchte nur, daran wird man sich nicht halten.
Rolf Schneider stammt aus Chemnitz. Er war Redakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift Aufbau in Berlin (Ost) und wurde dann freier Schriftsteller. Wegen "groben Verstoßes gegen das Statut" wurde er im Juni 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, nachdem er unter anderem in einer Resolution gegen die Zwangsausbürgerung Wolf Biermanns protestiert hatte. Veröffentlichungen u.a. "November", "Volk ohne Trauer" und "Die Sprache des Geldes". Seine politischen und künstlerischen Lebenserinnerungen fasst er in dem Buch "Schonzeiten. Ein Leben in Deutschland" (2013) zusammen.

Schriftsteller Rolf Schneider© picture alliance / dpa