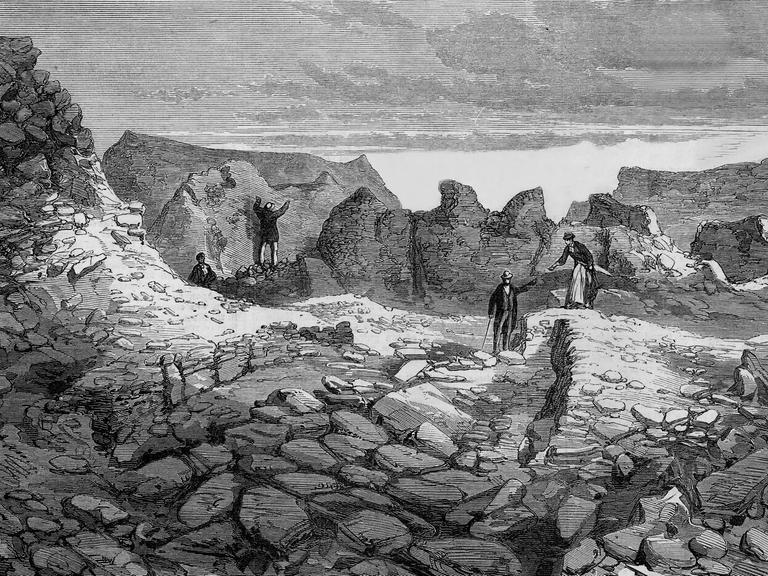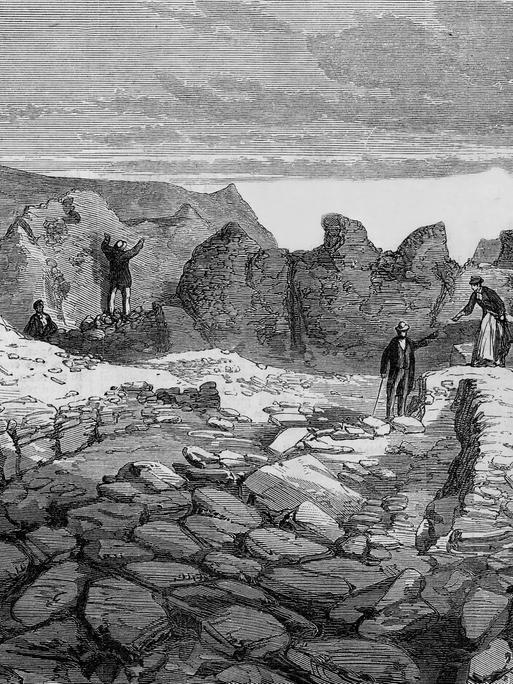Stefan Rebenich: „Die Deutschen und ihre Antike. Eine wechselvolle Beziehung“
Klett-Cotta Verlag, 2021
496 Seiten, 38 Euro
Stefan Rebenich: "Die Deutschen und ihre Antike"
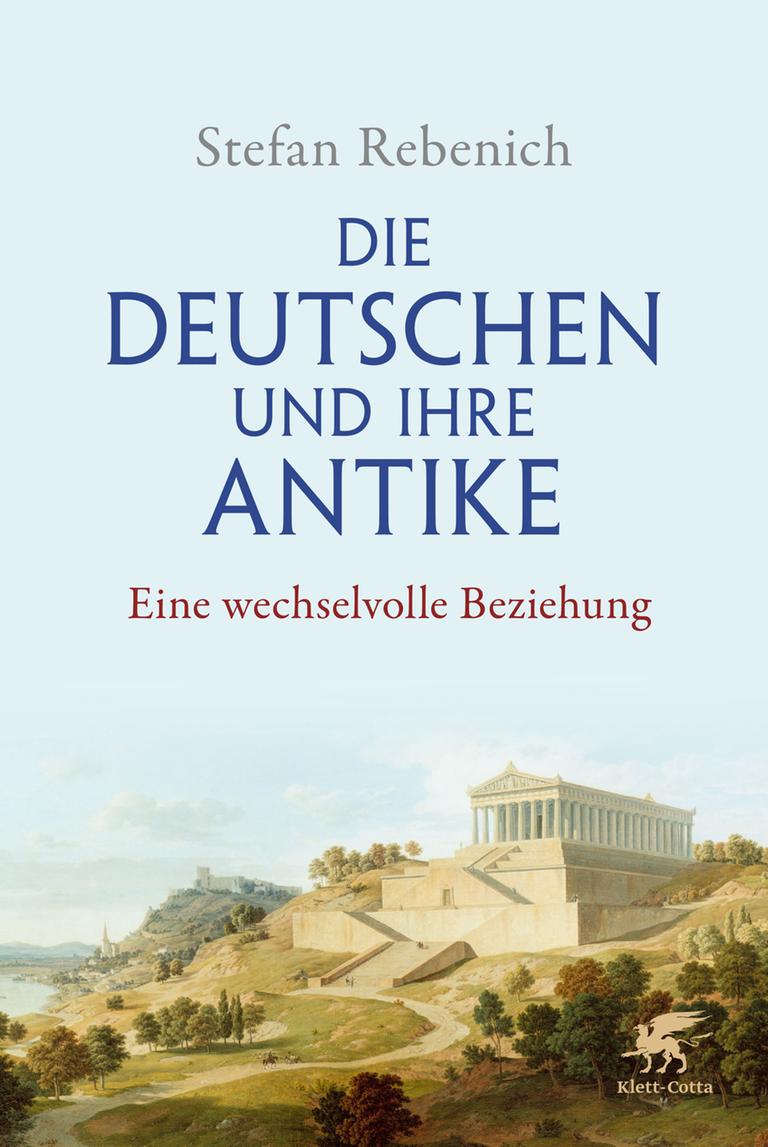
© Klett-Cotta
Über die merkwürdige Sehnsucht nach dem Altertum
07:19 Minuten
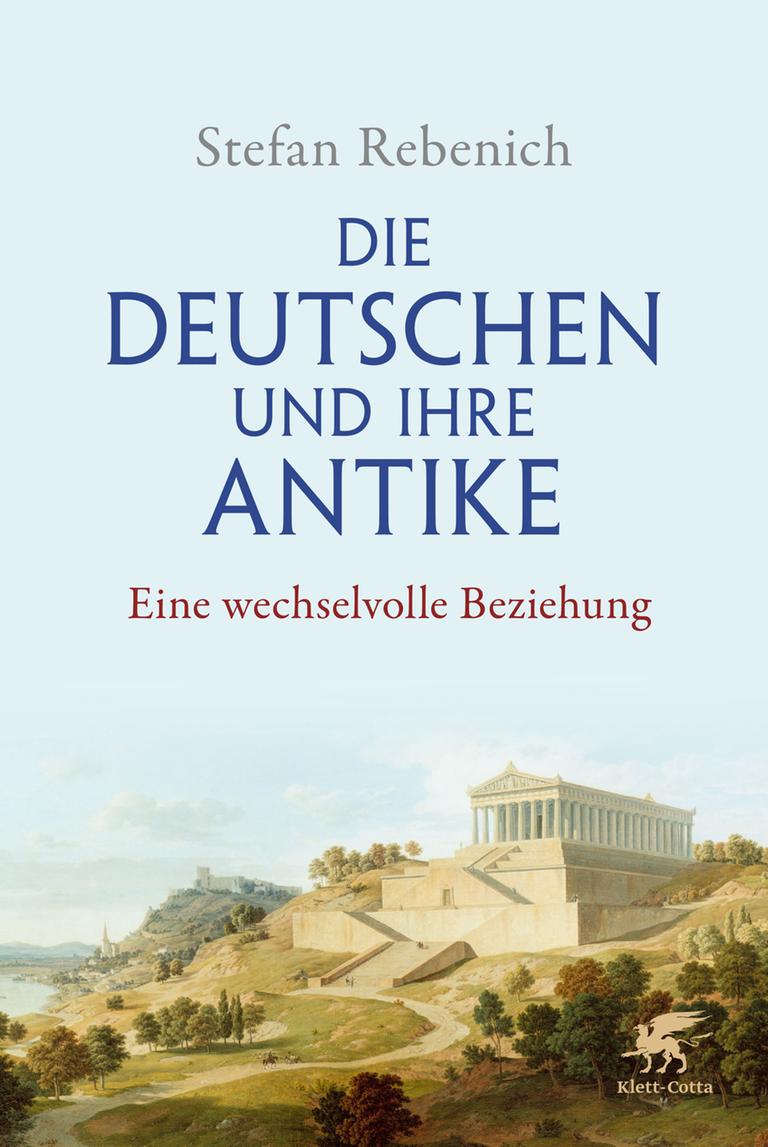
Stefan Rebenich
Die Deutschen und ihre Antike. Eine wechselvolle BeziehungKlett-Cotta Verlag, Stuttgart 2021496 Seiten
38,00 Euro
Der deutschen Altertumsforschung galt die Antike als Leitbild des edlen Menschseins. Sie selbst war nicht nur von Idealismus geprägt, sondern auch von Duckmäusertum, Zank und Streit. Stefan Rebenich erzählt diese Wissenschaftsgeschichte auf hohem Niveau.
Vorab eine Frage: Ein Buch mit dem Titel „Die Altertumsforschung in Deutschland“ – würden Sie sich das kaufen? Falls Sie vom Fach sind, vielleicht, sonst eher nicht – stimmt's? Umso besser, dass Stefan Rebenichs Buch „Die Deutschen und ihre Antike“ heißt. Denn da fliegen die Gedanken gleich los...
Nämlich zu Hölderlins „Seliges Griechenland! du Haus der Himmlischen alle“, zu Schinkels klassizistischer Architektur, zu Schliemanns Troja, Hitlers Faible für antike Schlachten, Ex-Verteidigungsminister Guttenbergs hochmütigem Hinweis, er lese Platon im Urlaub im Original, und so weiter und so fort.
190 Seiten ohne Frauen
Der Haken daran: Um all das geht es in Rebenichs Buch nicht oder, was Hitler betrifft, nur am Rande. Sondern eben um die Altertumsforschung in Deutschland: um ihren Einfluss auf Bildung und Schule, um gewaltige Projekte der wissenschaftlichen Akademien, um Netzwerke und Streitigkeiten der Gelehrten, um die Rupturen der Weltkriege und die Kontinuitäten danach. Der Name einer Frau taucht übrigens erstmals auf Seite 190 auf.
Ja, das ist immer wieder trockene Kost – und zugleich immer wieder faszinierend, hier und da sogar richtig aufregend im Sinne eines tiefen Blicks hinter die Kulissen deutscher Antike-Begeisterung, die über zwei Jahrhunderte Konservative wie Progressive, Linke wie Rechte, Träumer wie Realisten mitgerissen hat.
Das wars auch schon mit Winckelmann
„Am Anfang war Winckelmann“, lautet der erste Satz nach der Einleitung – eine unverzichtbare Anspielung auf jenen schwärmerischen Mastermind des hiesigen Klassizismus, Johann Joachim Winckelmann, der die „Nachahmung der Alten“ für den einzigen Weg zu wahrer Größe hielt.
Aber das wars auch schon mit Winckelmann. Rebenich geht sofort über zu dem Bildungsprogramm, das Wilhelm von Humboldt für Preußens Gymnasien entwarf.
Aber das wars auch schon mit Winckelmann. Rebenich geht sofort über zu dem Bildungsprogramm, das Wilhelm von Humboldt für Preußens Gymnasien entwarf.
Er schreibt: „Die griechische Sprache als Produkt des griechischen Geistes und als Ausdruck des griechischen Nationalcharakters besaß den absoluten Vorrang, da in ihr Einheit und Vielheit, Sinnliches und Geistiges, Objekt und Subjekt, Welt und Gemüt harmonisch verbunden seien (so Humboldt). Die Beschäftigung mit einer derart komplex strukturierten Sprache sollte nicht nur die eigene sprachliche Kompetenz fördern, sondern vielmehr den Menschen helfen, sich umfassend zu bilden und sich die Welt zu erschließen.“
Mit den Griechen gegen Frankreich
Und so kam es. Das Bürgertum avancierte auch dank seiner altsprachlichen Bildung zum selbstbewussten Bildungsbürgertum – und bekam damit etwas Eigenes in die Hand.
Rebenich: „Dem deutschen Bürgertum bot die Vergegenwärtigung der klassisch-griechischen Vergangenheit eine willkommene Alternative zur französisch-lateinischen Kulturhegemonie in Europa. Die nationale Begeisterung für die alten Griechen richtete sich gegen Frankreich und die 'Gallomanie' des deutschen Adels, gegen den absolutistischen Staat und die Ständegesellschaft. Die 'Gräkomanie' war zugleich ein wichtiges Instrument der nationalen Identitätssicherung.“
Große und mittelgroße Gelehrte
An diesem Punkt könnte das Buch ins politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben im 19. Jahrhundert ausgreifen. Rebenich jedoch zieht es zu den neu gegründeten Altertumswissenschaften mit der Klassischen Philologie an der Spitze.
Deren Zuständigkeiten fasste Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, eine der frühen Koryphäen des Faches und Prorektor der Uni Göttingen, einst grandios zusammen: „Die Partikel ἀν [an] und die Entelechie des Aristoteles, die heiligen Grotten Apollons und der Götze Besas, das Lied der Sappho und die Predigt der heiligen Thekla, die Metrik Pindars und der Meßtisch von Pompeji, die Fratzen der Dipylonvasen und die Thermen Caracallas, die Amtsbefugnisse der Schultheißen von Abdera und die Taten des göttlichen Augustus, die Kegelschnitte des Apollonios und die Astronomie des Petosiris: alles, alles gehört zur Philologie, denn es gehört zu dem Objekte, das sie verstehen will, auch nicht eines kann sie missen.“
Rebenich würdigt große und mittelgroße Gelehrte in erschütternder Zahl. Allenfalls von den prominentesten, etwa Theodor Mommsen und Johann Gustav Droysen, viel später Christian Meier, dürfte das Publikum mehrheitlich mehr wissen, als dass Straßen nach ihnen benannt wurden.
Entnervt vom Forschungsalltag
Aber das macht nichts. Oft verdichten sich die professoralen Kämpfe um Posten und Projekte, um Anerkennung und Macht, um Forschungsgelder und Editionen zu allzumenschlichen Dramen – nicht ohne weiteres Netflix-tauglich, aber durchaus packend.
Theodor Mommsen etwa stöhnte über die mächtige Berliner Akademie der Wissenschaften, in der er selbst Mitglied war: „Übrigens können die Berliner mich lecken, wo sie wollen."
Zugleich erschien der Forschungsalltag vielen ermüdend. Ein hämischer Doktorand verfasste die Satire „Die Wissenschaft des Nicht-Wissenswerten“.
Beklemmende Lebensbilanz eines Ägyptologen
Beklemmend liest sich die Lebensbilanz des Ägyptologen Adolf Ermann. „Ich habe dreißig Jahre lang alle Arbeiten und Hilfsarbeiten mitgemacht, ich habe Texte verglichen und unendliche Texte übersetzt, ich habe 4000 Stellen autographiert und auch beim Ordnen der Zettel geholfen, zuletzt habe ich 18 Jahre lang die gesammelten Zettel - es waren 1 300 000 Stück – durchgearbeitet.“
Frische Injektionen taten not. Friedrich Nietzsche, der Außenseiter, mischte die Zunft im Zeichen des Lebens auf wie kein Zweiter. Sozialdarwinistische Konzepte fanden Gefallen, Begriffe wie "Volk" und "Rasse" griffen um sich.
Duckmäuser und Mittäter in der NS-Zeit
Der priesterlich-guruhafte Lyriker Stefan George stilisierte einflussreich, aber fern aller Akademien Platon zu einem spirituellen Lehrer, an dem die Experten bis dato stur vorbei geforscht hatten – und fantasierte: „Dass ein strahl von hellas auf uns fiel: darin finde man den umschwung des deutschen wesens bei der jahrhundertwende.“
Den Ruhm des Widerstands haben die Altertumswissenschaftler nie erbeutet – nicht im Ersten Weltkrieg und schon gar nicht in dem Reich, das sich das Dritte nannte. Die allermeisten ließen tatenlos geschehen, was geschah, einige machten engagiert mit.
Rebenich untersucht die fachlichen Folgen der deutschen Teilung und nähert sich vorsichtig der Gegenwart. Viele Lehrstühle, begrenzte Relevanz – könnte das spröde Resümee lauten.
Da geht noch mehr
Aber Stefan Rebenich, der sein Buch so erkennbar wie elegant aus älteren Aufsätzen komponiert hat, glaubt als klassischer Philologe, dass da noch mehr geht – viel mehr.
Er schreibt: „Vor allem wird das antike Erbe weiter den Menschen aus intellektueller, politischer und moralischer Unmündigkeit befreien, weil es jedem Einzelnen – unabhängig von seiner Herkunft, Religion, Nation und Hautfarbe – individuell etwas sagt, das über den Tag hinaus Bestand hat.“