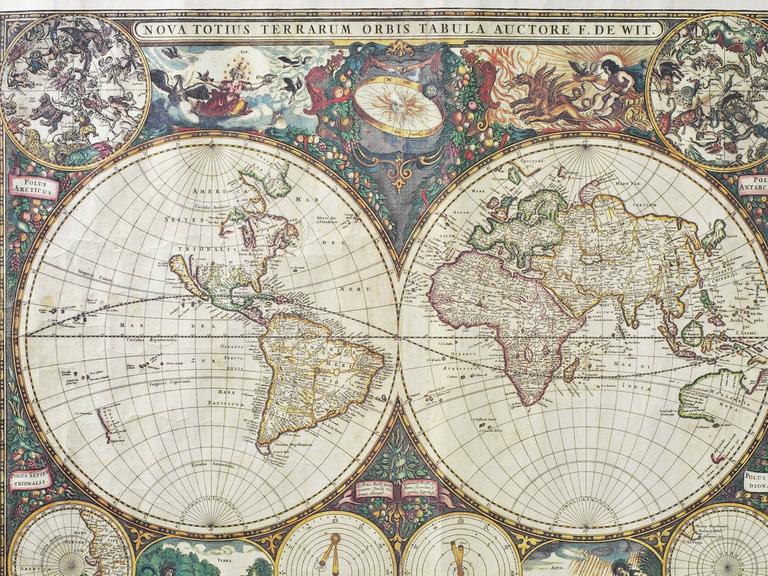Steven Uhly: Den blinden Göttern
Roman
Secession Verlag für Literatur, Zürich, Berlin
ca. 240 Seiten, 22,- €
Die Vorstellung der Einzigartigkeit als pure Illusion

Steven Uhly parodiert die Idee des literarischen Meisterwerks und das Bedürfnis nach geordneter Wirklichkeit. Sein Roman "Den blinden Göttern" feiert die Einbildungskraft des Lebens. Dabei sorgt er nicht nur für Verwirrung, sondern auch für Unterhaltung.
Dichtung und Wahrheit zusammen zu denken, was für ein Humbug! Steven Uhly, der genialste Täuscher unter den zeitgenössischen deutschen Romanciers, spielt hintersinnig und rasend komisch mit dem Hunger nach geistiger Erhebung und der Vorstellung vom Dichter als Künder und Seher. Die Dekonstruktion des Credos "Ohne Dichtung keine Wahrheit" verknüpft Uhly mit der Erzählung eines großen genealogischen Schwindels. Seite um Seite erhöht sich der Grad an Verwirrung. Wird eine Lüge entlarvt, ist die nächste schon geboren. Die Behauptung, das Leben sei "nichts als Verdunklung" steigert die Lust des Autors, Fährten maliziös und heiter zu vertuschen, jedenfalls enorm.
Annahmen, die nach und nach der Falschheit überführt werden
Im Zentrum des Romans stehen der menschenscheue Buchhändler Friedrich Keller, dem ein obdachlos wirkender Mann im angestammten Geschäft der Familie einen Stapel Gedichte überreicht hat, und sein nach langer Abwesenheit wieder aufgetauchter, sich indes nicht gleich zu erkennen gebender Bruder Heinrich. Dessen verwahrlostes Aussehen ähnelt dem des Überbringers der Gedichte. Dass dieser der Urheber der Sonette sei, ist eine der vielen Annahmen, die Uhly sukzessive der Falschheit überführt. Man hört ihn förmlich lachen über die Verehrungssucht des Buchhändlers, dem die Poeme "Geborgenheit" und "Heimat" bedeuten, während der übel riechende "Dichterfürst" selbst Tag für Tag im "Heißen Sporn" hockt und sich hemmungslos betrinkt.
Steven Uhly spielt mit dem Klischee der Geisteskraft, die einen schwachen Körper adelt, und dem Drang, sich einem bewunderten Dichter anzunähern, indem man sich benimmt wie er. Auch führt er das nachvollziehbare Streben eines alternden Familienvaters und Buchladenbesitzers vor, nicht mehr nur mit Lyrik zu handeln, sondern sich selber als Wortkünstler zu versuchen. Mehr als Aphorismen sind allerdings nicht drin. Und warum nicht auch kopieren, wenn’s doch keiner merkt?
Auf nichts ist Verlass
Im Eigenheim des Händlers kampieren später Fremde. Fröhlich entweihen sie die Hausbibliothek, das bürgerliche Refugium per se. Sie trinken, rauchen und gehen in den abgelegten, altmodischen Kleidern, Hemden, Hosen und Schuhen der Hauseigentümer umher. Man denkt an Flüchtlinge, die ein vertrautes Ambiente vorübergehend oder unwiderruflich zweckentfremden. Den Enteigneten verschafft der Verlust des Vertrauten sogar eine "geheimnisvolle, sinnlose Freude".
Auf nichts ist in Uhly’s Fiktion Verlass. Die zitierten Gedichte und sämtliche Narrative erweisen sich als zusammengestückelt und fingiert. Die Vorstellung der Einzigartigkeit entpuppt sich als pure Illusion. Auch die Idee der elterlichen Liebe wie das Ideal der Brüderlichkeit sind nur Schimären. Es wird ein Vatermord begangen, aber auch geschwisterliche Rivalität lädt zu blutigen Fantasien ein. Steven Uhly erfindet eine herrliche Schundromanszene, die obendrein eine Persiflage des Verhältnisses von Faust und Gretchen ist. Die groteske Verwechslung des einen (Friedrich) mit dem anderen (Heinrich) mindert nicht Gretas Spaß am Sex, führt schlussendlich aber doch nur dazu, dass "drei stille Körper auf blutrotem Bettzeug liegen". Ist das nun das Ende des Romans? Mitnichten.
Uhly parodiert ganz nebenbei auch seine Autorenrolle – und schenkt uns noch 29 Sonette.