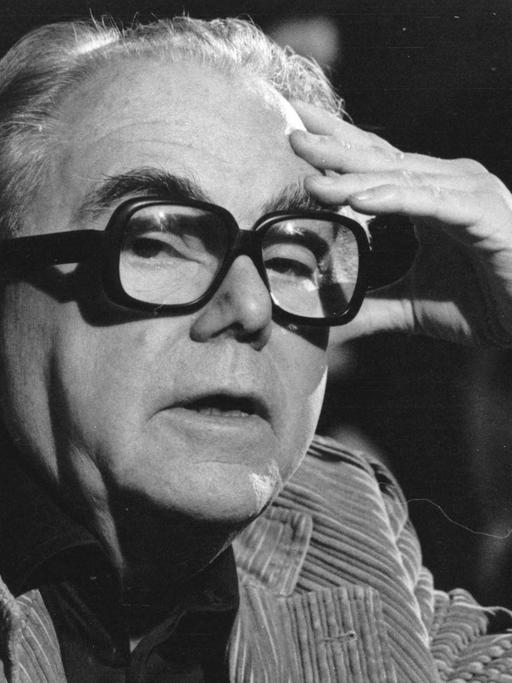Stig Dagerman: "Deutscher Herbst"
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Guggolz Verlag, Berlin 2021
192 Seiten, 22 Euro
Respektvolle Momentaufnahmen aus Nachkriegsdeutschland
Im Herbst 1946 schickt eine schwedische Zeitung den jungen Schriftsteller Stig Dagerman nach Deutschland. Er sieht zerstörte Städte, trifft Menschen, die in Kellern hausen, und behält in seinen Reportagen immer den Einzelnen im Blick.
Nur ein Jahr zuvor hatte Stig Dagerman mit dem Roman "Die Schlange" debütiert. Darin wandelt sich die konkrete Furcht von in Bereitschaft stehenden Soldaten des neutralen Schweden im Zweiten Weltkrieg zu existenzieller Not und einer Angst, die ihre eigene Ursache längst nicht mehr kennt.
Existenzielle Not
Von existenzieller Not berichten auch diese 13 Reportagen aus dem deutschen Hungerherbst 1946. Die Ursache der Not ist freilich bekannt. Sie ist das Ergebnis eines Eroberungskrieges, der mit einer vernichtenden Niederlage endet. Und mit der millionenfachen Flucht von Deutschen aus dem Osten, die im Westen "unwillkommen" sind. Ihnen widmet Dagerman einen eigenen Artikel.
Das Großartige an seinen Texten ist nun, dass er den Elenden und Besiegten nicht die Schmach antut, sie zu bemitleiden, sondern schlicht sagt, wie es ist, wodurch die Wirkung noch größer wird. Und er bewahrt den "Respekt vor der Persönlichkeit", vor dem einzelnen Menschen und seinem Leiden, "ganz gleich, ob dieses Leiden nun unverschuldet oder selbst verschuldet ist".
Überlebende, die in Kellern hausen
Der Autor kommt durch verheerte Städte - in Hamburg und im Ruhrgebiet -, er vergleicht die Ruinen mit Skeletten, besucht die Überlebenden, die in Kellern hausen und rügt den selbstgerechten amerikanischen Journalisten, der die Deutschen "immer noch nationalsozialistisch infiziert" sieht, weil sie bekennen, unter Hitler sei es besser gewesen als jetzt, wo man nichts als Schlamm, Kälte und Hunger kennt.
"Unbeschreibliche" Zustände, sagt man dann gern, dabei – darauf beharrt Dagerman – sei die Not sehr wohl zu beschreiben. Zum Beschreiben gehören auch die "weißen Gesichter" der "Kellermenschen", die praktisch seit vier Jahren in Bunkern leben, und die "auffallend roten Gesichter" junger Mädchen und Frauen, die sich für eine Tafel Schokolade den siegreichen alliierten Soldaten hingeben - wie zynisch in diesem Zusammenhang das Wort "Befreiungsarmee" klingt.
Auf der Suche nach innerem Frieden
Immer den einzelnen Menschen im Blick, berichtet der Autor fast wie ein Theaterkritiker von den skurrilen Verhandlungen vor den "Spruchkammern", wo es um die sogenannte Entnazifizierung geht. Er schließt mit der Begegnung mit seinem Freund, dem Eremiten (es ist der Schriftsteller Wolf von Niebelschütz, wie wir wissen), der inmitten der Ruinen Mörikes idyllische Verse zitiert und so ganz anders schreibt und denkt, aber eben wie Dagerman auf der Suche nach dem inneren Frieden ist.
"Journalistik ist die Kunst, so früh wie möglich zu spät zu kommen", lautet ein Bonmot von Dagerman in einem Brief. Er ist kein Journalist und kann gar nicht zu spät kommen, weil ihn die Sensationen, Katastrophen, nicht alltäglichen Vorfälle nicht interessieren. Dagerman kommt immer im rechten Moment, weil er im Alltag der Menschen ankommt.