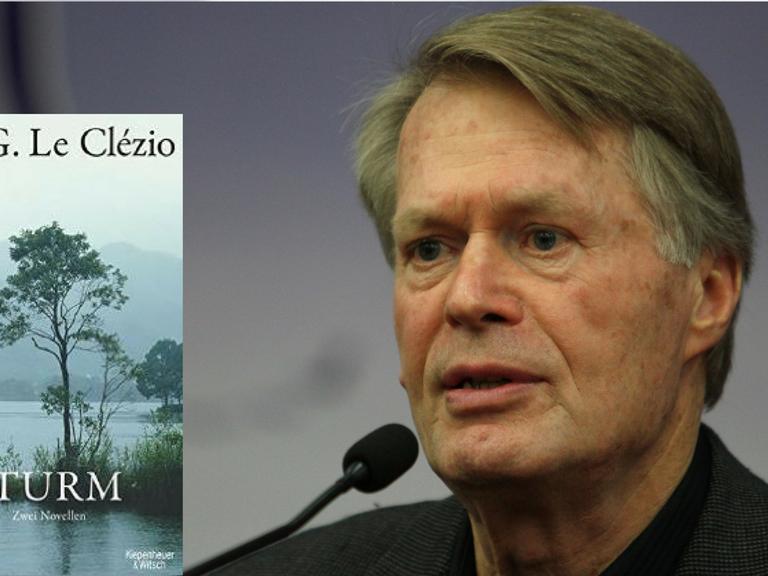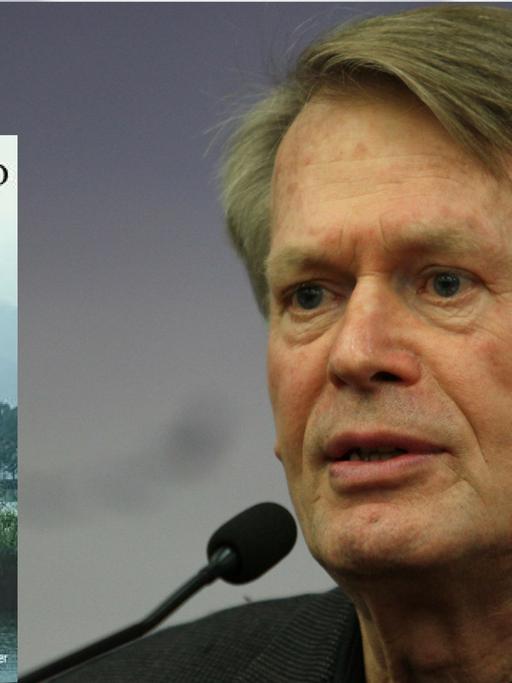Die Erstsendung war am 21. April 2017.
Wasserhosen, Windsbräute und Wirbelstürme
29:44 Minuten

Sie können grausam sein wie bei Victor Hugo, kommen aus heiterem Himmel wie bei Herman Melville und können sogar Ehen vereiteln wie bei Alexander Puschkin. In der Literatur spielen Stürme oft eine schicksalhafte Rolle.
Erreicht der Wind eine Geschwindigkeit von 75 Kilometern in der Stunde wird er zum Sturm. Dann richtet er auf der Erde verheerende Schäden an: Ernten werden vernichtet, Ansiedlungen zerstört, Menschen und Tiere getötet.
So ausgefeilt Wissenschaft und Technik auch sein mögen, Stürme können sie nicht verhindern. In der Literatur spielen sie deshalb in der Regel eine unheimliche und schicksalhafte Rolle – und zwar nicht nur als Zerstörer des Alten, sondern genauso oft als Begründer von etwas Neuem. Stürme, die für die einen den Tod bedeuten, können für andere eine Art Geburtshelfer sein. Sie korrigieren Unrecht, bestrafen Untaten, lösen Rätsel. Natürlich ziehen auch in vielen Werken der Literatur Stürme auf, nur um einer dramatischen Situation gewissermaßen den letzten Pfiff zu geben.
Aber wenn die Stürme nicht bloß Illustration einer inneren Verfassung sind, dann wird es interessant. Wenn die Natur mit der Gewalt eines Sturmes auftritt, wenn sie zur Person wird und sogar eine Seele bekommt, wie Victor Hugo schrieb, dann greift sie auch ein und lenkt das Leben einer oder mehrerer Figuren in andere Bahnen.
Aber wenn die Stürme nicht bloß Illustration einer inneren Verfassung sind, dann wird es interessant. Wenn die Natur mit der Gewalt eines Sturmes auftritt, wenn sie zur Person wird und sogar eine Seele bekommt, wie Victor Hugo schrieb, dann greift sie auch ein und lenkt das Leben einer oder mehrerer Figuren in andere Bahnen.
Korrektur eines Verrats – Shakespeares: "The Tempest"
Der bekannteste Sturmtext der Literatur ist wahrscheinlich William Shakespeares spätes Drama von 1611. Es heißt ja schon so: "The Tempest", "Der Sturm". Es spielt auf einer Insel, auf der Prospero mit seiner Tochter Miranda ausgesetzt wurde, nachdem er als Herzog von Mailand gestürzt worden war – vom eigenen Bruder.
Im Unterschied zu den meisten Stürmen, die wir aus der Literatur kennen, ist der Shakespearsche ein Zauberwerk, ein künstlich herbeigeführtes Unwetter. Nicht ein Gott oder das Schicksal veranlasst den Sturm, sondern ein Mensch, Prospero nämlich. Dieser Prospero ist auch Magier – und sein Helfer ist der Luftgeist Ariel. Der Sturm soll das Schiff mit Prosperos verräterischem Bruder und dessen Verbündeten, dem König von Neapel, zu seiner Insel treiben.
Bei Shakespeare dient der Sturm dazu, das große Unrecht des Bruderverrats zu korrigieren. Der Sturm ist hier kein Rächer oder Zerstörer, auch das unterscheidet ihn von anderen Stürmen in der Weltliteratur. Denn es kommt keiner um, Mannschaft und Passagiere werden genau nach Plan auf der Insel zerstreut, und dadurch kann dann auch eine Ehe gestiftet werden, die staatspolitisch wichtig ist, und zwar die Ehe zwischen Prosperos Tochter Miranda und Ferdinand, dem Sohn des feindlichen Königs von Neapel.
Der mürrische Reisebegleiter – "Odyssee"
Odysseus' Heimkehr vom zerstörten Troja in Kleinasien nach Ithaka, wo seine Gattin Penelope, bedrängt von unzähligen Freiern, auf ihn wartet – die sogenannte "Odyssee" - gilt als eine Art Ur-Epos des abendländischen Romans. Odysseus muss mit vielen Stürmen kämpfen, immer wieder versuchen sie, ihm den kürzesten Weg nach Ithaka zu verwehren.
Am schlimmsten spielen sie ihm mit, nachdem er durch eine List den schrecklichen einäugigen Polyphem geblendet hat, einen Sohn des Meeresgottes Poseidon. Odysseus kommt zu einer Insel, auf der Aiolos zu Hause ist, der Herrscher der Winde. Und der schenkt Odysseus einen Schlauch. In Gustav Schwabs Worten berichtet der Held:
"In diesem Schlauch waren sämtliche Winde eingeschlossen. Er war so fest zusammengeschnürt, daß nicht der kleinste Lufthauch herauskonnte. Nur einen sanften Westwind schickte er uns nach, damit er uns schnell in die Heimat bringe."
Aiolos hatte Odysseus eingeschärft, den Schlauch auf gar keinen Fall zu berühren. Ithaka ist bereits in Sichtweite. Und was macht Odysseus? Er schläft ein, und seine neugierigen Matrosen wollen nur mal kurz gucken, was sich in dem Schlauch verbirgt. Sie öffnen ihn.
"Kaum war das Band los, da brausten alle Winde miteinander hervor, und ein entsetzlicher Wirbelwind riß unser Schiff wieder hinaus auf die offene See."
Damit fangen die berühmten Irrfahrten des Odysseus erst richtig an. Odysseus war ein Held, die Stürme haben seine Heimkehr nach Ithaka immer wieder verzögert, doch ihn endgültig daran zu hindern oder ihn gar zu vernichten vermochten sie nicht.
Der Sturm als Rächer – Victor Hugo: "Der Mann mit dem Lachen"
Da haben die Winde bei Victor Hugo ein anderes Format. Einen der grausamsten Stürme der Weltliteratur schildert Hugo in seinem monströsen Roman "Der Mann mit dem Lachen".
Ein Beispiel für Hugos dramatisierende Wortkunst ist die Schilderung einer in Seenot geratenen Bande von Verbrechern im aufgewühlten Ärmelkanal. Es sind die Comprachicos, grausame Kindesentführer, die dem kleinen Gwynplaine ein Lachen ins Gesicht geschnitten haben und mit ihm als Attraktion von einem Jahrmarkt zum andern ziehen. Nun müssen sie mitten im Winter aus England fliehen und lassen den Jungen am eisigen Strand zurück.
Der Sturm bei Hugo ist in erster Linie ein Rächer, kein Korrektor. Er rächt die Untaten der Comprachicos. Der Sturm führt sie ihrer wohlverdienten Strafe zu. Das reicht ihm nicht. Er verhöhnt sie nämlich noch, indem er ihnen die Fratze zeigt, die sie Gwynplaine ins Gesicht geschnitten hatten. Die Fratze des Kindes diente zur Belustigung, die Fratze des Sturms ist den Verbrechern nur noch der reine Schrecken.
Was aber, wenn die Winde gar nicht wehen? Denn ausgerechnet dadurch, dass der Sturm aussetzt, ist die Besatzung endgültig dem Untergang geweiht. Das Schiff hat ein Leck, es läuft voll, und da es kein Wind auf eine rettende Sandbank treibt, geht es unter mit Mann und Maus.
Die Windstille – Georg Heym: "Das Schiff"
Wie furchtbar die Meeresstille sein kann, schildert der expressionistische Dichter Georg Heym in seiner Novelle "Das Schiff". Unbeweglich liegt dieses Schiff vor einer Insel im tropischen Meer, an Bord ist die Pest ausgebrochen, die Mannschaft ist von "schrecklicher Stille" umgeben: Wegen der erbarmungslosen Flaute kann sie sich nicht einmal der Illusion hingeben, der Pest durch das Wegsegeln entkommen zu können. Die Windstille ist das andere Extrem des Sturms. Und oft genug kündigt sich ein Sturm durch eine Flaute an. Oder die Flaute ist nur ein Spiel des Sturms mit seinen Opfern. Wie bei Victor Hugo.
Doch Hugos Sturm ist ein gerechter Sturm. Er straft die Bösen, den Unschuldigen aber rettet er das Leben. Weil die Menschenräuber den zehnjährigen Gwynplaine am Strand zurücklassen, geht er nicht mit ihnen unter, nein, er überlebt in dem fürchterlichen Schneesturm. Und nicht nur das. Während das Schiff auf See zerrissen wird, dient an Land derselbe Schnee als schützende Decke, die ein kleines Mädchen auf der Brust der erfrorenen Mutter wärmt und am Leben erhält.
Der Wirbelsturm – Lafcadio Hearn: "Chita"
Der irisch-griechische Schriftsteller Lafcadio Hearn seiner kleinen funkelnden Erzählung "Chita" ein Hugo-Zitat als Motto voranstellt:
"Ich bin der gewaltige Widerstreit – kriechend, da ich eine Welle bin, geflügelt, da ich der Wind bin – Macht und Flucht, Hass und Leben, ungeheures Wogen, verfolgt und verfolgend."
Hearn schildert den Wirbelsturm des 10. August 1856, der die Inseln vor New Orleans im Golf von Mexiko verwüstet. Dabei ertrinken auch 400 Hotelgäste. Die Lektüre wird immer beklemmender, weniger weil der Sturm an Wucht zunimmt, sondern weil die Festgäste im eleganten Ballsaal des Hotels ihn sträflich ignorieren. Wie später auf der "Titanic" wird angesichts der heraufziehenden Katastrophe einfach weitergetanzt.
Ganze Inseln werden überschwemmt, unzählige Tote treiben übers Meer. Der Sturm ist "brutal und allmächtig". Aber ihm wohnt nicht nur die Allmacht des Todes inne. Er hält auch Leben bereit. Auch das ist eine Hommage an Victor Hugo. Wie der Schneesturm im "Mann mit dem Lachen" gibt auch dieser Sturm ein Mädchen frei: Chita.
Der Jahrhundertsturm – Christian Buder: "Das Gedächtnis der Insel"
Dass ein Sturm auch nur Kulisse sein kann, zeigt der Roman "Das Gedächtnis der Insel" des deutschen Autors Christian Buder. Der Pariser Archäologe Yann kommt auf seine kleine bretonische Heimatinsel, um seinen Vater zu begraben. Doch mit dem Tod des Vaters stimmt etwas nicht. Yanns Jugendfreundin, die mittlerweile bei der Gendarmerie arbeitet, glaubt nicht an ein Unglück. Je näher Yann den Rätseln seiner Vergangenheit kommt, desto näher kommt auch der sogenannte Jahrhundertsturm, vor dem schon seit Tagen gewarnt wird. Dann erreicht er die Insel mit ungeahnter Wucht.
Bei Christian Buder ist der Sturm weder Korrektor noch Rächer oder Schöpfer neuen Lebens, er lenkt kein Menschenleben in bestimmte Bahnen, nein, er ist in erster Linie dramatische Untermalung der inneren Verfassung des Helden.
Der Sturm als Ehestifter – Wilhelm Raabe "Der Hungerpastor"
"Immer der Wind! Er jagte den ganzen Tag dunkles Gewölk über den grauen Himmel. Er wühlte. Er rüttelte an den Fenstern des Dorfwirtshauses, wo Hans sein Mittagsmahl einnahm."
So steht es in Wilhelm Raabes "Der Hungerpastor" von 1864, der einer der meistgelesenen deutschen Romane der folgenden hundert Jahre werden sollte.
Der Schriftsteller F.C. Delius verfasste einst seine Doktorarbeit zum Thema "Der Held und sein Wetter". Darin schreibt er über den Sturm in Raabes "Hungerpastor":
"Der Weg eines personifizierten Windes durch Wälder, über Landstraßen, an Stoppelfeldern entlang wird hier verfolgt, nicht der Weg des Helden. Der große Aufwand an Intensiva und Attributen verleiht dem Wind eine Aktivität und soll klarmachen, wer hier regiert. Der Wind diktiert Hans die Stimmung."
Und nicht nur das. Der Wind ist es auch, der Hans zu der Kutsche lenkt, auf die es ankommt, und den Schleier der jungen Reisenden hebt, die im Wagen sitzt. Hans erkennt "ein bleiches, trauriges Mädchengesicht". Vor allem aber ist es hübsch. Der Wind hat Hans zu seiner künftigen Braut geführt.
Aus heiterem Himmel – Herman Melville "Moby Dick"
In Herman Melvilles Klassiker "Moby Dick" bricht der Sturm im wörtlichen Sinn aus heiterem Himmel los, unvermittelt, wie eine "höhere Macht".
"Die strahlendsten Himmel bergen die gefährlichsten Gewitter. Und so geschieht es auch, daß im Glanz dieser japanischen Gewässer der Seemann den fürchterlichsten aller Stürme kennenlernt, den Taifun. Aus wolkenlosem Himmel bricht er manchmal los wie eine Bombe auf stille, verträumte Gassen."
So beginnt das 119. Kapitel von "Moby Dick"; es trägt den unverfänglichen Titel "Die Kerzen". Damit sind die sogenannten Elmsfeuer gemeint, elektrische Entladungen an den Mastspitzen, die bei Gewitter auftreten können.
"Gegen Abend wurde die 'Pequod' von einem Taifun überfallen. See und Himmel krachten in brüllendem Aufruhr, zerrissen vom Getöse des Donners und von den flammenden Blitzen, in deren fahlem Schein man da und dort in den Masten die Fetzen flattern sah, die der erste Anprall der Donnerbö übriggelassen hatte."
Aber auch dieser Gewittersturm führt die "Pequod" ihrem eigentlichen Ziel entgegen, er treibt sie auf den weißen Wal zu. Moby Dick hatte Käpt'n Ahab einst das Bein abgerissen. Hasserfüllt denkt Ahab künftig nur noch an das eine: den weißen Wal Moby Dick zu erlegen.
Den einen macht der Sturm einen Strich durch die Rechnung, den andern bietet er eine einzigartige Chance. Vielleicht ist das Doppelgesicht sein wahres Gesicht.
(DW)
Sprecher: Laurenz Laufenberg, Max Urlacher und der Autor
Regie: Beatrix Ackers
Ton: Hermann Leppich
Redaktion: Carsten Hueck