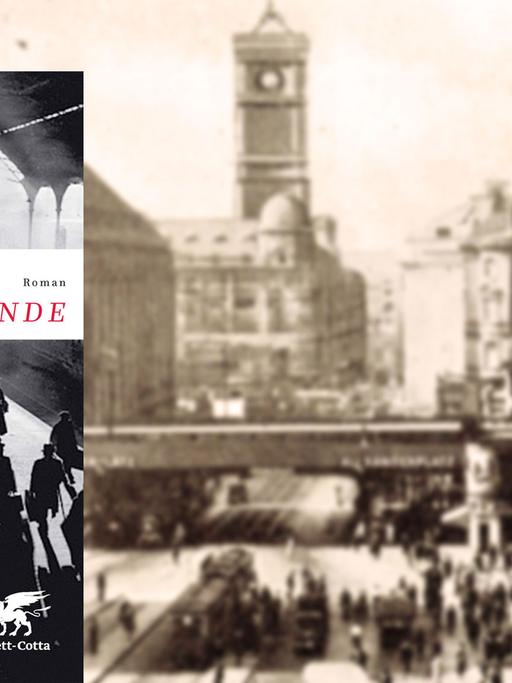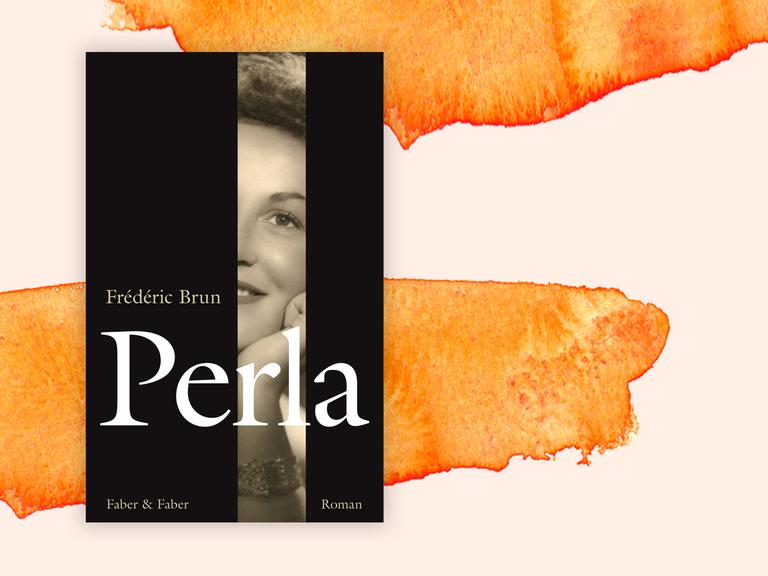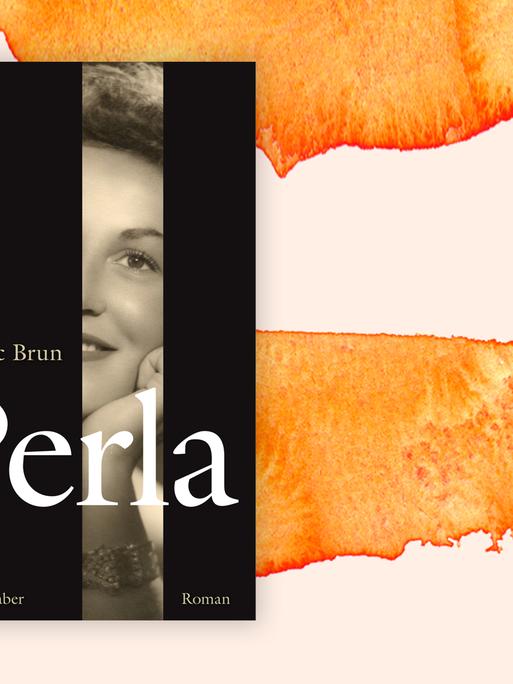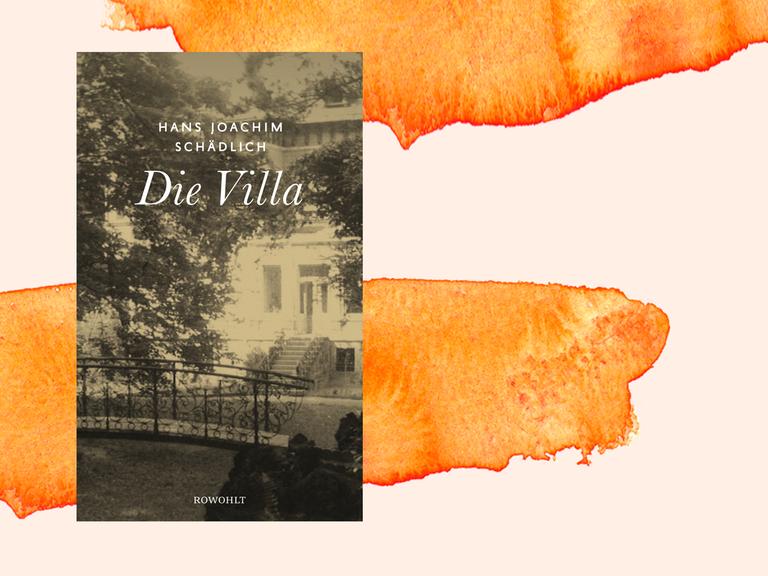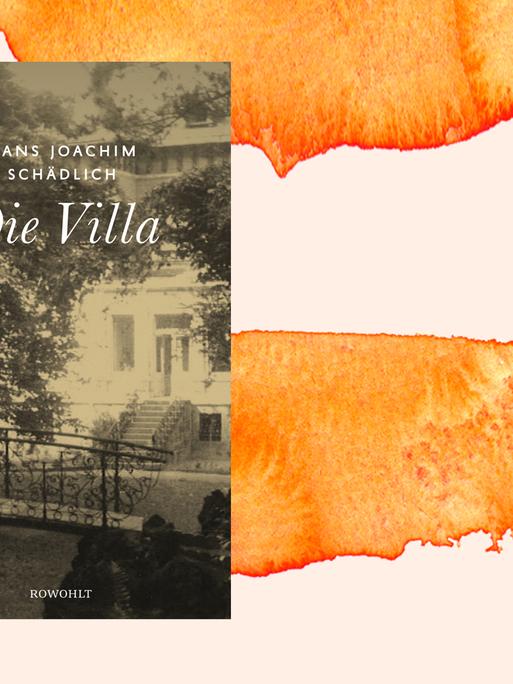Susanne Kerckhoff: "Berliner Briefe". Roman
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Peter Graf
Verlag Das kulturelle Gedächtnis, Berlin 2020
111 Seiten, 20 Euro
Wie das Gift der Diktatur nachwirkt
06:43 Minuten

Selbstkritisch und kämpferisch beschreibt Susanne Kerckhoff in ihrem erstmals 1948 erschienenen Roman "Berliner Briefe" die deutsche Nachkriegsmentalität. Eine literarisch berückende Bestandsaufnahme - ihre Wiederentdeckung kommt zur richtigen Zeit.
Als vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg in Europa endete, brach auch die Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland zusammen. Eine zwölfjährige Diktatur verschwand, die Nazis aber blieben. Die vielbeschworene "Stunde Null" gab es nicht. Höchst anschaulich und mit berückender literarischer Kraft beschreibt die Berliner Schriftstellerin Susanne Kerckhoff in ihren "Berliner Briefen", wie es zwei Jahre nach Kriegsende um Deutschland und die Deutschen bestellt war.
Was für eine Stimme! Voller Unruhe und Sehnsucht, rücksichtslos selbstkritisch, desillusioniert und doch kämpferisch benennt hier eine fiktive Briefeschreiberin, so alt etwa wie die 1918 geborene Autorin, was einem Neuanfang in Deutschland entgegensteht, wie stark das Gift der Diktatur im "Volkskörper" nachwirkt. Sie gibt Beispiele aus dem Berliner Alltag. Berichtet von Klassentreffen, von Parteiveranstaltungen, Gesprächen auf der Straße, der Lebenssituation unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen.
Geistig-moralische Selbstbefragung
Sie unterscheidet die Menschen in "Atlasameisen" - deren Bestreben gerechte, solidarische Arbeit an der Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist - und "Jäger" - die die Welt als Revier betrachten, um ihre Einmaligkeit auszukosten. Auch unter den Antifaschisten macht sie Jäger aus, beschreibt die "neuen Mitläufer" und die verbreitete Eigenschaft der Deutschen, "richtig liegen" zu wollen.
Kerckhoffs bestechend klare Bestandsaufnahme erschien erstmals 1948. In dem Jahr wurde sie, Mutter von drei Kindern, begabte Romanautorin und Lyrikerin, Feuilletonchefin der "Berliner Zeitung". In ihren 13 "Berliner Briefen", gerichtet an einen in Paris weilenden Jugendfreund Hans, beklagt die Verfasserin Helene, wie uneinsichtig die meisten Deutschen auf die zurückliegenden Jahre blicken. Sie unternimmt eine geistig-moralische Selbstbefragung, fordert die aber auch von allen Deutschen. Denn Einsicht in eigene Schuld oder Verantwortung für die weltweit angerichtete Zerstörung findet sie bei den meisten nicht. Stattdessen Prahlerei, Klagen über das eigene Leid, über die Bevormundung durch die Siegermächte, die "Diktatur der Demokratie". Helene jedoch konstatiert: "Wer im Frühling 1945 nicht aus dem Gefängnis oder dem Konzentrationslager kam, ist mitverantwortlich."
Aufrüttelnd und unbequem
Sie stellt sich ihrem moralischen Rigorismus. Erklärt, wie sie, in Opposition zum Regime, doch ohne Widerstand zu leisten, durch die Nazi-Zeit gekommen ist, erklärt ihr Verhalten, entschuldigt es nicht. Empört ist sie über all die ehemaligen Parteigenossen und Profiteure des Systems, die sich nun entnazifizieren lassen, doch alten Strukturen und Denkmustern nicht abschwören. Helene, die einst SPD wählte, findet dieses Phänomen in allen Parteien und obwohl "unheilbar politisiert", weiß sie nicht, wo sie sich jetzt engagieren soll.
Man hört der Briefeschreiberin gebannt zu, weil sie nicht davor zurückschreckt, die eigene Zerrissenheit zu benennen, weil sie radikal subjektiv, aber nie überheblich ist. Zwar moralisch fordernd, aber nicht herablasssend, artikuliert sie mit Verve, was andere verschweigen, ohne sich dadurch aber aufzuwerten. Eine starke weibliche Stimme, aufrüttelnd und unbequem, die nach so vielen Jahrzehnten der Verlag Das kulturelle Gedächtnis im richtigen Moment wieder zu Gehör bringt.