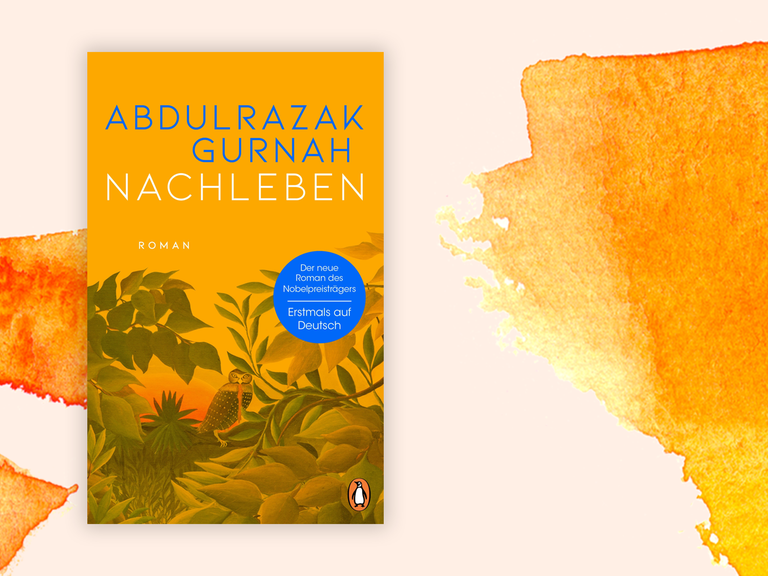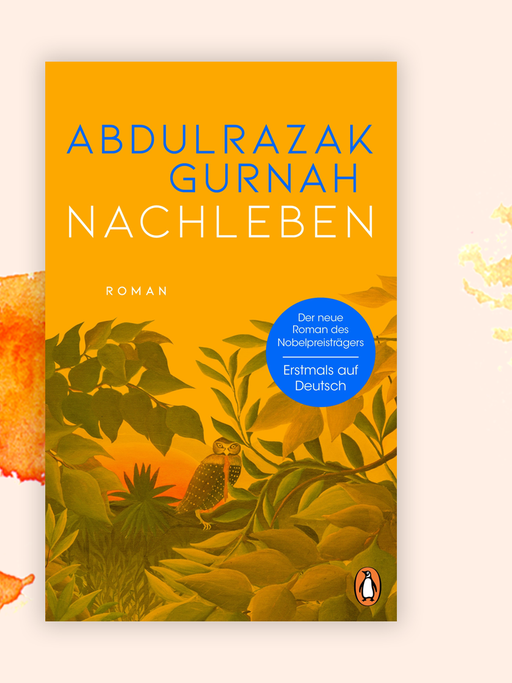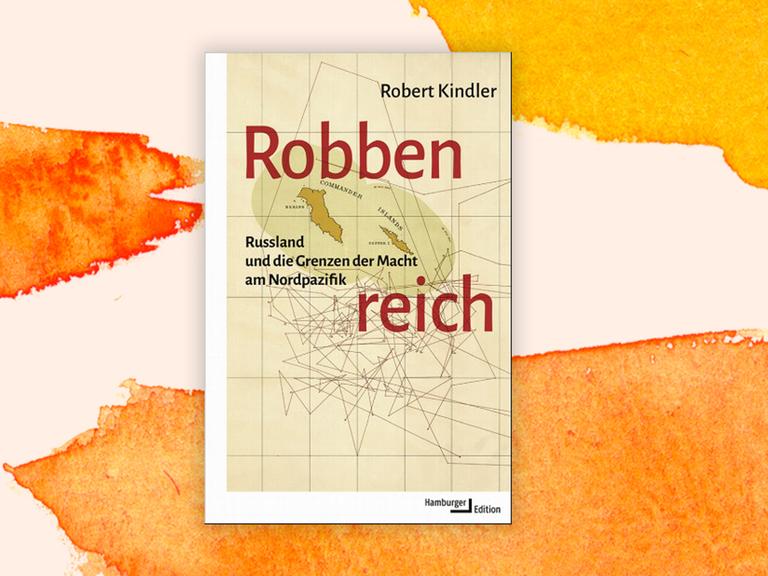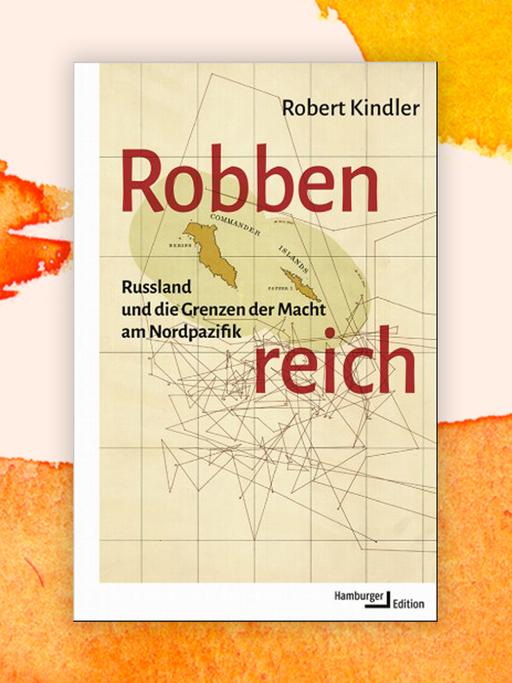Tara June Winch: „Wie rote Erde“

© Haymon Verlag
Vergangenheit neu belebt
06:35 Minuten

Tara June Winch
Juliane Lochner
Wie rote ErdeHamon, Innsbruck 2022379 Seiten
22,90 Euro
Eine junge Aborigine-Frau sucht in der Ferne ihren Seelenfrieden. Als ihr Großvater stirbt, kehrt sie nach Australien zurück. Sie findet einen neuen Zugang zum Erbe ihre Vorfahren und kämpft um ihr Land.
Es ist erst ihr drittes Buch: Und doch wurde die 1983 geborene Tara June Winch schon für zwei Dutzend verschiedene Literaturpreise nominiert. Allein achtmal für ihren Roman „Wie rote Erde“ („The Yield“) – mit dem sich diese kraftvolle und poetische Autorin nun zum ersten Mal auch einem deutschsprachigen Publikum vorstellt. Dieser Roman ist Verführung und Aufschrei zugleich, macht wehmütig und wütend, öffnet Sinne sowie den Verstand, und er bezaubert.
Die Geschichte von Sklaverei und Kolonisation, vom himmelschreienden Unrecht, dass Europäer über indigene Völker brachten, ist lang. Doch erst seit kurzem wird sie literarisch selbstbewusst erzählt von ihren Nachfahren, die immer noch Diskriminierung und Rassismus in ihrem Alltag zu spüren bekommen.
Verbindung mit den Ahnen
Tara June Winch, die in Paris lebt, entstammt dem Volk der Wiradjuri, sie ist eine Aborigine-Autorin, die sich mit ihrem Roman Kultur und Sprache ihrer indigenen Vorfahren zurückerobert. Sie erzählt die Geschichte der fiktiven Familie Gondiwindi. Im Mittelpunkt steht August, eine junge Frau, die in London als Tellerwäscherin jobbt und zum Begräbnis ihres Großvaters an ihren Geburtsort in Australien zurückkehrt. „Massacre Plains“ heißt dieser Ort. Es ist ein Nest.
„Die halbe Stadt – die Ehefrauen – stand hinter den Ladentheken, und die andere Hälfte – die Ehemänner – war selbstmordgefährdet wegen der Verschuldung ihrer Farmen. Die meisten Söhne und Töchter unterschrieben Verträge bei der Army. Einige kamen mit dem Arbeitslosengeld aus, andere hatten eine Beschäftigung, doch nur wenige hatten einen Beruf.“
Sprache als Brücke
August hatte ein enges Verhältnis zu ihren Großeltern Elsie und Albert. Ihre Mutter war in die Drogenszene abgerutscht, so dass August und ihre Schwester Jedda viel Zeit im Haus der Großeltern verbrachten. Eines Tages verschwand Jedda, was die ganze Familie traumatisierte. August knüpft mit ihrer Rückkehr in diesen Ort ihres Aufwachsens an die Vergangenheit an. Sie trifft alte Freunde und Verwandte und hört von einem Wörterbuch, an dem ihr Großvater vor seinem Tod arbeitete. Er sammelte und übersetzte die Sprache der Vorfahren.
August recherchiert und findet schließlich Kassetten, die ihr Großvater besprochen hatte. Sein Versuch, die alte Sprache der Ureinwohner zu bewahren, ist Vermächtnis und Ermächtigung in einem. Indem der Großvater einzelne Wörter mit Geschichten verbindet, indem er selbst in ein Gespräch mit seinen Ahnen eintritt, ermöglicht er August und der jüngeren Generation, sich ihrer Herkunft und Identität bewusst zu werden. Der Großvater beschreibt dabei Pflanzen, Tiere und Gebräuche, dokumentiert Rezepte und Mythen, erzählt die Geschichte seiner Familie und des Landstrichs, in dem sie lebte. Und er lüftet das Geheimnis um Jeddas Verschwinden.
Kunstvolle Selbstermächtigung
Alberts Wörterbuch ist dabei die eine Erzählebene des Romans, Augusts Rückkehr und Recherche ist die andere. Und es gibt noch eine dritte: die Briefe eines aus Sachsen stammenden Missionars. Dieser prangert in seinen Briefen – ebenfalls als eine Art Vermächtnis – den brutalen Umgang der Briten mit der indigenen Bevölkerung an, allerdings ohne sich seiner eigenen Rolle im kolonialistischen System Ende des 19. Jahrhunderts klarzuwerden.
Augusts Rückkehr wird zu einem Neubeginn für sie und ihre Familie, zu einem neuen Selbstverständnis, das in einen Kampf um das Land der Väter mündet.
Rauhe und zärtliche Passagen, subjektive Empfindungen und (kultur)geschichtliche Fakten, Landschaftsbeschreibungen und emotionale Stimmungsbilder sind in Tara June Winchs Roman kunstvoll und fein miteinander vernäht wie die Felle der Possums, aus denen die Wiradjuri ihre Mäntel herstellten.