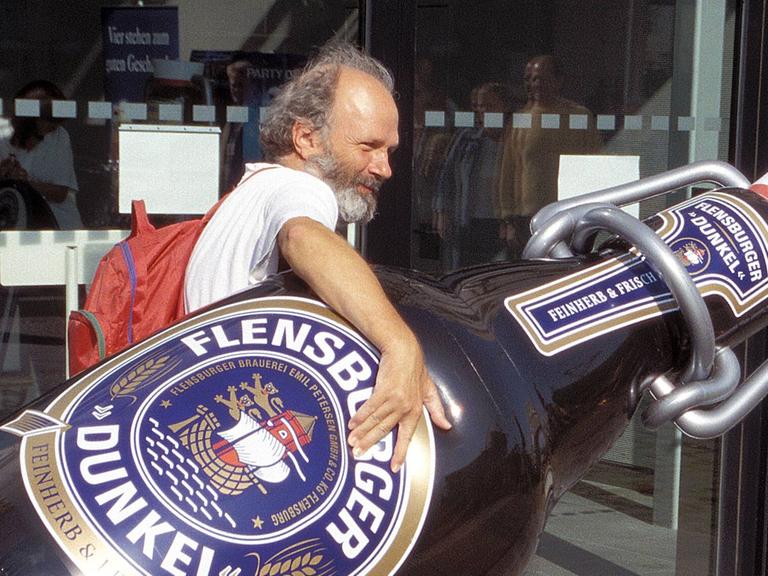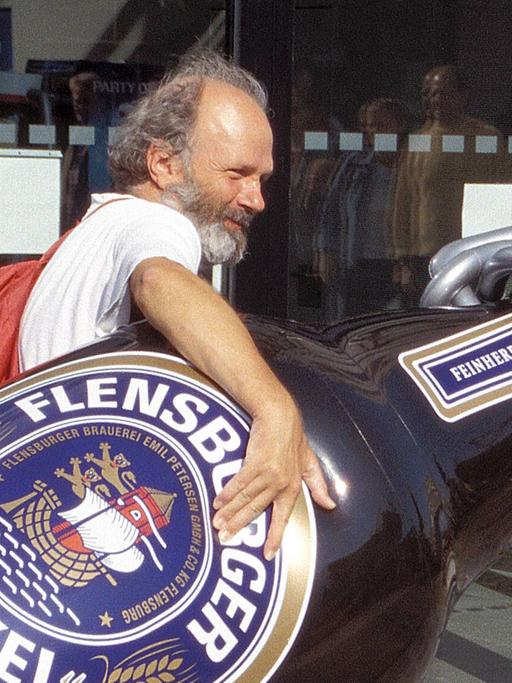Timm Beichelt: "Ersatzspielfelder: Zum Verhältnis von Fußball und Macht"
edition Suhrkamp, 2018
360 Seiten, 18 Euro
Wie das Fußballgeschäft unsere Wirtschaftsordnung spiegelt

Von Bodo Morshäuser · 02.06.2018
Im Fußball geht es um Geld, und damit um Macht: Timm Beichelt analysiert in seinem sehr lesenswerten Buch, wie Sportfunktionäre sich Einfluss sichern und von demokratischen Grundprinzipien wenig wissen wollen
Gespräche über Fußball haken sich oft am Widerstreit zwischen Kommerz und Spiel fest. Dass das kein Zufall ist, das wird in Timm Beichelts neuem Buch sehr klar: "Ersatzspielfelder: Zum Verhältnis von Fußball und Macht".
Und weil Macht immer auch mit Geld zu tun hat, schließt sich der Kreis. Zu beobachten war das auch, als der Bayern-Präsident Uli Hoeneß während einer Mitgliederversammlung mit einigen Fans aneinandergeriet. Und ihnen erklärte, warum in seinen Augen ökonomisches Kapital anscheinend mächtiger ist als soziales Kapital:
Fußballgeschäft und Wirtschaftsordnung
"Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für sieben Euro in die Südkurve gehen lassen können? Was glaubt ihr eigentlich, wer euch alle finanziert? Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns das ganze Jahr über den Arsch aufreißen dafür, dass wir dieses Stadion hingestellt haben. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet, und das ist nunmal mit sieben Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren."
Timm Beichelt legt an Beispielen wie diesem dar, dass das Fußballgeschäft unsere Wirtschaftsordnung widerspiegelt.
"Nicht nur für einzelne Vereine und Verbände, sondern im Grunde für den kommerziellen Fußball als Ganzes entspricht die Entgrenzung des Geschäfts dem Grundprinzip des (Fußball-)Kapitalismus, sich immer größere Märkte zu erschließen, um so die wirtschaftliche Basis zu verbreitern."
Funktionäre verweisen auf "Autonomie des Sports"
Dafür ist unter anderem der Deutsche Fußball Bund zuständig. Er unterliegt dem Vereinsrecht, ist also eine gemeinnützige Organisation. Aber gleichzeitig ist er auch ein Wirtschaftsunternehmen, er vermarktet unter anderem die Nationalmannschaft.
Eine komfortable Doppelkonstruktion, in der man sich auf die jeweils angenehmere Seite zurückzieht. So betonen Fußballfunktionäre gern die "Autonomie des Sports", wenn die Politik sich in deren Belange einmischen will; trotzdem suchen sie staatliche Unterstützung beim Stadionbau. Üppige Einnahmen werden innerhalb des Verbands verteilt. Rettungsgelder erfleht man beim Staat.
Und interne Schiedsgerichte – um die im Rahmen von Freihandelsabkommen heftig gestritten wird, weil sie die nationalen Gerichtsbarkeiten aus der internationalen Ökonomie heraushalten sollen –, sind im Fußball schon lange gang und gäbe.
Der Autor Timm Beichelt schreibt:
"Wenn im internationalen Sport die Formel der Trennung der Sphären von Fußball/Sport und Politik/Staat ins Spiel gebracht wird, lässt sie sich zumeist so übersetzen, dass sich Akteure des Fußballs eine Einmischung gewählter politischer Akteure genauso verbitten wie das Anmahnen normativer Standards, die in demokratischen Gesellschaften üblich sind."
Fußball als Projektionsfeld
Dabei leben Fußballer Vorbildmodelle für die individuelle Lebensentwicklung junger Männer, Fußballmannschaften bieten Vorbilder für Gemeinschafts- und Solidaritätspraktiken. Sie erzählen vom Zusammenhalt markanter Individuen – denen gleichzeitig zu viel Individualität, die die Gemeinschaft schwächen könnte – verboten wird. Fußball ist ein Projektionsfeld, in dem sich mehrere Felder kreuzen, wie Timm Beichelt erzählt. Und da Gefühle einen wichtigen Teil der Motivation menschlichen Handelns ausmachen, gehört es zur Methode dieses Buches, dass sie hier berücksichtigt werden.
In den Worten Beichelts:
"Natürlich benötigen wir die Emotionen, um die Reaktionen der Bayern-Familie auf die Vergehen von Uli Hoeneß (Dankbarkeit, Zuneigung), um das russische Staatsdoping (Minderwertigkeitsgefühle, Trauer um vergangene Größe) oder Aversionen gegen dunkelhäutige Spieler (Hass, Angst) mit erklären zu können."
Die Demokratieferne des Uli Hoeneß
Als Mesut Özil und Ilkay Gündogan sich neulich mit dem türkischen Staatspräsidenten fotografieren ließen, war das eine Nachricht für die ersten Zeitungsseiten und führte zum Besuch beim deutschen Bundespräsidenten. Mesut Özil hat mit 31 Millionen den beliebtesten deutschen Facebookaccount und verfügt somit über erhebliches soziales Kapital. Das besagte Foto löste sofort eine kleine Debatte über Integration aus. So sehr in dieser Debatte von Demokratie die Rede war, so wenig ist Demokratienähe im Fußballgeschäft der Normalfall. Wieder ein Zitat von Uli Hoeneß, diesmal bei der ersten Mitgliederversammlung nach seiner Gefängniszeit:
"Die meisten Journalisten, die darüber berichtet haben, haben mich noch nie im Leben gesehen. Es werden fünf Bücher über mich geschrieben. Alle diese Leute haben mit mir kein Wort gewechselt. Kein Wort. Es wird nicht darum gehen, dass man informieren will, nein. Man will Kohle verdienen, und das ist frevelhaft."
Autor: Das sagt der Wurstfabrikant und Präsident eines der reichsten Vereine der Welt und beweist damit sein deutlich demokratiefernes Verständnis von Meinungs- und Pressefreiheit. Er steht damit nicht allein, belegt der Autor in zwei Kapiteln über den russischen Fußball und den Weltfußballverband Fifa.
Fußball-Ideale nur, solange sie nicht stören
Fußball, schreibt Timm Beichelt, vollbringt die Leistung, Felder gesellschaftlicher Gemeinsamkeit sichtbar zu machen, so wie zum Beispiel beim Sommermärchen von 2006. Erst vor 16 Jahren stand mit Gerald Asamoah der erste dunkelhäutige Spieler in der deutschen Nationalmannschaft. Heute sind Spieler wie Boateng, Khedira, Özil, Can, Rüdiger, Güngogan und Sané im Kader für die kommende Weltmeisterschaft.
Und Fußball, schreibt Timm Beichelt in diesem lesenswerten Buch, erzählt immer auch von seiner eigenen Pathologie, wenn etwa Werte wie Selbstentfaltung, Partizipation und Offenheit geschwächt werden, sobald sie sportlichen und finanziellen Gewinnerwartungen im Wege stehen.
Buchzitat: "So hat sich der Fußball einzureihen in die große Zahl von Politikbereichen, für die dieser Begriff eigentlich nur noch eingeschränkt zutrifft, weil sich nämlich maßgebliche politische Akteure entschieden haben, dem Marktgeschehen die Hoheit zu überlassen. Mithin spielt der Fußball gar nicht unbedingt in einer eigenen Liga, was die Politikferne angeht. Die Öffentlichkeit hat sich (...) lediglich besser darauf eingestellt, dass andere Akteure als gewählte Politiker das Heft in der Hand haben."