Timo Luks: „In eigener Sache“
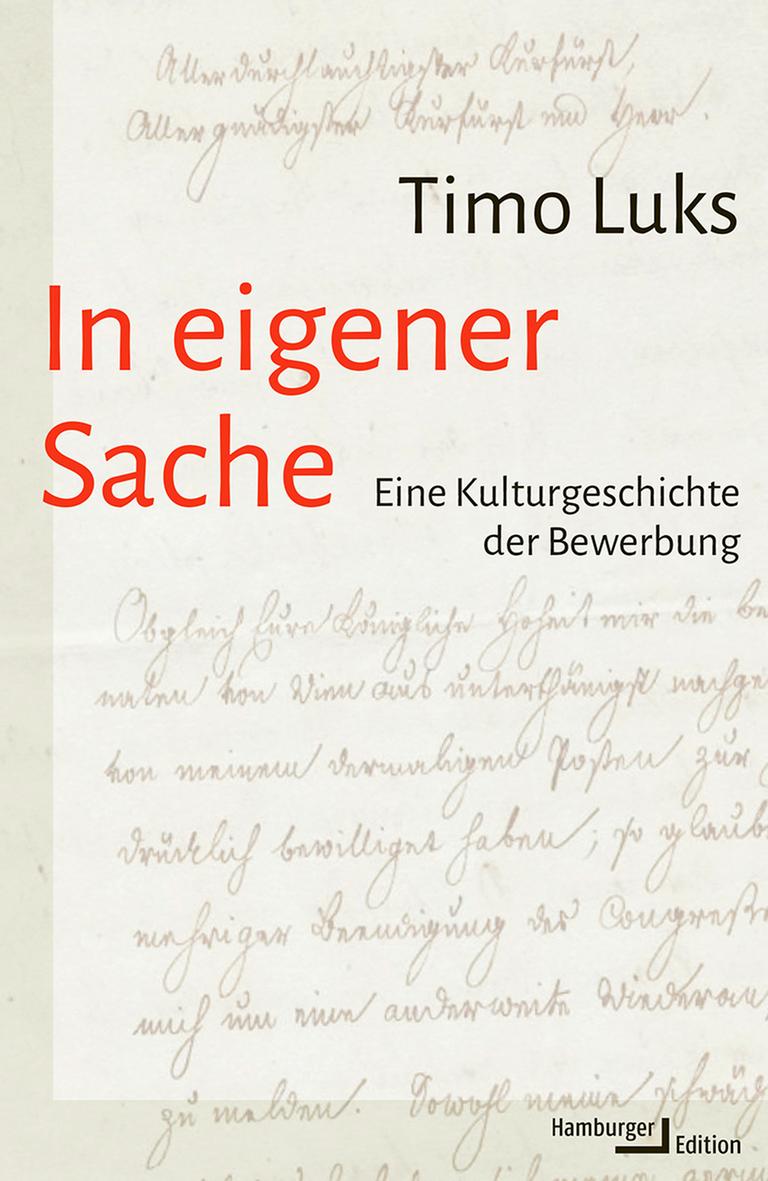
© Hamburger Edition
Immer flexibel, stets originell
05:33 Minuten
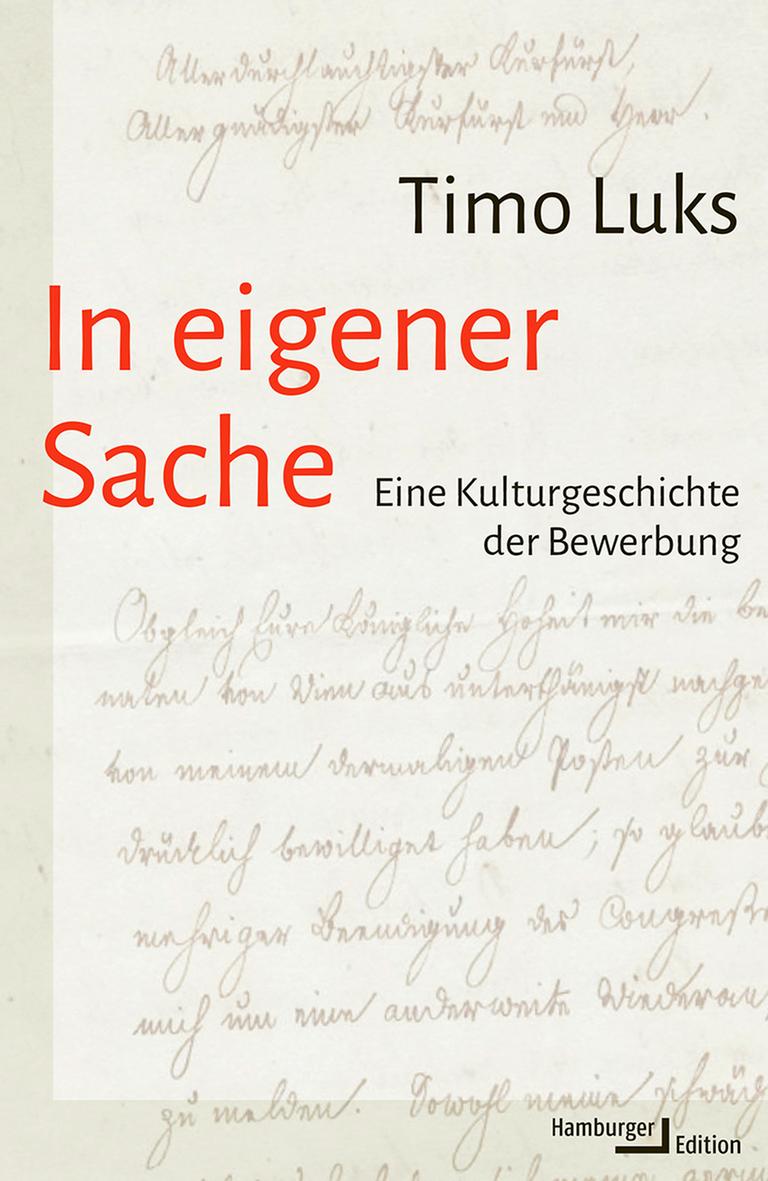
Timo Luks
In eigener Sache. Eine Kulturgeschichte der BewerbungHamburger Edition, Hamburg 2022432 Seiten
40,00 Euro
Von der Bittschrift zur Selbstanpreisung: Der Historiker Timo Luks untersucht Bewerbungsschreiben im Wandel der Zeiten.
„So angelt man sich heute die Jobs“, sagt die junge Frau, nachdem sie ihren Computerspiel daddelnden Kommilitonen mal eben auf Kurs gebracht hat: Hier ein Klick, dort ein Häkchen, ein bisschen Farbe für die Optik – und fertig ist die Bewerbung.
Wie zielführend solche 08/15-Verfahren auf einem hochindividualisierten Arbeitsmarkt sein können, kommt nicht zur Sprache, schließlich befinden wir uns im Wunderland der Fernsehwerbung, in einem jedoch stimmen Fiktion und Wirklichkeit überein: Der moderne Mensch ist Arbeitssuchender. Wer schon an der Bewerbung scheitert, hat für alles weitere schlechte Karten.
Bewerbung als Kulturtechnik
Naheliegend also, dass Timo Luks seine Studie zum Thema all jenen widmet, „die sich wieder und wieder mit Bewerbungen herumschlagen“, handelt es sich doch um ein Spiel nach oft genug unklaren Regeln, bei dem immer auch Gegenspieler auftreten.
Als Ratgeberliteratur wäre das Buch trotzdem missverstanden, die zahlreichen Helferlein beim Verfassen geeigneter Schriftstücke werden hier selbst zu Quellen. Für Luks, derzeit an der Uni Gießen tätig, ist die Bewerbung eine grundlegende Kulturtechnik moderner Gesellschaften, deren Durchsetzung er Schritt für Schritt nachzeichnet.
Am Anfang steht die an den Fürsten oder andere Obrigkeiten gerichtete Bittschrift, am Ende eine Art Werbeprospekt in eigener Sache. Das Leben wird dabei zum primär karriereorientierten Lebenslauf.
Hervorhebung individueller Fähigkeiten
Belege dafür bieten die Archive zuhauf. Der Schneidermeister Johann Christoph Artel etwa begründet seine „unterthänigste“ Bewerbung um eine Zöllnerstelle mit der Sorge um Frau und acht zu ernährende Kinder.
Mit ähnlichen Argumenten versucht der Schmied Peter Bernauer seinen Dienstherrn von sich zu überzeugen, beides typisch für die Zeit um 1800, in der die Anschreiben von Handwerkern, Schulmeistern und freigesetzten Soldaten noch stark an Gnadengesuche erinnern.
Erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts weicht die dramatische Schilderung prekärer Lebensverhältnisse einer Hervorhebung individueller Fähigkeiten. Sachkenntnis, Geschicklichkeit, Durchsetzungswille sind nun stärker nachgefragt, die Bewerbung verliert ihren Charakter als moralischer Appell und entwickelt sich zu einem Instrument der Positionierung auf einem zunehmend abstrakten Arbeitsmarkt.
Autor seines eigenen Bildungsromans
Brillant sind Luks‘ mitunter überbordende Ausführungen vor allem dort, wo er die großen Linien hinter den Einzelphänomenen sichtbar macht. Im Wandel der Bewerbungskultur spiegelt sich nicht nur ein Stück Sozialgeschichte, sondern auch der Übergang von einer auf Patronage gegründeten Gesellschaft hin zu einer Meritokratie.
Wo erworbene Verdienste zum entscheidenden Einstellungskriterium werden, wandelt sich freilich zugleich die Anforderung an den Bewerber selbst. Mehr und mehr sieht er sich vor die komplexe Aufgabe gestellt, die Stationen seines Erwerbslebens so zwingend aneinanderzureihen, dass sie Konkurrenten aus dem Feld schlägt und gleichzeitig ihren Höhepunkt zielgenau in der begehrten Stelle findet.
Eine zweischneidige Angelegenheit: Der Arbeitssuchende wird zum Autor seines eigenen Bildungsromans, trägt aber auch die Verantwortung für Erfolg und Misserfolg.
Widersprüchliche Jobsuche
Und heute? Ein leider arg knapp geratener Ausblick zeigt, wie aktuelle Lebensläufe weiteren Rationalisierungen unterliegen: Die Erzählung schrumpft zur Tabelle, Internetplattformen wie die eingangs skizzierte tun ein Übriges.
Ob die von Luks am Beispiel traditioneller Schriftkultur herauspräparierten Bezugspunkte auch unter Hi-Tech-Bedingungen ihre Gültigkeit behalten, wäre zu diskutieren – den Liebesmarkt jedenfalls hat die Digitalisierung bereits in seinen Grundfesten erschüttert.
Garantiert wirksam allerdings bleibt der zentrale Zielkonflikt moderner Jobsuche: Wer sich bewirbt, hat sich als grenzenlos anpassungsfähiges und höchst originelles Subjekt zugleich zu präsentieren. Das Ergebnis darf schizophren genannt werden. Auch auf dem Arbeitsmarkt ist "ich" immer ein anderer.






