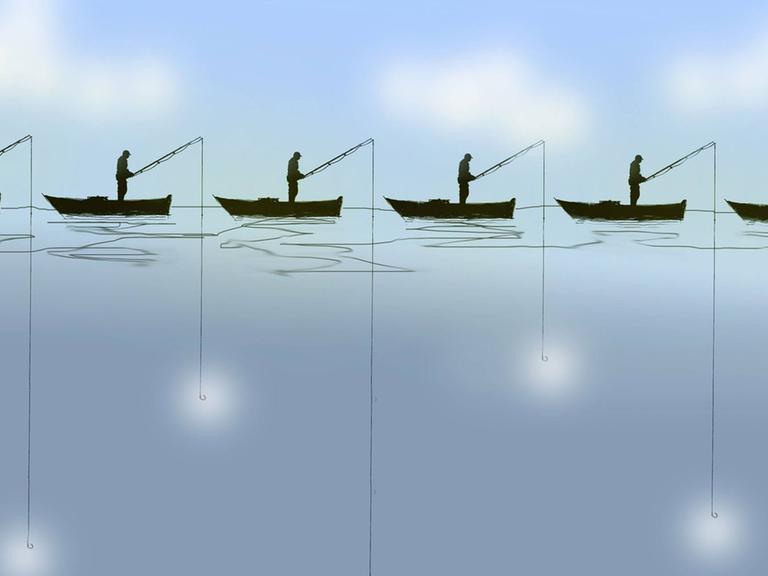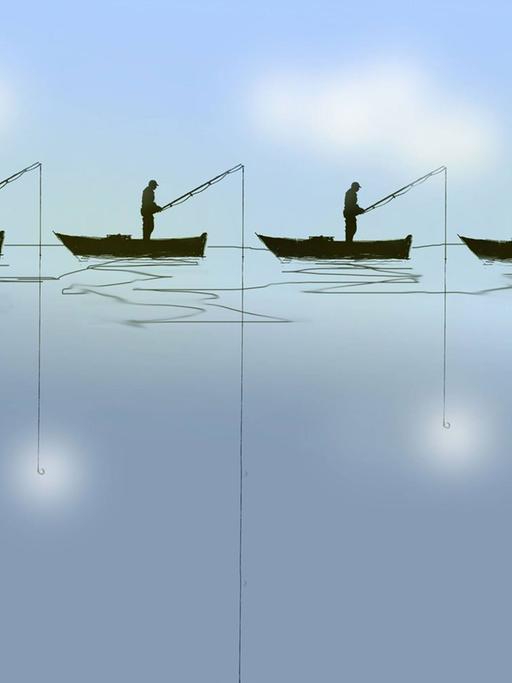Timo Reuter: Warten. Eine verlernte Kunst
Westend Verlag, Frankfurt am Main 2019
240 Seiten, 18 Euro
Warum unverhoffte Pausen ein Geschenk sind
08:02 Minuten

Wir haben verlernt zu warten, deshalb versäumen wir jede Menge, meint der Autor Timo Reuter. In seinem Buch "Warten. Eine verlernte Kunst" erzählt er von der Entstehung des modernen Zeitgefühls - und plädiert dafür, öfter mal nichts zu tun.
Das Smartphone habe uns verwöhnt mit dem Versprechen, auf nichts mehr warten zu müssen, beobachtet Timo Reuter. In seinem Buch beklagt er einen "digitalen Sofortismus", der zu völlig übertriebenen Ansprüchen führe. Wo jede Information, jede Antwort und jede Ablenkung nur wenige Klicks entfernt sei, gelte Warten als "uncool" und wer warten müsse als bedauernswert. Dem gegenüber macht sich Reuter für eine "Kultur des Wartens" stark. Denn nur wer bereit sei zu warten, werde wieder offen für all das, was ringsum passiert:
"Und diese Bereitschaft, Ausschau zu halten und die Welt hinaus zu horchen, bedingt natürlich auch, dass man an der Bushaltestelle auch mal das Smartphone in der Tasche lässt."
Eine Liste von Dingen, die wir lassen
Angesichts jeder unverhofften Pause sofort das Telefon zu zücken - das ist nur eines der Dinge, die Reuter seinen Leserinnen und Lesern nahelegt, einfach mal zu lassen. Als Gegenstück zu unseren allgegenwärtigen To-do-Listen empfiehlt er, "Let-it-be-Listen" anzufertigen: detaillierte Aufstellungen all dessen, was wir uns ausdrücklich vornehmen, nicht zu tun - um den Wert unverplanter Zeit neu zu entdecken.
"Man muss natürlich dazu sagen, dass es ein Privileg ist, einfach mal nichts zu tun", räumt Timo Reuter ein. "Nicht alle Menschen haben auch ökonomisch überhaupt die Möglichkeit dazu, mal langsam zu machen. Aber ich glaube, viele bilden sich auch eher ein, dass es immer weiter, immer schneller gehen muss."
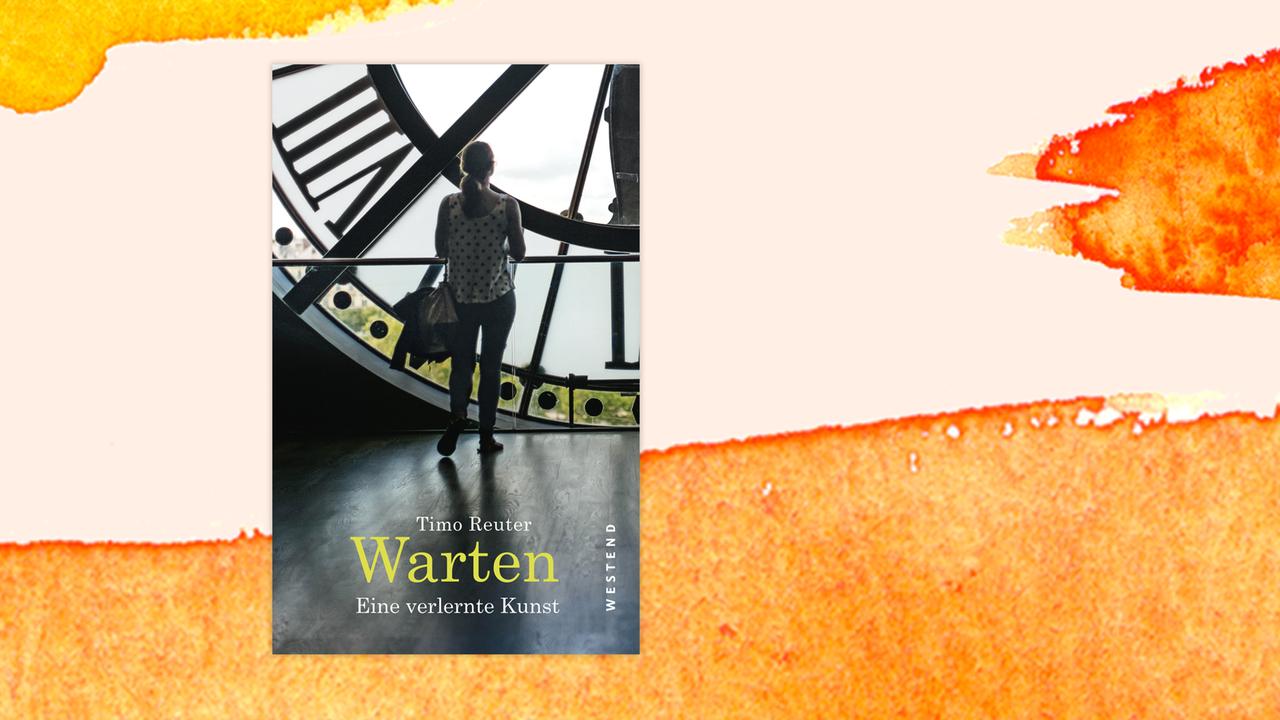
Warten als Privileg: Timo Reuter plädiert für einen bewussteren Umgang mit unverplanter Zeit.© Westend Verlag / Deutschlandradio
Auf Reisen macht der Autor die Erfahrung, dass das Verständnis von Zeit weltweit sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. "Das Warten hat hier einen ganz anderen Stellenwert", sagt Reuter, der zurzeit in Mexiko und Mittelamerika unterwegs ist. "Es gehört viel mehr zum Leben dazu als bei uns, obwohl man bei uns ja auch warten muss. Aber die Erwartung ist eben eine andere: Wir wollen, dass der Bus sofort und pünktlich kommt, wenn er nur fünf Minuten Verspätung hat, dann ärgern wir uns. Und hier ist kommt der Bus eben oft, wann er will."
Wortgeschichte: von der Aufwartung zur Wartung
Anhand zahlreicher Quellen der europäischen Sozial- und Literaturgeschichte rekonstruiert Timo Reuter die Entstehung des modernen Zeitgefühls. Die Gebrüder Grimm schrieben dem "Warten" in ihrem Wörterbuch heute fast vergessene Bedeutungen zu, so Reuter: "Es hieß zum Beispiel auch aufzupassen - man kennt das heute noch vom 'Wärter' -, es hieß zu dienen: wir haben heute noch das 'Aufwarten'. Und es hieß eben auch zu pflegen. Das Spannende ist: Früher hat man auch Menschen 'gewartet', heute warten wir nur noch Maschinen."
Spätestens seit der Industrialisierung habe das Diktat der Uhr nach und nach das gesamte gesellschaftliche Leben erfasst, so Reuter. Eine Entwicklung, die im "Sofortismus" unserer sozialen Netzwerke gipfelt. Wer angesichts dieser vorgegebenen Taktung wieder lernen möchte, innezuhalten, dem empfiehlt der Autor einen Besuch im Theater: In einer Aufführung von Samuel Becketts Klassiker "Warten auf Godot" fühlte er sich auf anregende Weise in ein bewussteres Zeitgefühl versetzt:
"Es ist natürlich erst mal ein Zustand der Leere, aber aus dieser Leere heraus erwächst auch etwas. Zuallererst die Selbstreflexion: Was mache ich denn überhaupt mit meiner Zeit? Will ich sie wirklich immer mit Geld verrechnen? Oder bin ich vielleicht auch einfach nur mal da, wo ich gerade bin?"
(fka)