Tote Körper
Das makabre Interesse an toten Menschenkörpern hat Hochkonjunktur. Zehntausende besuchen zurzeit Museen, wo alte Mumien oder neupräparierte Leichen ausgestellt sind.
Jüngst präsentierte man im Tal der Könige den Leichnam des jugendlichen Pharaos Tutanchamun in einer Glasvitrine. Maske, Tücher und Binden, die sein Leben in der Unsterblichkeit schützen sollten, hatte man entfernt, um die Überreste ungeschminkt darzubieten. In Scharen strömten die Zuschauer herbei. Das wohlgeformte Jünglingsgesicht ist nicht mehr erkennbar. Die vollen Lippen sind ausgedörrt und über die Schneidezähne zurückgezogen. Zahllose Risse überziehen das schwärzlich verätzte Antlitz. Von dem Despoten ist nichts übrig als eine fast verkohlte Leiche.
Ist ein realer Körper nicht greifbar, stürzen sich die Zeitgenossen auf die Bilder der Toten: den Leichnam eines Ministerpräsidenten in der Badewanne, den entstellten Schädel einer Nobelprostituierten, Fotos aus Polizeiarchiven, Bilder verhungerter Nachbarkinder, zerquetschter Unfallopfer oder feixender Soldaten, die auf den Totenschädel urinieren, dem Gesicht aller Gesichter. Auf den Fernsehkanälen erfreuen sich Serien mit Pathologen besonderer Beliebtheit. Manchmal kann man sie bei der Sektionsarbeit beobachten, beim Aufsägen des Brustkorbs oder beim Zerschneiden der Leber. Natürlich geschieht all dies stets von Rechts wegen oder um der Wahrheit willen. Auch das Studium alter Gräber soll ja weniger unsere Sensationsgier befriedigen als unser Wissen vermehren. Bevor man den nackten Pharao den Touristen vorwarf, ermittelte ein moderner Computertomograph, dass der Leichnam diverse Brüche der Beinknochen aufwies.
Man kann den aktuellen Sinn fürs Makabre als Verlust der Pietät, als Leichenschändung oder als Störung der Totenruhe brandmarken. Aber entgegen einer landläufigen Meinung ging die menschliche Spezies auch früher mit den Toten nicht sonderlich achtsam um. Die allermeisten wurden verscharrt, anonym begraben oder einfach den Elementen überlassen. Die Toten, das sind die Überlebten. Zeitweise wurden ihre Knochen nach der Bestattung wieder ausgegraben und in Beinhäusern aufgehäuft, um in der Erde Platz zu schaffen. Nur Personen von Rang und Bedeutung konnten auf einen ehrenvollen Umgang mit ihren Überresten spekulieren.
Der Zwiespalt gegenüber toten Körpern ist so alt wie das Gattungswesen. Furcht und Entsetzen flößen die Toten ein, denn sie zeigen, dass jedes Leben, auch das eigene endlich ist. Zugleich lösen sie Mitleid aus, Trauer, Trennungsschmerz - und die Genugtuung über das eigene Überleben. Die Toten sind gefährlich. Sie rufen ihre Nächsten zu sich herüber. Sie senden ihnen Unglück und Krankheiten. In den Träumen sind sie allgegenwärtig. Die Lebenden fürchten ihren Groll und ihren Neid. Daher hält man sie mit Nahrung und Ehrung zufrieden. Man geleitet sie zum Grab, um sie endgültig zu verabschieden. Wiedergänger kommen erst zur Ruhe, wenn sie beerdigt sind. Schaurig, unheimlich ist es in der Stadt der Toten. Von Stunde zu Stunde werden sie mehr. Mit jedem Sterbefall wächst ihre Zahl. Die Zivilisation der Lebenden gründet auf einem unermesslichen Berg von Toten.
Die Lebenden können nur frei existieren, wenn sie sich von den Toten lösen, wenn sie die Vorfahren hinter sich lassen. Deshalb werden die Körper der Erde, dem Wasser oder den Lüften anbefohlen. Die Bestattung verbannt den Leichnam aus der Lebenswelt und befreit das Bild des Verstorbenen von seiner physischen Umklammerung. Indem sie die materiellen Überreste beseitigt, kann die Gesellschaft das Bild der Verstorbenen in ihre Phantasie aufnehmen. In der Erinnerung verliert der Tote seinen Schrecken. Nicht als unheimliche Kraft ist er gegenwärtig, sondern nur mehr als eine Vorstellung, als ein Schattenbild seiner selbst. Auf Photographien, Grabmälern, Masken oder Portraits halten die Überlebenden die Toten im Gedächtnis. Der Abschied von dem, was an den Verstorbenen leblos ist, birgt die Voraussetzung dafür, dass die Toten gefahrlos den Weg in das Reich des Geistes finden können.
Von dieser Praxis hat sich das nekrophile Interesse der Zeitgenossen weit entfernt. Sie suchen kein Gedächtnisbild, sondern den gefahrlosen Nervenkitzel, den Genuss leichten Ekels und Schauders. Die Sehnsucht nach Angstlust ist ebenso luxuriös wie kurzsichtig. Der Wunsch, dem Tod ins Fleisch zu sehen, befällt nur Gesellschaften, die das grausame Gesicht des wirklichen Todes offenbar vergessen haben. Nur Subjekte, welche sich insgeheim für unsterblich halten, können auf die Idee verfallen, der entstellte Leichnam sei nicht das Spiegelbild ihrer selbst.
Wolfgang Sofsky, Jahrgang 1952, ist freier Autor und Professor für Soziologie. Er lehrte an den Universitäten Göttingen und Erfurt. 1993 wurde er mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Er publizierte u.a.: "Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager" (1993), "Figurationen sozialer Macht. Autorität - Stellvertretung - Koalition" (mit Rainer Paris, 1994) und "Traktat über die Gewalt" (1996). 2002 erschien "Zeiten des Schreckens. Amok, Terror, Krieg", "Operation Freiheit. Der Krieg im Irak" und 2007 der Band "Verteidigung des Privaten".
Ist ein realer Körper nicht greifbar, stürzen sich die Zeitgenossen auf die Bilder der Toten: den Leichnam eines Ministerpräsidenten in der Badewanne, den entstellten Schädel einer Nobelprostituierten, Fotos aus Polizeiarchiven, Bilder verhungerter Nachbarkinder, zerquetschter Unfallopfer oder feixender Soldaten, die auf den Totenschädel urinieren, dem Gesicht aller Gesichter. Auf den Fernsehkanälen erfreuen sich Serien mit Pathologen besonderer Beliebtheit. Manchmal kann man sie bei der Sektionsarbeit beobachten, beim Aufsägen des Brustkorbs oder beim Zerschneiden der Leber. Natürlich geschieht all dies stets von Rechts wegen oder um der Wahrheit willen. Auch das Studium alter Gräber soll ja weniger unsere Sensationsgier befriedigen als unser Wissen vermehren. Bevor man den nackten Pharao den Touristen vorwarf, ermittelte ein moderner Computertomograph, dass der Leichnam diverse Brüche der Beinknochen aufwies.
Man kann den aktuellen Sinn fürs Makabre als Verlust der Pietät, als Leichenschändung oder als Störung der Totenruhe brandmarken. Aber entgegen einer landläufigen Meinung ging die menschliche Spezies auch früher mit den Toten nicht sonderlich achtsam um. Die allermeisten wurden verscharrt, anonym begraben oder einfach den Elementen überlassen. Die Toten, das sind die Überlebten. Zeitweise wurden ihre Knochen nach der Bestattung wieder ausgegraben und in Beinhäusern aufgehäuft, um in der Erde Platz zu schaffen. Nur Personen von Rang und Bedeutung konnten auf einen ehrenvollen Umgang mit ihren Überresten spekulieren.
Der Zwiespalt gegenüber toten Körpern ist so alt wie das Gattungswesen. Furcht und Entsetzen flößen die Toten ein, denn sie zeigen, dass jedes Leben, auch das eigene endlich ist. Zugleich lösen sie Mitleid aus, Trauer, Trennungsschmerz - und die Genugtuung über das eigene Überleben. Die Toten sind gefährlich. Sie rufen ihre Nächsten zu sich herüber. Sie senden ihnen Unglück und Krankheiten. In den Träumen sind sie allgegenwärtig. Die Lebenden fürchten ihren Groll und ihren Neid. Daher hält man sie mit Nahrung und Ehrung zufrieden. Man geleitet sie zum Grab, um sie endgültig zu verabschieden. Wiedergänger kommen erst zur Ruhe, wenn sie beerdigt sind. Schaurig, unheimlich ist es in der Stadt der Toten. Von Stunde zu Stunde werden sie mehr. Mit jedem Sterbefall wächst ihre Zahl. Die Zivilisation der Lebenden gründet auf einem unermesslichen Berg von Toten.
Die Lebenden können nur frei existieren, wenn sie sich von den Toten lösen, wenn sie die Vorfahren hinter sich lassen. Deshalb werden die Körper der Erde, dem Wasser oder den Lüften anbefohlen. Die Bestattung verbannt den Leichnam aus der Lebenswelt und befreit das Bild des Verstorbenen von seiner physischen Umklammerung. Indem sie die materiellen Überreste beseitigt, kann die Gesellschaft das Bild der Verstorbenen in ihre Phantasie aufnehmen. In der Erinnerung verliert der Tote seinen Schrecken. Nicht als unheimliche Kraft ist er gegenwärtig, sondern nur mehr als eine Vorstellung, als ein Schattenbild seiner selbst. Auf Photographien, Grabmälern, Masken oder Portraits halten die Überlebenden die Toten im Gedächtnis. Der Abschied von dem, was an den Verstorbenen leblos ist, birgt die Voraussetzung dafür, dass die Toten gefahrlos den Weg in das Reich des Geistes finden können.
Von dieser Praxis hat sich das nekrophile Interesse der Zeitgenossen weit entfernt. Sie suchen kein Gedächtnisbild, sondern den gefahrlosen Nervenkitzel, den Genuss leichten Ekels und Schauders. Die Sehnsucht nach Angstlust ist ebenso luxuriös wie kurzsichtig. Der Wunsch, dem Tod ins Fleisch zu sehen, befällt nur Gesellschaften, die das grausame Gesicht des wirklichen Todes offenbar vergessen haben. Nur Subjekte, welche sich insgeheim für unsterblich halten, können auf die Idee verfallen, der entstellte Leichnam sei nicht das Spiegelbild ihrer selbst.
Wolfgang Sofsky, Jahrgang 1952, ist freier Autor und Professor für Soziologie. Er lehrte an den Universitäten Göttingen und Erfurt. 1993 wurde er mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Er publizierte u.a.: "Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager" (1993), "Figurationen sozialer Macht. Autorität - Stellvertretung - Koalition" (mit Rainer Paris, 1994) und "Traktat über die Gewalt" (1996). 2002 erschien "Zeiten des Schreckens. Amok, Terror, Krieg", "Operation Freiheit. Der Krieg im Irak" und 2007 der Band "Verteidigung des Privaten".
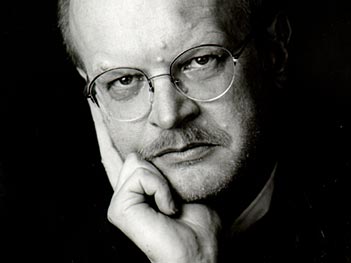
Wolfgang Sofsky© privat