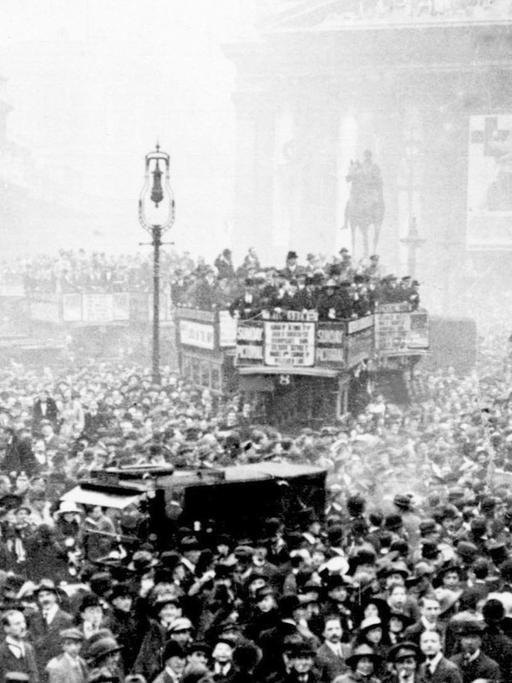Der Krieg geht im Kopf weiter

Wenn ein Krieg beendet ist, herrscht noch lange kein Frieden in den Köpfen der Menschen, die ihn erleben mussten. Sie sind traumatisiert - ganz gleich, ob sie Opfer oder Täter waren. Das zeigt eine Ausstellung im Museum Europäischer Kulturen.
Der Krieg lässt Menschen traumatisiert zurück – Opfer und Täter gleichermaßen. Das Trauma unterscheidet nicht zwischen Tätern und Opfern, die weiterleben, wenn der Krieg beendet ist. Ihr Krankheitsbild ist gleich. Begzada Alatovic hat in Bosnien-Herzegowina in einem Dorf gelebt – mit Christen und Muslimen, mit Serben und Bosniern. Sie führte ein glückliches Leben, nachbarschaftlich und solidarisch. Dann kam der Krieg. Und er machte aus den jahrzehnte langen Nachbarn plötzlich Feinde. Begzadas Mann wurde getötet.
Begzada Alatovic: "Da kam dann die Armee aus Serbien. Es sind auch die Flugzeuge dazu gekommen. Unter dieser ganzen Bombardierung, Waffen. Dann waren wir auf der Flucht. Und da sind dann immer die Bilder und auch noch die Stimmen von weinen, Hysterie. Da sind verschiedene Stimmen gewesen, die mich sehr lange auch noch begleitet haben."
Und zwar auf ihrer Flucht bis nach Berlin und viele Jahre lang. Was Alatovic auf einem Podiumsgespräch im Berliner Museum für Europäische Kulturen beschreibt, erleben alle Traumatisierten gleichermaßen. Zum Krankheitsbild eines Traumas gehört aber viel mehr, weiß die Psychologin Rahel Fink, die mit betroffenen Menschen aus Kriegsgebieten arbeitet.
Grundgefühl der Sicherheit ist erschüttert
Rahel Fink: "Wenn Patienten kommen, leiden die in der Regel unter Schlafstörungen. Sie können nicht einschlafen und schon gar nicht durchschlafen, weil sie Albträume haben. Sie haben Flashbacks. Flashbacks sind Situationen, also so Blitzlichter, die ins Gehirn schießen, wo immer wieder Bilder gesehen werden aus der traumatisierenden Situation. Sie sind sehr verunsichert, gucken um sich, weil das Grundgefühl der Sicherheit völlig erschüttert wurde, und sie beschreiben eine starke Rückzugstendenz, dass man die Öffentlichkeit meidet, dass man gerne allein sein möchte, dass man Ängste entwickelt hat, U-Bahn zu fahren, oder in Menschenmassen unterwegs zu sein und Süchte und Zwänge eine Rolle spielen."
Mit dem Ende eines Krieges enden nicht die Erlebnisse. Der Krieg geht im Kopf weiter. Die Nachkriegszeit kann lange Jahre oder bis zum Tod dauern, wenn das Trauma nicht behandelt wird. Begzada Alatovic fand in Berlin Hilfe - in einem Verein, in dem ursprünglich die jugoslawischen Gastarbeiter organisiert waren. Dass es möglich ist, ein Trauma zu verarbeiten, hat sie dort gelernt. Aber sie war nicht allein. Mit 70 anderen traumatisierten Frauen saß sie in einer Gruppentherapie.
Alatovic: "Um mein Trauma zu überwinden, es hat lange gedauert, fast sieben Jahre, wo ich mich immer selbst gefragt habe, ob ich das irgendwann selbst überwinden würde. Ich konnte über mein Schicksal zwei Jahre lang in der Gruppe nicht reden. Und dann habe ich mit der Zeit auch Mut, dass ich dann darüber sprechen kann."
Trauma kann den Alltag dominieren
Nach sieben Jahren Therapie hat Begzada Alatovic den Punkt erreicht, den die Psychologin Rahel Fink als das Ziel einer Behandlung definiert.
"Das Ziel ist, das Trauma, das traumatische Ereignis in die Biografie zu integrieren, das heißt, eines Tages sagen zu können, ja, genau das hat stattgefunden dann und dann, dass man vieles abrufen kann, wie das Wissen, das jeder Mensch hat, das fachliche Wissen, also alles, was im menschlichen Archiv – jetzt banal ausgedrückt – vorhanden ist, dass genau dort auch das traumatische Ereignis abgelegt werden kann."
Denn dann, so die Therapeutin, würde nicht das Trauma den Alltag dominieren, sondern der Alltag das Trauma. Und das gelte für traumatisierte Kriegsopfer wie Begzada Alatovic genauso wie auch für die Soldaten, die aus einem Krieg zurückkehren. Begzada Alatovic hat ihr Trauma verarbeitet. Die Bundeswehr und damit viele Soldaten, so Rahel Fink, seien noch am Anfang. Der erste Schritt sei aber getan: Die Verantwortlichen würden das Problem Trauma jetzt kennen und anerkennen.