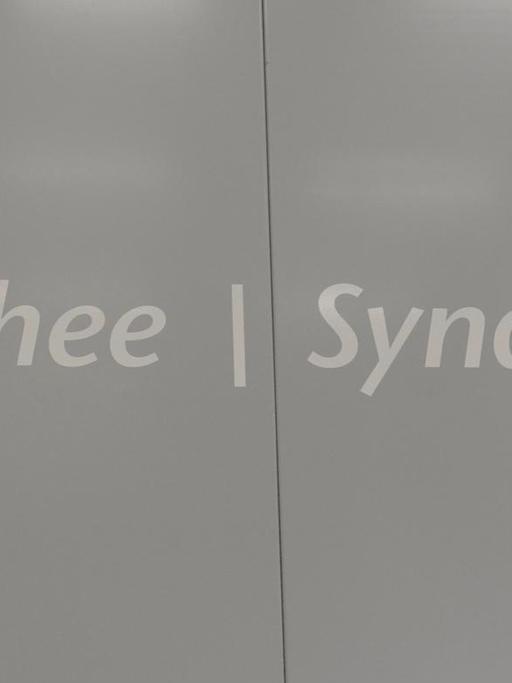Dialog von unten

Hier werden Feindbilder überwunden: Die "Muslim Jewish Conference" ist ein Forum junger Muslime und Juden aus der ganzen Welt, in dieser Woche trafen sich die Teilnehmer in Berlin. Offizielle Religionsvertreter sind nicht unter ihnen.
Ilja Sichrowsky, Gründer der "Muslim Jewish Conference" sitzt im Hotelgarten und verscheucht eine Wespe mit einer flüchtigen Handbewegung. Den jungen Politologen bringt nichts so schnell aus der Ruhe, nicht am letzten Tag seiner Konferenz. Die Idee dazu hatte der Student vor fast zehn Jahren.
"Ich habe die Universität Wien auf internationalen Studentenkonferenzen vertreten und 2005 den Hotelflur mit einer pakistanischen Delegation geteilt. Vor denen hatte ich aufgrund der Masse an Vorurteilen in meinen Kopf gehörige Angst. Die haben genau so ausgesehen wie alle Stereotypen, die mir je in den Kopf gesetzt wurden. Und ein junger Pakistani aus der Delegation hat sich getraut, den ersten Juden, den er je gesehen hat, zu fragen, ob er nicht Lust hat auf einen Kaffee zu gehen."
Aus dem Kaffee wurde Freundschaft, aus der Freundschaft eine Vision: Die "Muslim Jewish Conference" als Forum junger Muslime und Musliminnen, von Juden und Jüdinnen aus der ganzen Welt, finanziert allein aus Spenden.
"Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass der Dialog von denen, die ihn benötigen, nicht ernst genommen wird, wenn diese Fragen nicht diskutiert werden, die Rolle der Frau in der Religion, der Israel-Palästina-Konflikt, Intoleranz in den eigenen Religionsgemeinschaften, all diese Tabuthemen, die normalerweise in den sogenannten Humus-Kumbaya-Treffen nicht besprochen werden. Diese Nachmittagstreffen, wo man ein bisschen Humus zusammen isst und dann Kumbaya singt."
Es geht immer um die Wahrnehmung des "Anderen"
Sichrowsky und seine Mitstreiter wollen mehr erreichen als das, was auf interreligiösen Konferenzen mit offiziellen Vertretern passiert. Deswegen der abgeschiedene Tagungsort, deswegen treffen sich die 120 Teilnehmer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Viele haben im Ausland studiert, junge Ingenieure, Soziologen, Betriebswirte, nur offizielle Religionsvertreter finden sich nicht unter ihnen.
Wir sind keine Theologen oder Religionsfachleute, sondern Experten des eigenen Alltags, sagt Maryam Ahmed, Juristin aus Pakistan und eine der Organisatorinnen.
"Das macht den Zauber unserer Konferenz aus. Dass man Abstand von den eigenen Lebensumständen nimmt, einfach mal innehält und aufnimmt."
Dazu haben die Teilnehmer eine Woche lang Zeit. Getagt wird in Arbeitskreisen: Religiöse Identität, die Rollen von Frauen und Männer in der eigenen und der anderen Tradition, Antisemitismus und Islamophobie in den Medien. Es geht immer um die Wahrnehmung des "Anderen". Das gilt auch für das große Dauerthema auf allen Konferenzen: Der Konflikt zwischen Israel und Palästina.
Maryam erinnert sich an die Konferenz im vergangenen Jahr in Wien, mitten im Gaza-Krieg:
"Da waren Leute, die Familienangehörige in Israel und Gaza hatten, wo zur gleichen Zeit Bomben hochgingen und geschossen wurde. Und die saßen da und haben einander zugehört. Das war schon ein Wunder, wie ehrlich und respektvoll die miteinander umgegangen sind."
Auch Jonathan Hempel, der Vater aus einer deutsch-christlichen, die Mutter aus einer israelisch-jüdischen Familie, erinnert sich noch gut an die angespannte Stimmung vor einem Jahr.
"Es ist schwierig für jemanden aus Palästina, eine israelische Person zu treffen, und zu hören, die war beim Militär, das ist hart, das bringt Emotionen. Und dann aber zu sagen, ich will zuhören, ich will dem Dialog eine Chance geben. Diese Konferenz bietet den Rahmen dafür."
"Wir haben etwas gemeinsam, und wir können uns gegenseitig unterstützen"
Selbst wenn der andere wie Hempel gerade seinen Militärdienst in Israel geleistet hat und man selbst aus einer palästinensischen Familie kommt. Aber die Trennlinien verlaufen nicht nur entlang der Religionszugehörigkeit:
"Es geht nicht nur um Juden und Muslime. Hier kommen auch Leute, für die die eigene Religion eher eine Frage der kulturellen Identität ist, mit Leuten zusammen, die die eigene Religion streng befolgen."
Das zeigen die Diskussionen im Arbeitskreis zu "Gender und Religion"
"Über das Kopftuch als Zeichen der Emanzipation zu reden, das war für mich spannend, einfach über diese Sachen zu reden mit Respekt und über LGBT zu reden."
Für Jonathan, den Politologen mit zwei Pässen, war die Diskussion mit der Kopftuch-Trägerin Maryam genauso spannend wie die Debatte über LGBT, Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle in beiden Religionen. Fernab vom sozialen Druck der eigenen Familie und unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind überraschende Begegnungen möglich, wie zum Beispiel die zwischen einer muslimischen Französin und der französischen Jüdin Sophie:
"Es war total spannend, sich mit ihr über Rassismus in unserem jeweiligen Kontext auszutauschen, weil wir beide sehr traurig waren über die rassistischen Stereotypen in unseren eigenen Gemeinschaften."
Sophie Lalon ist das erste Mal dabei. Auf die Frage, was sie am Ende dieser Woche mitnehmen wird nach Hause, in ihre Gemeinde, in ihre Familie muss sie nicht lange überlegen:
"Das Gefühl, ich bin nicht alleine mit dem, was ich glaube. Wir haben wirklich etwas gemeinsam, und wir können uns gegenseitig unterstützen."
Nicht nur mit guten Ratschlägen bei Wespenstichen. Die angebotene Zwiebel für den geschwollenen Unterarm lehnt Ilja Sichrowsky allerdings ab.
Da brauchen die Teilnehmer der Jewish Muslim Conference nur die Nachrichten aus ihren Weltgegenden zu verfolgen. Es wird vielleicht noch lange dauern, bis ihre gemeinsamen Erfahrungen die Schlagzeilen bestimmen, aber entmutigen lassen werden sich Ilja, Maryam, Jonathan und Sophie und die anderen dadurch noch lange nicht.