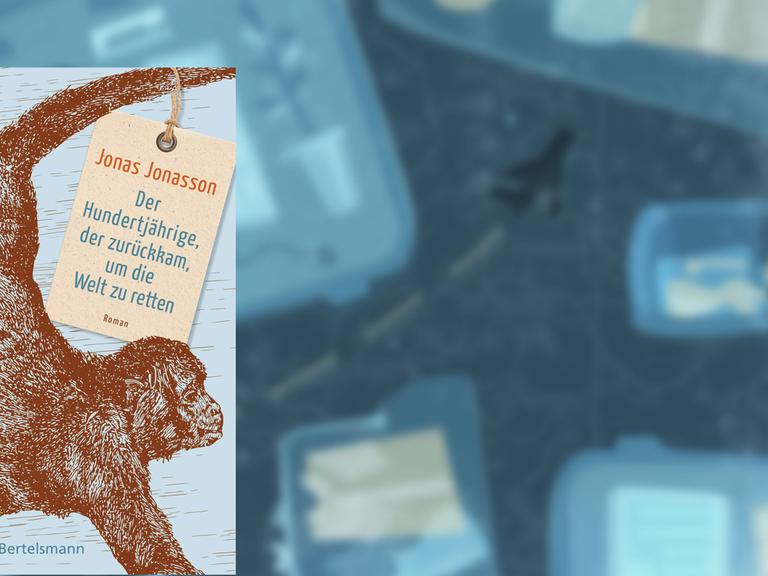Tristan Garcia: "Das Siebte"
Aus dem Französischen von Birgit Leib
Wagenbach Verlag, Berlin 2019
304 Seiten, 24 Euro
Ein Held, der ewig lebt
06:02 Minuten

Ein Leben in sieben Geschichten: Tristan Garcia lässt seinen Helden in dem Roman "Das Siebte" nicht sterben, sondern immer wieder von Neuem beginnen - als höherer Beamter, als Nobelpreisträger oder als Barrikadenkämpfer.
Ein sieben Jahre alter Junge bettet einen verletzten Vogel in eine Schachtel und pflegt ihn. Als er sieht, wie ein Hund den Vogel mit einem Biss tötet, überfällt ihn Angst. Wenige Stunden später fließt zum ersten Mal Blut aus seiner Nase. Im Pariser Top-Krankenhaus Val de Grâce stoppt ein junger Artzt den bedrohlich starke Blutfluss. Er nimmt dem Jungen das Versprechen ab, an das ewige Leben zu glauben. Garcias heranwachsender Held bleibt ein Stigmatisierter, ein sich auserwählt Fühlender, der von Zeit zu Zeit blutet, aber alles andere als eine Heilsfigur ist. Nachdem er altersschwach im Pflegeheim gestorben ist, lässt der Autor ihn wiederauferstehen.
Der Namenlose lebt nicht einfach nur weiter. Er muss alle menschlichen Wachstumsphasen erneut durchlaufen, dies jedoch bei gereiftem Bewusstsein. Am meisten Kraft kostet es das wiedergeborene Kleinkind, die Welt mit den Augen eines alten Mannes zu betrachten und zu wissen, dass "alles geht und alles zurück kommt, es aber nichts nützt".
Der Namenlose lebt nicht einfach nur weiter. Er muss alle menschlichen Wachstumsphasen erneut durchlaufen, dies jedoch bei gereiftem Bewusstsein. Am meisten Kraft kostet es das wiedergeborene Kleinkind, die Welt mit den Augen eines alten Mannes zu betrachten und zu wissen, dass "alles geht und alles zurück kommt, es aber nichts nützt".
Ein etwas enttäuschender "Antizipationsroman"
Die Eltern, der Doktor im Hospital und die Ehefrau gehören zu den Konstanten der sieben verschachtelten Varianten eines menschlichen Lebens. Erst ist der Namenlose ein höherer Beamter, dann ein Nobelpreisträger für Medizin. Mal gibt er den Provinz-Guru und schart Anhänger um sich, mal steht er auf den Barrikaden, als ein Bürgerkrieg von den französischen Großstädten auf das Land übergreift. Nachdem er seine Geliebte mit perversen Spielen in den Wahnsinn getrieben hat, wird der Protagonist zum Schriftsteller und schlussendlich ein Gelegenheitsarbeiter. Erst dann lässt Garcia ihn sterben und uns erlöst er von der Lektüre eines Buches, dem der Autor mehrfach, penetrant absichtsvoll das Etikett "Antizipationsroman" anheftet.
Antizipationsromane enttäuschen in der Regel. Reicht die projizierte Wirklichkeit doch selten an die Komplexität heutiger wie zukünftiger gesellschaftlicher Erfahrungen heran. Garcia schreibt philosophisch durchwirkte Ideenprosa. Die Frage, in welchen ideologischen Konzepten und Berufszwängen sich das Leben verfangen kann, ist der leicht erkennbare Faden, der die sieben in sich geschlossenen Geschichten zusammenhält. Dass der Protagonist sich als Sterblicher mit seiner ersten, durchschnittlichen Existenz aussöhnen wird und schon der Gedanke an die Unsterblichkeit reicht, einen lebensmüde werden zu lassen, begreift man früh.
Antizipationsromane enttäuschen in der Regel. Reicht die projizierte Wirklichkeit doch selten an die Komplexität heutiger wie zukünftiger gesellschaftlicher Erfahrungen heran. Garcia schreibt philosophisch durchwirkte Ideenprosa. Die Frage, in welchen ideologischen Konzepten und Berufszwängen sich das Leben verfangen kann, ist der leicht erkennbare Faden, der die sieben in sich geschlossenen Geschichten zusammenhält. Dass der Protagonist sich als Sterblicher mit seiner ersten, durchschnittlichen Existenz aussöhnen wird und schon der Gedanke an die Unsterblichkeit reicht, einen lebensmüde werden zu lassen, begreift man früh.
Jammern über die Jugend
Die stupende Schlichtheit etlicher Betrachtungen lädt zu kursorischem Lesen ein. So, wenn Garcia den erst fünfzig Jahre alten Ich-Erzähler wie einen Greis über die verlorene Fähigkeit sinnieren lässt, immer weniger im Jetzt zu leben, und gleich danach die junge Generation bejammert wird. "Der Großteil von dem, womit die Jugendlichen sich beschäftigen, schien mir einer Art spekulativer Fiktion anzugehören."
Muss die Figur eines Wiedergeborenen zwangsläufig ein aus der Welt Gefallener sein? Der Tenor des Romans ist ein verhalten defätistischer. Wieder und wieder erkennt der Erzähler: "Am Ende, selbst wenn ich die Revolution machte, würde letztlich doch wieder alles auf null zurückgesetzt."
Garcia überzeugt als Erzähler nur, wenn er sich unspektakulären Beobachtungen hingibt und sinnlichen Eindrücken traut. Dann schaut man wirklich mit den Augen seines Helden auf die zarten Handgelenke der hippiehaften Gitarrenspielerin, die seine große Liebe werden sollte. Und auch die eine, beiläufig eingestreute Einsicht behält man gern im Kopf und nimmt sich vor, die eigenen Sinne tagtäglich zu schärfen, denn: "Das Einzige, was zählt, ist das erste Mal".
Muss die Figur eines Wiedergeborenen zwangsläufig ein aus der Welt Gefallener sein? Der Tenor des Romans ist ein verhalten defätistischer. Wieder und wieder erkennt der Erzähler: "Am Ende, selbst wenn ich die Revolution machte, würde letztlich doch wieder alles auf null zurückgesetzt."
Garcia überzeugt als Erzähler nur, wenn er sich unspektakulären Beobachtungen hingibt und sinnlichen Eindrücken traut. Dann schaut man wirklich mit den Augen seines Helden auf die zarten Handgelenke der hippiehaften Gitarrenspielerin, die seine große Liebe werden sollte. Und auch die eine, beiläufig eingestreute Einsicht behält man gern im Kopf und nimmt sich vor, die eigenen Sinne tagtäglich zu schärfen, denn: "Das Einzige, was zählt, ist das erste Mal".