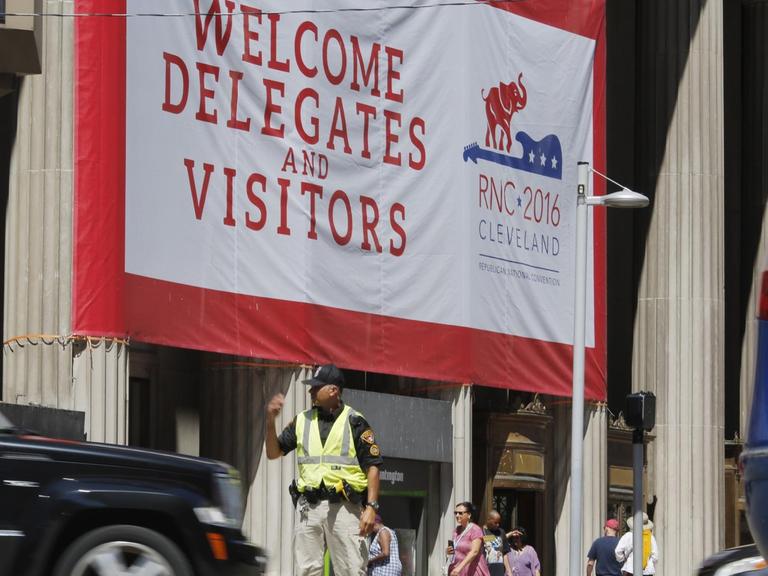Mexikaner sind die Unerwünschten

Er will eine undurchlässige Mauer entlang der mexikanischen Grenze errichten, und die Mexikaner sollen sie auch noch bezahlen: Das ist ein besonders drastisches Beispiel aus Trumps Populismus-Programm. Aber steht er damit alleine? Weit gefehlt! Mexikanerfeindlichkeit ist in den USA weit verbreitet.
Keine Haltung Donald Trumps findet so breite Zustimmung unter seinen Anhängern wie die, den Mexikanern an allem die Schuld zu geben. Diese Einstellung hat ihm in der internationalen Öffentlichkeit viel Antipathie eingebracht. Allerdings hat die Art, in der seine Person medialisiert wurde, dazu geführt, dass Trumps Kritiker seinen Antimexikanismus als Teil seiner geschmacklosen, populistischen Strategie deuten, statt als treffende Lektüre eines Diskurses und politischer Handlungen, die in den USA längst üblich sind.
Diese Interpretation, davon bin ich überzeugt, ist falsch.
Das Problem, dieses Phänomen auf Trump zu reduzieren, ist offensichtlich: Es schließt die Analyse all dessen aus, was seinen Aufstieg ermöglicht hat. Im Laufe des Wahlkampfes war zu beobachten, wie sich die republikanischen Kandidaten darüber einig waren, wie wichtig es sei, mehr als zwölf Millionen Migranten zu deportieren und vermehrt Razzien an Arbeitsstellen durchzuführen.
Diese Interpretation, davon bin ich überzeugt, ist falsch.
Das Problem, dieses Phänomen auf Trump zu reduzieren, ist offensichtlich: Es schließt die Analyse all dessen aus, was seinen Aufstieg ermöglicht hat. Im Laufe des Wahlkampfes war zu beobachten, wie sich die republikanischen Kandidaten darüber einig waren, wie wichtig es sei, mehr als zwölf Millionen Migranten zu deportieren und vermehrt Razzien an Arbeitsstellen durchzuführen.
Alle vier Jahre gibt es Wahlspots auf Spanisch
PolitikerInnen, RichterInnen und BürgermeisterInnen im ganzen Land wiederholen immer wieder Argumente, die Mexikaner stereotypieren, und signalisieren, diese seien für die angeblichen Lohnsenkungen und die wachsende Kriminalität in den USA verantwortlich. Sie ignorieren damit den wissenschaftlichen Konsens über zwei Tatsachen, die sowohl für nicht registrierte, wie auch legale Migranten gelten: 1. Hohe Einwanderungsquoten führen nicht zu mehr Gewaltverbrechen. 2. Einwanderer helfen die Wirtschaft der USA anzukurbeln und konkurrieren in der Praxis nicht mit US-Bürgern um Arbeitsplätze.
Diese Haltung gegenüber Migranten bezieht sich nicht ausschließlich auf die Republikaner. Während der Regierungszeit Obamas wurden von nationalen Behörden über eine halbe Millionen Mexikaner pro Jahr deportiert. Zudem erfreuen sich willkürliche Festnahmen durch racial profiling immer größerer Beliebtheit. Ein Verkehrsverstoß kann zur Deportation eines Einwanderers führen, der seit über zehn Jahren in den USA lebt.
Erstaunlich ist, in welchem Kontrast die Politik der Demokraten zu dem Image steht, das sie der mexikanischen Diaspora zu verkaufen suchen. Alle vier Jahre produzieren sie Wahlspots auf Spanisch; die Kandidaten erzählen von ihren Mexiko-Reisen in der Jugend, sie stellen ihre Latina Gattinnen bei Wahlveranstaltungen zur Schau und sprechen von der Zuneigung, die sie ihren Gärtnern, Kindermädchen und Köchinnen gegenüber empfinden.
Diese Haltung gegenüber Migranten bezieht sich nicht ausschließlich auf die Republikaner. Während der Regierungszeit Obamas wurden von nationalen Behörden über eine halbe Millionen Mexikaner pro Jahr deportiert. Zudem erfreuen sich willkürliche Festnahmen durch racial profiling immer größerer Beliebtheit. Ein Verkehrsverstoß kann zur Deportation eines Einwanderers führen, der seit über zehn Jahren in den USA lebt.
Erstaunlich ist, in welchem Kontrast die Politik der Demokraten zu dem Image steht, das sie der mexikanischen Diaspora zu verkaufen suchen. Alle vier Jahre produzieren sie Wahlspots auf Spanisch; die Kandidaten erzählen von ihren Mexiko-Reisen in der Jugend, sie stellen ihre Latina Gattinnen bei Wahlveranstaltungen zur Schau und sprechen von der Zuneigung, die sie ihren Gärtnern, Kindermädchen und Köchinnen gegenüber empfinden.
Notwendig, Trumps Rassismus aufzuzeigen
Sie appellieren an die mexikanischen Wähler und rühmen die, für die der American Dream wahr wurde: die angesehene Universitätsprofessorin, den tapferen Geschäftsmann. Es spielt keine Rolle, dass es sich dabei um wenige Beispiele handelt, die in einem kaputten System des sozialen Aufstiegs die Ausnahme sind. Ihnen stehen Millionen gegenüber, denen es nach Jahren harter Arbeit noch immer an Krankenversicherung, Aussicht auf Rente und Anerkennung mangelt.
Trumps Rassismus aufzuzeigen ist nicht nur angemessen. Es ist notwendig. Und dennoch sollten wir einen zentralen Punkt nicht aus den Augen verlieren: Für beide Parteien sind die Mexikaner Mittel zum Zweck. Im besten Fall sind sie eine Wählergruppe, deren Stimmen man sich sichern will, im schlechtesten eine Gruppe, die für Kriminalität, niedrige Löhne und Identitätsverlust verantwortlich gemacht wird. Die Republikaner haben den zweiten Weg gewählt; Clinton und die Ihrigen den ersten. Am Ende sind jedoch sowohl die einen, als auch die anderen bereit, den Kurs zu ändern, sofern die Konjunktur und der Zeitgeist das verlangen.
Carlos A. Pérez Ricart (geboren in Mexikostadt, 1987) ist Politologe und Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins México vía Berlín e.V.. Er arbeitet am Lateinamerikainstitut der Freien Universität Berlin und forscht zu den Themen Waffenhandel, Anti-Drogen-Politik in Mexiko und den Vereinigten Staaten, Militarisierung von Polizeibehörden, und Zunahme von staatlicher Gewalt in Lateinamerika. Twitter: @perezricart
Trumps Rassismus aufzuzeigen ist nicht nur angemessen. Es ist notwendig. Und dennoch sollten wir einen zentralen Punkt nicht aus den Augen verlieren: Für beide Parteien sind die Mexikaner Mittel zum Zweck. Im besten Fall sind sie eine Wählergruppe, deren Stimmen man sich sichern will, im schlechtesten eine Gruppe, die für Kriminalität, niedrige Löhne und Identitätsverlust verantwortlich gemacht wird. Die Republikaner haben den zweiten Weg gewählt; Clinton und die Ihrigen den ersten. Am Ende sind jedoch sowohl die einen, als auch die anderen bereit, den Kurs zu ändern, sofern die Konjunktur und der Zeitgeist das verlangen.
Carlos A. Pérez Ricart (geboren in Mexikostadt, 1987) ist Politologe und Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins México vía Berlín e.V.. Er arbeitet am Lateinamerikainstitut der Freien Universität Berlin und forscht zu den Themen Waffenhandel, Anti-Drogen-Politik in Mexiko und den Vereinigten Staaten, Militarisierung von Polizeibehörden, und Zunahme von staatlicher Gewalt in Lateinamerika. Twitter: @perezricart

Politologe Carlos A. Pérez Ricart.© privat