Über den Alltag der Achuar-Indianer
Im Amazonasurwald leben die Achuar-Indianer. Sie zählen zur Volksgruppe der Jívaros, die ihre Feinde nicht nur töten, sondern auch zu Schrumpfköpfen verarbeiten. Der französische Ethnologe Philippe Descola lebte bei den Achuar - und verfasste darüber ein Buch. Nun ist das Werk auch auf Deutsch erschienen.
Philippe Descola betrat ethnologisches Neuland, als er 1976 in das Gebiet der Achuar aufbrach. Zwar lebt der Stamm, der mit Shuar, Aguaruna und Huambisa aufgrund gemeinsamer Sprachherkunft und Kulturelemente das Volk der Jívaro ausmacht, in einem Gebiet von der Größe Portugals, doch so wie er über Jahrhunderte erfolgreich der Kolonialherrschaft widerstanden hat, entzieht er sich bis heute allen Missionierungsversuchen. Selbst das Interesse an Gebrauchsgütern der sogenannten Zivilisation beschränkt sich auf wenige Dinge: Gewehre, Macheten, Stoffe und Glasperlen. Die Achuar tauschen sie gegen Häute.
Descolas Buch "Leben und Sterben in Amazonien beschreibt erstmals den Alltag der Achuar, ihre Essgewohnheiten, Sitten und Gebräuche, ihre Art zu sprechen, ihr Glaubens- und Gesellschaftsgefüge, ihren Umgang mit dem Tod, sowie ihre Beziehungen zur Außenwelt.
Die Vergangenheit, etwa die Geschichte des Stammes, spielt für die Achuar keine Rolle:
"Kaum ein Achuar kennt die Namen seiner Urgroßeltern: das allenfalls über vier Generationen sich erstreckende Stammesgedächtnis geht regelmäßig in Verwirrung und Vergessen unter. Außer den Flüssen mit ihren wandernden, in ständiger Erneuerung begriffenen Betten ist hier kein Ort benannt."
Nach spätestens 15 Jahren hat die Witterung die Palmhäuser zerstört, in denen die Achuar-Großfamilien leben, und es wird an anderer Stelle neu gebaut. Zur Großfamilie zählen die verschiedenen Frauen des Oberhaupts, deren Kinder sowie die Söhne der Töchter, die, bevor sie ein eigenes Haus bauen, einige Jahre unter dem Dach des Hausherrn wohnen.
Man ernährt sich von der Jagd, vom Fischfang und vom Ertrag der Gärten, für die die Frauen zuständig sind. Diese haben im Übrigen den Männern zu gehorchen, und so manche Ehefrau war eine Kriegsbeute. Mit der Vorstellung vom friedlichen Leben im Einklang mit der Natur räumt das Buch gründlich auf: Jeder zweite Mann des Stammes fällt in Folge der Blutrache.
"Die weit voneinander entfernten Wohnsitze begünstigen eine systematische Verzerrung der geringfügigsten, von Haus zu Haus getragenen Neuigkeiten, jedesmal aus der Sicht anderer Besucher weitererzählt. Wenn die Glut einer alten Animosität durch ein neues Bündel schlechter Reden wieder auflebt, wenn eine lange aufgeschobene Rache durch einen frischen Vorwand wieder aktuell wird, bedarf es nur einer kleinen Unvorsichtigkeit, und es ist um das Leben des Mannes geschehen."
Das Leben im Krieg gegen eine andere Sippe ist höchst beschwerlich: Man verlässt das Haus nicht mehr aus Angst, der Feind könnte vor der Tür lauern, und die Familien leiden Hunger. Stirbt ein Mensch an einer Krankheit, wird dies meist einer Verwünschung durch einen feindlichen Schamanen zugeschrieben und das zieht oft ebenfalls eine Blutrache nach sich.
Zwar sind den Achuar durchaus pflanzliche Heilmittel aus dem Urwald bekannt, doch entgegen unseren Vorstellungen nutzen sie sie kaum. Sie vertrauen vielmehr ihren Schamanen, die mit Geisterbeschwörungen und Magie arbeiten und, so Descola, durchaus Heilerfolge zu verbuchen haben, wenn Krankheiten psychosomatischen Ursprungs sind.
Die Achuar leben ohne politische Strukturen, in einer anarchischen, individualistischen Gesellschaft, in der die soziale Kontrolle jedoch sehr ausgeprägt ist. Es gibt keine Stammesoberhäupter und keine Hierarchien, lediglich im Krieg haben die jeweiligen Kriegsparteien ihre Anführer.
"Von Demokratie zu sprechen, um diese libertären Bündnisse zu definieren, wäre weit übertrieben. Nicht nur, weil die Frauen von den äußeren Angelegenheiten ausgeschlossen sind, sondern auch, weil es weder ein Ideal von Gemeinwesen oder vom Gemeinwohl gibt, das geeignet wäre, private Interessen zu transzendieren. Noch eine unbestreitbare Autorität, die in der Lage wäre, einem solchen Projekt Gestalt zu verleihen: beides stünde der Aufrechterhaltung der jedem Familienoberhaupt zuerkannten Souveränität entgegen."
Descola beschreibt sehr detailliert, so dass sich der Leser in die Welt der Achuar hineinversetzen kann. Liedtexte, rituelle Monologe und Dialoge der Menschen untereinander runden das Bild ebenso ab wie Fotos und Skizzen. Der Autor vergleicht mit unserer Lebenswelt und gelegentlich mit der anderer Völker, doch er enthält sich der Wertung, sowie er auch seine eigenen Gefühle nur höchst selten einfließen lässt. Philippe Descola versteht außerdem spannend zu schildern und brillant zu formulieren. Bleibt noch anzumerken, dass die Achuar, obwohl sie zur Volksgruppe der Jívaros zählen, keine Schrumpfköpfe herstellen. Die gehen allein auf das Konto ihrer Nachbarn, der Shuar.
Philippe Descola: Leben und Sterben in Amazonien. Bei den Jivaro-Indianern.
Aus dem Französischen von Grete Osterwald. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2011, 471 Seiten, 32,90 Euro.
Descolas Buch "Leben und Sterben in Amazonien beschreibt erstmals den Alltag der Achuar, ihre Essgewohnheiten, Sitten und Gebräuche, ihre Art zu sprechen, ihr Glaubens- und Gesellschaftsgefüge, ihren Umgang mit dem Tod, sowie ihre Beziehungen zur Außenwelt.
Die Vergangenheit, etwa die Geschichte des Stammes, spielt für die Achuar keine Rolle:
"Kaum ein Achuar kennt die Namen seiner Urgroßeltern: das allenfalls über vier Generationen sich erstreckende Stammesgedächtnis geht regelmäßig in Verwirrung und Vergessen unter. Außer den Flüssen mit ihren wandernden, in ständiger Erneuerung begriffenen Betten ist hier kein Ort benannt."
Nach spätestens 15 Jahren hat die Witterung die Palmhäuser zerstört, in denen die Achuar-Großfamilien leben, und es wird an anderer Stelle neu gebaut. Zur Großfamilie zählen die verschiedenen Frauen des Oberhaupts, deren Kinder sowie die Söhne der Töchter, die, bevor sie ein eigenes Haus bauen, einige Jahre unter dem Dach des Hausherrn wohnen.
Man ernährt sich von der Jagd, vom Fischfang und vom Ertrag der Gärten, für die die Frauen zuständig sind. Diese haben im Übrigen den Männern zu gehorchen, und so manche Ehefrau war eine Kriegsbeute. Mit der Vorstellung vom friedlichen Leben im Einklang mit der Natur räumt das Buch gründlich auf: Jeder zweite Mann des Stammes fällt in Folge der Blutrache.
"Die weit voneinander entfernten Wohnsitze begünstigen eine systematische Verzerrung der geringfügigsten, von Haus zu Haus getragenen Neuigkeiten, jedesmal aus der Sicht anderer Besucher weitererzählt. Wenn die Glut einer alten Animosität durch ein neues Bündel schlechter Reden wieder auflebt, wenn eine lange aufgeschobene Rache durch einen frischen Vorwand wieder aktuell wird, bedarf es nur einer kleinen Unvorsichtigkeit, und es ist um das Leben des Mannes geschehen."
Das Leben im Krieg gegen eine andere Sippe ist höchst beschwerlich: Man verlässt das Haus nicht mehr aus Angst, der Feind könnte vor der Tür lauern, und die Familien leiden Hunger. Stirbt ein Mensch an einer Krankheit, wird dies meist einer Verwünschung durch einen feindlichen Schamanen zugeschrieben und das zieht oft ebenfalls eine Blutrache nach sich.
Zwar sind den Achuar durchaus pflanzliche Heilmittel aus dem Urwald bekannt, doch entgegen unseren Vorstellungen nutzen sie sie kaum. Sie vertrauen vielmehr ihren Schamanen, die mit Geisterbeschwörungen und Magie arbeiten und, so Descola, durchaus Heilerfolge zu verbuchen haben, wenn Krankheiten psychosomatischen Ursprungs sind.
Die Achuar leben ohne politische Strukturen, in einer anarchischen, individualistischen Gesellschaft, in der die soziale Kontrolle jedoch sehr ausgeprägt ist. Es gibt keine Stammesoberhäupter und keine Hierarchien, lediglich im Krieg haben die jeweiligen Kriegsparteien ihre Anführer.
"Von Demokratie zu sprechen, um diese libertären Bündnisse zu definieren, wäre weit übertrieben. Nicht nur, weil die Frauen von den äußeren Angelegenheiten ausgeschlossen sind, sondern auch, weil es weder ein Ideal von Gemeinwesen oder vom Gemeinwohl gibt, das geeignet wäre, private Interessen zu transzendieren. Noch eine unbestreitbare Autorität, die in der Lage wäre, einem solchen Projekt Gestalt zu verleihen: beides stünde der Aufrechterhaltung der jedem Familienoberhaupt zuerkannten Souveränität entgegen."
Descola beschreibt sehr detailliert, so dass sich der Leser in die Welt der Achuar hineinversetzen kann. Liedtexte, rituelle Monologe und Dialoge der Menschen untereinander runden das Bild ebenso ab wie Fotos und Skizzen. Der Autor vergleicht mit unserer Lebenswelt und gelegentlich mit der anderer Völker, doch er enthält sich der Wertung, sowie er auch seine eigenen Gefühle nur höchst selten einfließen lässt. Philippe Descola versteht außerdem spannend zu schildern und brillant zu formulieren. Bleibt noch anzumerken, dass die Achuar, obwohl sie zur Volksgruppe der Jívaros zählen, keine Schrumpfköpfe herstellen. Die gehen allein auf das Konto ihrer Nachbarn, der Shuar.
Philippe Descola: Leben und Sterben in Amazonien. Bei den Jivaro-Indianern.
Aus dem Französischen von Grete Osterwald. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2011, 471 Seiten, 32,90 Euro.
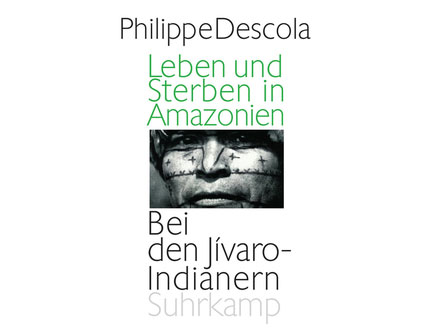
Cover: "Philippe Descola: Leben und Sterben in Amazonien"© Suhrkamp Verlag
