Über ökonomische Reflexe im Privaten
Gerade bietet die Alanus-Hochschule im nordrhein-westfälischen Alfter für angehende Manager einen neuen Studiengang an: BWL und Kunst. Betriebswirtschaftliche Leitungsmethoden sollen vom spielerischen Umgang der Kunst profitieren, Wirtschaft neu denken, so die Devise.
Der Autor Florian Felix Weyh könnte mit seinem neuen Buch "Vermögen. Was wir haben, was wir können, was wir sind" gut einen richtungweisenden Dozenten abgeben. Wenn er das Buch als Vorlesungsreihe vortrüge, würde rasch klar, dass der Begriff "Richtung" zu mechanisch gedacht ist. Und nicht jedes Profitieren lässt sich als ein in Geldsummen abrechenbarer Gewinn nachweisen.
Der 1963 geborene Schriftsteller und Journalist Weyh will mehr als Kreativitätstraining für Wirtschaftsmacher: Er erklärt uns die vielfältigen Reflexe des Ökonomischen im ganz Privaten. Und die privaten Möglichkeiten, auf ökonomische Zusammenhänge einzuwirken, die eben nicht nur rein wirtschaftliche sind. Dabei beginnt das Buch mit einem merkwürdigen Satz:
"Schon als Kind hielt sich Georg für vertauscht."
Ein altes und häufig variiertes Motiv, dem Autor offenbar nicht unvertraut, der es gleich in seinen Anekdotenkosmos deutend einordnet:
"Interessanterweise wird der vermutete Tausch dabei fast ausschließlich wirtschaftlich gedacht, statt an elterliche Charakterzüge geknüpft zu sein, deren Vererbung man panisch fürchtet. Nein, beim Verdacht, im falschen Milieu zu leben, geht es um Aufstiegsfantasien: um die Vorstellung, ein besseres Leben an anderen Orten zu versäumen. Der Blick richtet sich – mal neidvoll, mal resigniert – auf entgangene Möglichkeiten."
Der Autor geht weder neidvoll und gar nicht resigniert an ein Thema heran, das er in einer Mischung aus Feuilleton und fastwissenschaftlicher Studie umkreist. Der Hörer des "Politischen Feuilletons" in diesem Sender kennt diesen Stil von Florian Felix Weyh, den man zu den interessantesten Publizisten dieser Republik zählen darf.
Und der der Spannung zwischen dem abrechenbar Geschaffenen und unserem Vermögen, etwas zu schaffen sogar Lesevergnügen beim Leser herauskitzelt. Er umkreist immer wieder drei zentrale Kategorien "das Haben, das Können, das Sein".
Merkwürdige und allzu logische Fälle saugt die Beispielmaschine des Herrn Weyh auf und sortiert sie in sein immerhin 319 Seiten starkes Buch ein. Der Autor empfiehlt sich sozusagen selbst als Beispiel wie einer ohne großes "Haben", bei einem aus Wissen und Schreibfähigkeit gemixten "Können" zu einem würdigen Resultat in Form eines steinschweren Buches kommt. Was dieses "Sein" zu einem dauerhaften geraten lässt, entscheiden Käufer und Leser. Der Autor befasst sich mit dem eBay-Effekt für die Wertbildung und den Zusammenhang zwischen Konsum und Wert.
"Verbrauch ist das Gegenteil von Vermögensbildung und fast zynisch klingt der volks-wirtschaftliche Begriff vom "Ausgabenschock", der Haushalte ereilt, sobald sie konsumieren... Seit einigen Jahren lassen sich zwei Strömungen in unserer Einkaufswelt erkennen. Die "Geiz-ist-geil" Mentalität konzentriert sich nur auf die Kosten des Einkaufs, während die eBay-Mentalität überall den Wiederverkaufswert zu entdecken sucht."
Sparsamkeit verzichtet also oft auf spätere Wertbildung oder wenigstens Wertbeständigkeit. Kurzfristiges Erfolgsdenken führt oft nicht zu Erfolgen und man muss nicht nur bei diesem Beispiel an die Kurzatmigkeit mancher politischen Entscheidungen denken, die manisch auf den raschen Erfolg fixiert sind.
Der Vergleich mit der Politik stellt sich oft ein, gerade weil ihn der Autor nicht zwanghaft herbei schreibt. Er springt geschickt zwischen der Makro- und Mikroperspektive der Ökonomie, klärt auf und relativiert das soeben Aufgeklärte im spannungsreichen Wechsel. Ein simpler Ratgeber ist "Vermögen" nicht.
"Beim Tausch bekomme ich Geld, weil ich etwas mache (produziere, handle, arbeite); beim Transfer weil ich etwas bin (Kind, Beamter, Erbe). Ergo müssen beim Tausch Dinge einen Wert haben…während beim Transfer Beziehungen stabil und verlässlich sein sollten."
Bürokratien leben eher vom Transfer, jeder Tausch führt zu Aktivitäten. Ergo, um einmal das Buch zu verlassen, sollte jegliche Arbeitsmarktpolitik möglichst viele Möglichkeiten für Arbeitslose schaffen, ihre Fähigkeiten im Tausch gegen lang- oder kurzfristige Arbeitsverhältnisse einzubringen (auch mit Druck), statt ewig und endlos über die Kontrollmechanismen der Versorgungstransfers zu debattieren.
So gerät dieses Buch zu einem Plädoyer für den Markt; über seine positiven Möglichkeiten, Differenzen, Entfaltungsvarianten und auch seine Erotik, einschließlich der des Scheiterns.
Der Leser geht mit dem Autor auf Erkundungstour. So schildert er den Fall des 1964 verstorbenen Malers Conga, dessen drei Werke bei einer Auktion postum einen heutigen Wert von 21.000 Euro erzielten. Der stolze Besitzer hätte auch mehr gezahlt, ihn faszinierten die Werke, die kurz zuvor von anderen als zu entsorgende Leinwand klassifiziert worden wären, wertlos geworden durch das Beschmieren mit Farbe. Denn Conga war ein Affe.
"Fantasie und Kalkül – das sind die wesentlichen Triebkräfte eines Marktes ohne Transparenz und Vergleichbarkeit der Ware …vor allem aber ohne vernünftiges Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage…..Die Zahl nicht wach geküsster Werke in den Ateliers hoffnungsfroher Nachwuchskünstler und gescheiterter Veteranen dürfte in die Millionen gehen."
Dem Autor macht das Spiel mit den Exkursen des Zufalls Spaß, das Vermögen, was der Leser daraus zieht, liegt in einem sehr nützlichen Denk- und Wahrnehmungstraining. Und in vielen mehr oder weniger amüsanten Details, die auch ins Handbuch des unnützen Wissens passten. Aber wer weiß denn ganz sicher, was nützlich ist?
Weyh schlendert durch viele Bereiche: Wissen, Bedürfnislosigkeit, Zeit als Reichtum und Last, Zins und Schuld, Urheberrechte, eine Kapitelüberschrift lautet "Familienbande, Netzwerke und andere Geselligkeiten". Das dritte Kapitel über Grund und Boden gerät etwas handfester. Und an manchen Stellen, ob beim Glauben oder dem Meditieren über Freundschaften, spürt man den Hintergrund einer Generation Praktikum, die statt fester Arbeitsplätze das nötige Flexibilitätstraining für den freien Markt bekommt.
Und eine Portion Trost dazu: Vieles ist offen in der offenen Gesellschaft. Über die Deformationen aller Begrifflichkeiten unter diktatorischen Bedingungen reflektiert der Autor nicht. So kommen im Personenregister zwar Helmut Markwort und Christoph Schliengensief vor, nicht aber Karl Marx, der mit dem wohlbekannten "Kapital" ein noch voluminöseres Werk deutscher Sprache verfasste.
So wie Karl Marx seine ökonomischen Erkenntnisse teilweise ideologisiert, so misstraut Weyh solchen Einengungsversuchen. Ein Schimpfen auf den "Neo-Liberalismus" oder die Fata Morgana einer alles verschlingenden globalen Marktwirtschaft findet nicht statt. Er legt sich eher unverkrampft und nebenher auch mit jenen an, die den Begriff "Humankapital" einmal zum "Unwort des Jahres" wählten. Weyh zitiert da den Bochumer Statistikprofessor Walter Krämer:
"Ein Jammer, dass man durch das Eingeständnis, von Mathematik und Wirtschaft wenig zu verstehen, hierzulande auch noch soziale Pluspunkte sammeln kann."
Florian Felix Weyh denkt Kunst und Wirtschaft, Geist und Macht nicht mehr in den schablonenhaft antrainierten Voreingenommenheiten. So endet der Band auch mit einem Kapitel über den Mäzen, eine konkrete Wunsch-Utopie jedes freien Autors, der Uneigennützigkeit und Geschäftssinn zu vereinen weiß. Und so entlässt uns Weyh mit einem merkwürdigen Schlusssatz über eben diesen Mäzen:
"Auf diese Weise verdanken ihm viele Menschen viel mehr, als sie ihm je entgelten können."
So lange eine Gesellschaft solche Menschen hervorbringt, funktioniert sie. Das gilt über den Mäzen hinaus für jegliche Art von Vermögen, das jemand einbringt. Das und vieles mehr können wir aus der Lektüre dieses sehr empfehlenswerten Buches lernen.
Florian Felix Weyh: Vermögen. Was wir haben, was wir können, was wir sind
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2006.
Der 1963 geborene Schriftsteller und Journalist Weyh will mehr als Kreativitätstraining für Wirtschaftsmacher: Er erklärt uns die vielfältigen Reflexe des Ökonomischen im ganz Privaten. Und die privaten Möglichkeiten, auf ökonomische Zusammenhänge einzuwirken, die eben nicht nur rein wirtschaftliche sind. Dabei beginnt das Buch mit einem merkwürdigen Satz:
"Schon als Kind hielt sich Georg für vertauscht."
Ein altes und häufig variiertes Motiv, dem Autor offenbar nicht unvertraut, der es gleich in seinen Anekdotenkosmos deutend einordnet:
"Interessanterweise wird der vermutete Tausch dabei fast ausschließlich wirtschaftlich gedacht, statt an elterliche Charakterzüge geknüpft zu sein, deren Vererbung man panisch fürchtet. Nein, beim Verdacht, im falschen Milieu zu leben, geht es um Aufstiegsfantasien: um die Vorstellung, ein besseres Leben an anderen Orten zu versäumen. Der Blick richtet sich – mal neidvoll, mal resigniert – auf entgangene Möglichkeiten."
Der Autor geht weder neidvoll und gar nicht resigniert an ein Thema heran, das er in einer Mischung aus Feuilleton und fastwissenschaftlicher Studie umkreist. Der Hörer des "Politischen Feuilletons" in diesem Sender kennt diesen Stil von Florian Felix Weyh, den man zu den interessantesten Publizisten dieser Republik zählen darf.
Und der der Spannung zwischen dem abrechenbar Geschaffenen und unserem Vermögen, etwas zu schaffen sogar Lesevergnügen beim Leser herauskitzelt. Er umkreist immer wieder drei zentrale Kategorien "das Haben, das Können, das Sein".
Merkwürdige und allzu logische Fälle saugt die Beispielmaschine des Herrn Weyh auf und sortiert sie in sein immerhin 319 Seiten starkes Buch ein. Der Autor empfiehlt sich sozusagen selbst als Beispiel wie einer ohne großes "Haben", bei einem aus Wissen und Schreibfähigkeit gemixten "Können" zu einem würdigen Resultat in Form eines steinschweren Buches kommt. Was dieses "Sein" zu einem dauerhaften geraten lässt, entscheiden Käufer und Leser. Der Autor befasst sich mit dem eBay-Effekt für die Wertbildung und den Zusammenhang zwischen Konsum und Wert.
"Verbrauch ist das Gegenteil von Vermögensbildung und fast zynisch klingt der volks-wirtschaftliche Begriff vom "Ausgabenschock", der Haushalte ereilt, sobald sie konsumieren... Seit einigen Jahren lassen sich zwei Strömungen in unserer Einkaufswelt erkennen. Die "Geiz-ist-geil" Mentalität konzentriert sich nur auf die Kosten des Einkaufs, während die eBay-Mentalität überall den Wiederverkaufswert zu entdecken sucht."
Sparsamkeit verzichtet also oft auf spätere Wertbildung oder wenigstens Wertbeständigkeit. Kurzfristiges Erfolgsdenken führt oft nicht zu Erfolgen und man muss nicht nur bei diesem Beispiel an die Kurzatmigkeit mancher politischen Entscheidungen denken, die manisch auf den raschen Erfolg fixiert sind.
Der Vergleich mit der Politik stellt sich oft ein, gerade weil ihn der Autor nicht zwanghaft herbei schreibt. Er springt geschickt zwischen der Makro- und Mikroperspektive der Ökonomie, klärt auf und relativiert das soeben Aufgeklärte im spannungsreichen Wechsel. Ein simpler Ratgeber ist "Vermögen" nicht.
"Beim Tausch bekomme ich Geld, weil ich etwas mache (produziere, handle, arbeite); beim Transfer weil ich etwas bin (Kind, Beamter, Erbe). Ergo müssen beim Tausch Dinge einen Wert haben…während beim Transfer Beziehungen stabil und verlässlich sein sollten."
Bürokratien leben eher vom Transfer, jeder Tausch führt zu Aktivitäten. Ergo, um einmal das Buch zu verlassen, sollte jegliche Arbeitsmarktpolitik möglichst viele Möglichkeiten für Arbeitslose schaffen, ihre Fähigkeiten im Tausch gegen lang- oder kurzfristige Arbeitsverhältnisse einzubringen (auch mit Druck), statt ewig und endlos über die Kontrollmechanismen der Versorgungstransfers zu debattieren.
So gerät dieses Buch zu einem Plädoyer für den Markt; über seine positiven Möglichkeiten, Differenzen, Entfaltungsvarianten und auch seine Erotik, einschließlich der des Scheiterns.
Der Leser geht mit dem Autor auf Erkundungstour. So schildert er den Fall des 1964 verstorbenen Malers Conga, dessen drei Werke bei einer Auktion postum einen heutigen Wert von 21.000 Euro erzielten. Der stolze Besitzer hätte auch mehr gezahlt, ihn faszinierten die Werke, die kurz zuvor von anderen als zu entsorgende Leinwand klassifiziert worden wären, wertlos geworden durch das Beschmieren mit Farbe. Denn Conga war ein Affe.
"Fantasie und Kalkül – das sind die wesentlichen Triebkräfte eines Marktes ohne Transparenz und Vergleichbarkeit der Ware …vor allem aber ohne vernünftiges Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage…..Die Zahl nicht wach geküsster Werke in den Ateliers hoffnungsfroher Nachwuchskünstler und gescheiterter Veteranen dürfte in die Millionen gehen."
Dem Autor macht das Spiel mit den Exkursen des Zufalls Spaß, das Vermögen, was der Leser daraus zieht, liegt in einem sehr nützlichen Denk- und Wahrnehmungstraining. Und in vielen mehr oder weniger amüsanten Details, die auch ins Handbuch des unnützen Wissens passten. Aber wer weiß denn ganz sicher, was nützlich ist?
Weyh schlendert durch viele Bereiche: Wissen, Bedürfnislosigkeit, Zeit als Reichtum und Last, Zins und Schuld, Urheberrechte, eine Kapitelüberschrift lautet "Familienbande, Netzwerke und andere Geselligkeiten". Das dritte Kapitel über Grund und Boden gerät etwas handfester. Und an manchen Stellen, ob beim Glauben oder dem Meditieren über Freundschaften, spürt man den Hintergrund einer Generation Praktikum, die statt fester Arbeitsplätze das nötige Flexibilitätstraining für den freien Markt bekommt.
Und eine Portion Trost dazu: Vieles ist offen in der offenen Gesellschaft. Über die Deformationen aller Begrifflichkeiten unter diktatorischen Bedingungen reflektiert der Autor nicht. So kommen im Personenregister zwar Helmut Markwort und Christoph Schliengensief vor, nicht aber Karl Marx, der mit dem wohlbekannten "Kapital" ein noch voluminöseres Werk deutscher Sprache verfasste.
So wie Karl Marx seine ökonomischen Erkenntnisse teilweise ideologisiert, so misstraut Weyh solchen Einengungsversuchen. Ein Schimpfen auf den "Neo-Liberalismus" oder die Fata Morgana einer alles verschlingenden globalen Marktwirtschaft findet nicht statt. Er legt sich eher unverkrampft und nebenher auch mit jenen an, die den Begriff "Humankapital" einmal zum "Unwort des Jahres" wählten. Weyh zitiert da den Bochumer Statistikprofessor Walter Krämer:
"Ein Jammer, dass man durch das Eingeständnis, von Mathematik und Wirtschaft wenig zu verstehen, hierzulande auch noch soziale Pluspunkte sammeln kann."
Florian Felix Weyh denkt Kunst und Wirtschaft, Geist und Macht nicht mehr in den schablonenhaft antrainierten Voreingenommenheiten. So endet der Band auch mit einem Kapitel über den Mäzen, eine konkrete Wunsch-Utopie jedes freien Autors, der Uneigennützigkeit und Geschäftssinn zu vereinen weiß. Und so entlässt uns Weyh mit einem merkwürdigen Schlusssatz über eben diesen Mäzen:
"Auf diese Weise verdanken ihm viele Menschen viel mehr, als sie ihm je entgelten können."
So lange eine Gesellschaft solche Menschen hervorbringt, funktioniert sie. Das gilt über den Mäzen hinaus für jegliche Art von Vermögen, das jemand einbringt. Das und vieles mehr können wir aus der Lektüre dieses sehr empfehlenswerten Buches lernen.
Florian Felix Weyh: Vermögen. Was wir haben, was wir können, was wir sind
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2006.
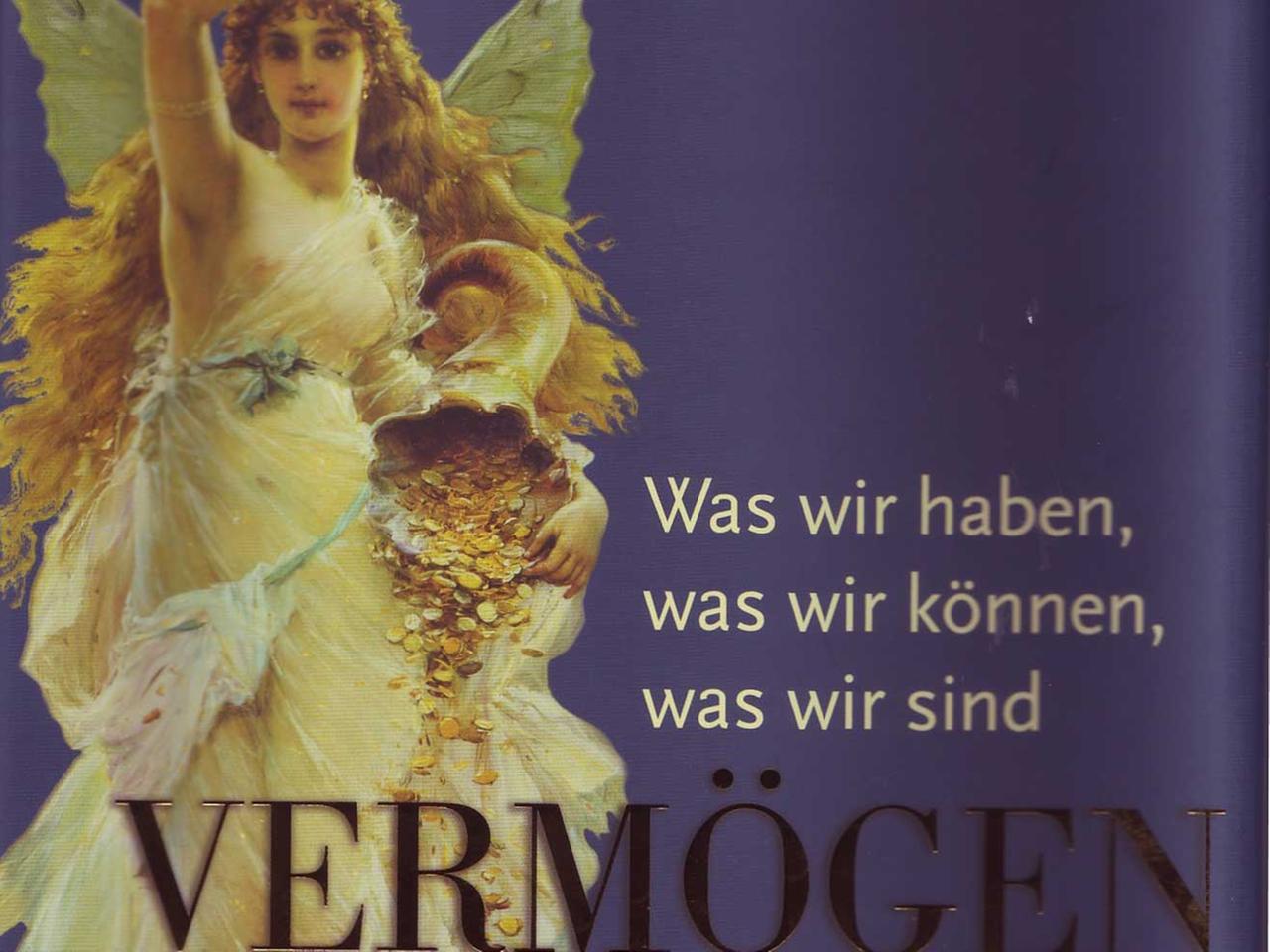
Coverausschnitt: Vermögen. Was wir haben, was wir können, was wir sind.© Eichborn Verlag