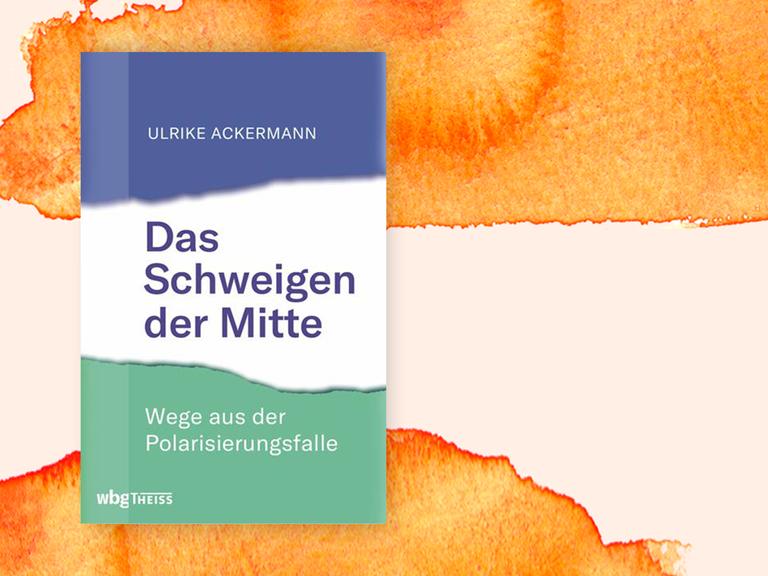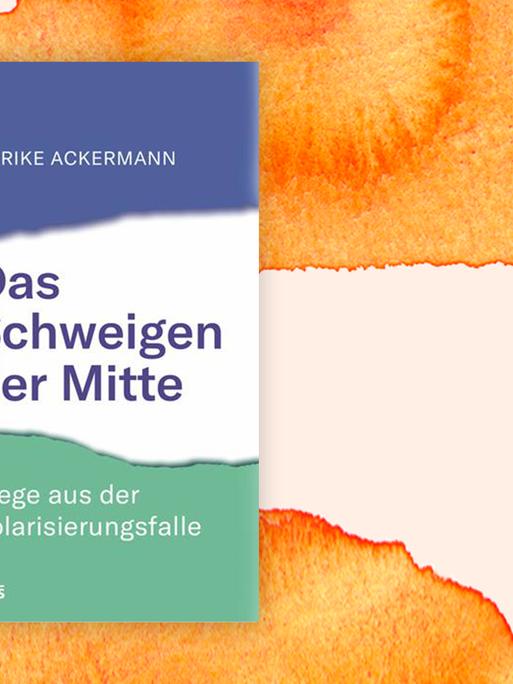Ulrike Ackermann: "Die neue Schweigespirale. Wie die Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit einschränkt"
wbg Theiss, Darmstadt 2022
176 Seiten, 22 Euro
Ulrike Ackermann: "Die neue Schweigespirale"

Identitätspolitik sei zur Ideologie geworden, sagt die Politologin Ulrike Ackermann. © Privat
Identitätspolitik auf Abwegen
12:54 Minuten

Die Politologin Ulrike Ackermann befasst sich in ihrem neuen Buch mit Cancel Culture. Öffentliche Diskussionen werden von einem hohen Konformitätsdruck bestimmt, lautet ihr Befund.
1980 prägte die Mainzer Meinungs- und Kommunikationsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann den Begriff der "Schweigespirale". Dieser besagt, dass vorherrschende Meinungen auch dadurch, dass ihre Vertreter sie offensiv nach Außen tragen, vermeintliche Minderheitenmeinungen zum Schweigen bringen: Deren Vertreter ziehen sich nach und nach aus dem öffentlichen Gespräch zurück. Die Theorie dahinter ist in der Wissenschaft nicht unumstritten.
Ulrike Ackermann greift den Begriff nun mit ihrem Buch "Die neue Schweigespirale" wieder auf. Noelle-Neumann habe damals "eine sehr kluge Dynamik beschrieben", sagt die Politologin. Seitdem habe sich die Lage sogar noch verschärft, findet die Gründerin des John Stuart Mills Instituts für Freiheitsforschung und erklärt dies mit der Digitalisierung und dem Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Ackermann sieht einen starken Konformitätsdruck, "lieber zu schweigen und zu gefallen, um opportun zu sein, als aufzufallen und damit dann etwa an den Rand gedrängt oder gar geächtet zu werden. Dieses Problem sehen wir ja nun ganz krass in der sogenannten Cancel Culture und diesen Kulturkämpfen, wenn eine Meinung, die, die nicht geteilt wird, so attackiert wird, dass die Leute unter Druck geraten und sich dafür entschuldigen und schweigen."
Keine Streitschrift
Als Streitschrift versteht sie ihr Buch allerdings nicht. Das Buch gehe auf ein "dreijähriges Forschungsprojekt über die Politisierung der Wissenschaft, vor allem der Sozialwissenschaften, der Kultur- und Geisteswissenschaften" zurück:
"Was passiert an den Hochschulen? Was passiert in gesellschaftlichen Debatten? Welche neuen Ideen setzen sich durch? Wer transportiert diese Ideen? Sind es Ideologien? Sind es Ideen? Wie knüpfen sie an an andere Ideen, an andere Denktraditionen, die länger zurückliegen? Und warum gewinnen sie solchen Einfluss? Und welche praktischen Folgen haben Sie?"
Auch interessiert sie die Fragen: "Was ist diese Cancel Culture? Wodurch ist sie angetrieben? Was sind die Gründe? Und welche Folgen hat das gesellschaftlich?"
Identitätspolitik und Emanzipation
Viele Kontroversen der Gegenwart drehen sich um Fragen der Identitätspolitik, die ursprünglich als "emanzipatorische Bewegung diskriminierter sozialer Gruppen" gedacht war. Ihr Ursprung liege in den USA der 80er-Jahre mit der sogenannten affirmative action, bei der "ganz gezielt und bewusst gesellschaftliche Minderheiten in den Blick genommen worden sind. Gerade an den Hochschulen wurde viel Geld dafür lockergemacht, damit diese Minderheiten sich selbst beforschen, damit sie sichtbar werden", sagt Ackermann.
"Dieser Grundimpuls, sich zu emanzipieren und Gerechtigkeitslücken aufzuzeigen, ist eigentlich sehr klug und gut gewesen", fügt sie an. "Aber im Verlauf der Jahrzehnte hat sich daraus eine Identitätspolitik entwickelt, die sich weniger an die gesamte Gesellschaft richtet, sondern die Gruppen-Partikularitäten festzurrt und Opferkollektive stark macht, die sich als Opfer gegenüber der weißen, vornehmlich männlichen Tätergesellschaft sehen."
Ideologie mit Spaltungstendenz
In ihrem Buch wollte sie daher der Frage nachgehen, wie aus einem Ansatz der Emanzipation "etwas Ideologisches, das sehr große, spalterische Tendenzen hat", entstanden sei.
Solches Spaltungspotenzial sieht sie dann, "wenn Gruppen an der Hochschule der Meinung sind, dass weiße Männer überhaupt nichts mehr zu sagen haben", und wenn diese Gruppen die Curricula und den wissenschaftlichen Kanon komplett verändern wollten und dabei "davon ausgehen, dass die Gesellschaft und damit auch die Universität strukturell und systemisch rassistisch ist". Das öffne keinen Debattenraum, sondern werde ideologisch.
Zwar findet Ackermann es richtig, auf Lücken in der Geschichtsschreibung aufmerksam zu machen und solche Projekte zu Beginn auch zu fördern. Problematisch findet sie es aber, "wenn die bisher praktizierte Wissenschaft generell als Lüge, Unwahrheit und ein Machtinstrument der weißen Mehrheit dargestellt wird".
Gefahr von Meinungsblasen
Sie sieht sich als Verteidigerin universaler Rechte, insbesondere des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Ihrer Ansicht nach herrsche an Hochschulen und im öffentlichen Raum eine von Selbstzensur geprägte Atmosphäre des Konformitätsdrucks. Sie sieht weiterhin die Gefahr, dass Opfergruppen unter sich bleiben und sich abschotten.
Das begünstige Meinungsblasen, wie sie im Netz zu beobachten seien. Ackermann plädiert daher für den Wettbewerb der Ideen und wissenschaftlichen Pluralismus. "Die Studenten und Studentinnen müssen lernen, tatsächlich zu debattieren. Dafür ist ja auch kaum Raum nach der Bologna-Reform und mit der mit Rücknahme der Präsenzuniversität in vielen Bereichen."