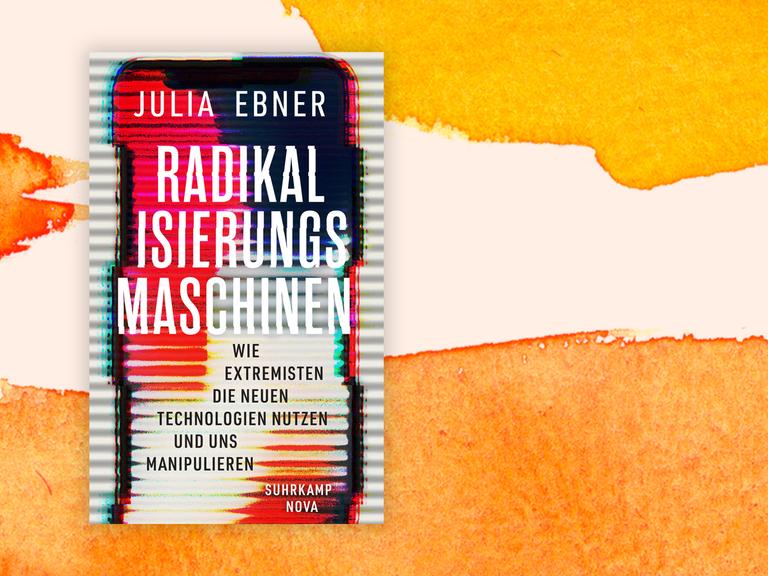Jens Balzer, geboren 1969, arbeitet als Autor und Kolumnist unter anderem für die "Zeit", Deutschlandfunk, "Rolling Stone" und radioeins. Neben seiner journalistischen Tätigkeit betreut er den Popsalon am Deutschen Theater und lehrt Popkritik an der Berliner Universität der Künste. Er hat als Kurator unter anderem an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz gearbeitet und ist künstlerischer Berater des Donaufestivals Krems. Zuletzt erschien sein Buch "Pop. Ein Panorama der Gegenwart" (2016).
Hassen? Ja, aber das Richtige!
04:05 Minuten

Kaum eine Emotion hat einen so schlechten Ruf wie der Hass. Und das zu Recht, findet der Journalist Jens Balzer. Trotzdem plädiert er dafür, ihn auch als politische Ressource zu begreifen, die man nicht allein den Feinden der Demokratie überlassen soll.
Hass, überall Hass. Er ist allgegenwärtig. In den Medien; in den sozialen Netzwerken; in den verzerrten Fratzen der Wutbürger; im Gehirn des Mannes, der in Halle eine Synagoge zu stürmen versuchte und nach dem Scheitern dieses Versuchs zwei Menschen erschoss.
Der Hass zerstört unsere Gesellschaft, es muss etwas gegen ihn getan werden, darin scheinen sich gerade alle einig zu sein – oder doch zumindest alle diejenigen, die guten Willens sind und die sich wünschen, dass eine Gesellschaft nicht dem Gesetz des Stärkeren, Lauteren, Hasserfüllteren folgt, sondern den zivilen Regeln des Austauschs der Meinungen, der Debatte, des Ausgleichs unterschiedlicher Interessen.
Doktorn wir nur an Symptomen herum?
Die Bundesregierung hat gerade ein Maßnahmenpaket beschlossen, das unter anderem zur besseren Bekämpfung der Hassrede im Internet dient. Das ist eine gute Nachricht für alle diejenigen, die mit dieser Hassrede täglich konfrontiert sind, deren Leben und Sicherheitsgefühl sie vergiftet. Dennoch bleibt die Frage: Ist es damit getan? Oder doktern wir damit nicht nur an Symptomen herum – an Symptomen einer gesellschaftlichen Verhärtung, die tiefer reicht und grundlegender ist als das oberflächliche Flackern der Beleidigungen und Obszönitäten?
Die Namen dieser Verhärtung sind: Rassismus, Nationalismus, Suprematismus. Also: Die ideologisch verfestigte Überzeugung, dass es Menschen gibt, die über anderen Menschen stehen; die mehr wert sind als diese und denen darum mehr zusteht; und wenn diese Menschen nicht das erhalten, was ihnen vermeintlich zusteht, dann fühlen sie sich dazu ermächtigt, diesen Anspruch mit Gewalt zu bekunden.
Schuld am Rassismus ist der Rassist
Auf der liberalen Seite der Gesellschaft hat sich das Gefühl durchgesetzt, dass man solchen Menschen vor allem mit Verständnis, Einfühlung und Zuhören begegnen sollte, und das heißt: mit dem Versuch, den Hass einzudämmen und zu therapieren. Denn – so das dahinter stehende schlechte Gewissen – ist die liberale Gesellschaft nicht vielleicht selber schuld daran, wenn viele Menschen sich von ihr abwenden? Die Antwort darauf ist ganz einfach: Nein, ist sie nicht. Schuld am Rassismus ist nicht die liberale Gesellschaft. Schuld am Rassismus ist der Rassist. Und was spricht dagegen, solche Rassisten zu hassen?
Der Feuilletonist Felix Stephan hat kürzlich in der "Süddeutschen Zeitung" ein entschiedenes Plädoyer dafür gehalten, den Hass als Ressource der politischen Leidenschaft nicht den Rechten zu überlassen – sondern sich daran zu erinnern, dass ohne den Hass auf die Aristokratie niemals jene Freiheiten der Demokratie erstritten worden wären, die wir heute wieder verteidigen müssen. Und der Germanist Karl Heinz Bohrer hat soeben ein fulminantes Buch über den "literarischen Hass-Effekt" herausgebracht, es heißt "Mit Dolchen sprechen" und erinnert daran, wie große Hass-Reden von Shakespeare bis Kleist, von Thomas Bernhard bis Rainald Goetz den Blick auf die Welt zu verändern vermochten – weil sie nicht zuletzt den Glauben daran zu erschüttern verstanden, dass die Autoritäten, denen wir uns gerade noch unterwerfen, nicht bis in alle Ewigkeit herrschen.
Der Feuilletonist Felix Stephan hat kürzlich in der "Süddeutschen Zeitung" ein entschiedenes Plädoyer dafür gehalten, den Hass als Ressource der politischen Leidenschaft nicht den Rechten zu überlassen – sondern sich daran zu erinnern, dass ohne den Hass auf die Aristokratie niemals jene Freiheiten der Demokratie erstritten worden wären, die wir heute wieder verteidigen müssen. Und der Germanist Karl Heinz Bohrer hat soeben ein fulminantes Buch über den "literarischen Hass-Effekt" herausgebracht, es heißt "Mit Dolchen sprechen" und erinnert daran, wie große Hass-Reden von Shakespeare bis Kleist, von Thomas Bernhard bis Rainald Goetz den Blick auf die Welt zu verändern vermochten – weil sie nicht zuletzt den Glauben daran zu erschüttern verstanden, dass die Autoritäten, denen wir uns gerade noch unterwerfen, nicht bis in alle Ewigkeit herrschen.
Wir müssen wieder hassen lernen
Der Hass, um den es hier geht, ist kein Affekt, kein bloßes Feindschaftsgefühl und kein Zerstörungswunsch. Es drückt sich in ihm eine kompromisslose Entschiedenheit aus – zur Verteidigung des Individuums und der Freiheit gegen die Tradition und den Zwang.
Die Neue Rechte will die freiheitliche Demokratie durch einen autoritären Staat ersetzen, das haben ihre Vertreter hinreichend deutlich gemacht, und das kann man überall dort, wo sie bereits an der Macht sind, überzeugend studieren. Gegen dieses Vorhaben hilft nur leidenschaftliche Gegenwehr, und wer glaubt, dabei im Register der Leidenschaften auf den Hass verzichten zu können, der irrt.
Wir müssen wieder hassen lernen – und zwar richtig. Und das heißt: nicht jene Menschen, die vermeintlich weniger wert sind als wir – sondern jene, die bestimmen wollen, wer mehr und wer weniger wert ist; die glauben, uns sagen zu dürfen, wie wir leben sollen, wen wir lieben, mit wem wir zusammenleben dürfen. Wer glaubt, dass Hass generell von gestern ist, der glaubt auch an die Unumkehrbarkeit der Geschichte und der demokratischen Zivilisierung. Dass dieser Glaube ein Irrglaube ist, wenigstens diese Einsicht sollte sich inzwischen durchgesetzt haben.