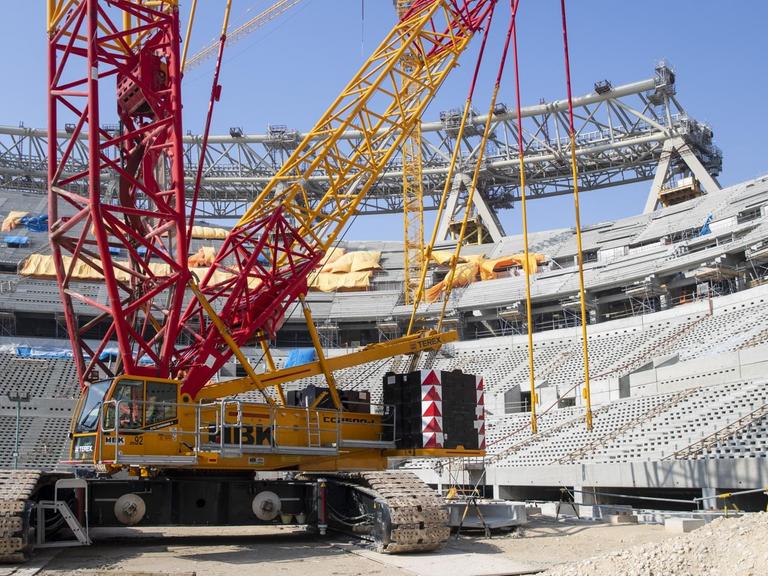Fußball als Machtinstrument in Kriegsgebieten
24:00 Minuten

Im Nahen und Mittleren Osten ist Fußball umkämpft: Diktatoren bringen Spieler brutal auf Linie, für Terroristen gelten Spiele als Anschlagziele. Andererseits stiften im Irak oder in Afghanistan die Nationalteams eine gemeinsame Identität.
Das Stadion von Homs im November 2006. Der syrische Staatspräsident Baschar al-Assad betritt die Ehrentribüne. Mehr als 30.000 Zuschauer erheben sich von ihren Sitzen. Klatschen und singen patriotische Lieder. Assad lächelt, winkt in die Menge. Er wirkt wie ein zufriedener Staatsmann. In Homs findet das Finalrückspiel der asiatischen Champions-League statt. Millionen Syrer hoffen auf einen Sieg von Al-Karama. Dieser Vereinsname lässt sich unterschiedlich übersetzen: die Würde, die Ehre, die Wundertat. Assad besucht selten Fußballspiele, doch dieses Mal ist er dabei.
"Der Fußball war wichtig für ihn. Nicht weil er Fußballfan ist, nein, weil er dadurch eine andere Zielgruppe erreicht hat", sagt der Fußballfan Nadim. Er wuchs in Syrien auf, seit 2015 lebt er in Deutschland.
"Der war auf jeden Fall auch auf dem Platz dabei. Er hat alle Spieler begrüßt, hat sogar die Spieler der Gegner begrüßt. Der wollte sich als der Präsident des Volkes präsentieren. Das ist der Sport des Volkes. Da wollte er auf jeden Fall sein Publikum erreichen."
Waffenlager im Stadion
Al-Karama schießt im Rückspiel zwei Tore. Auch Assad springt auf und jubelt, doch es reicht nicht für den Titel. Anders drei Jahre später. Al-Ittihad aus Aleppo gewinnt 2010 den Asien-Pokal, vergleichbar mit der Europa-League. Der erste internationale Titel für einen syrischen Klub. Nadim sagt: "Al-Assad hat die ganze Mannschaft in Damaskus am Flughafen in Empfang genommen. Er hat die dann in seinen Palast eingeladen. Dann gab es eine Trikotübergabe von dem Präsidenten des Vereins. Mit der Rückennummer 1. Al-Assad stand auf der Rückseite. Das ist eine typische Propaganda, die man eigentlich auch aus anderen Ländern kennt."
Nadim ist mit Mitte 20 ein gefragter Experte für Fußball und Politik in Syrien, vor allem für die dortigen Fanszenen. Er hält Vorträge, gibt Interviews, spricht über seine Biografie. Seinen vollständigen Namen möchte er lieber nicht in der Öffentlichkeit nennen.
Der Fußballfan verbringt seine Jugend in der Hafenstadt Latakia. Die Freizeit widmet er seinem Lieblingsklub Hutteen. Stolz trägt er die Vereinsfarben Blau und Weiß. Er gehört zur jungen, aufstrebenden Ultra-Bewegung. Bald arbeitet er erfolgreich als Sportfotograf.

Fußball gibt Hoffnung: Ein Junge spielt trotz Prothese in den Straßen von Aleppo. © imago images / ZUMA Press
Doch dann ab 2011: der Bürgerkrieg. Wie viele Freunde bricht Nadim nach Europa auf. 19 Tage dauert seine Flucht über die Balkanroute. Seit 2015 lebt er im Südwesten Deutschlands. Er kommuniziert weiter mit Freunden in Syrien, beobachtet die Medien, dokumentiert den Fußball im Kriegsgebiet. Mit einem besonderen Blick auf die Stadien, vor allem in seiner Heimatstadt Latakia. Er sammelt Artikel, Videos, Dokumentationen.
"Das Stadion wurde nicht mehr als Fußballplatz verwendet, sondern als Flüchtlingslager", sagt Nadim. "Die ganzen Vertriebenen aus Aleppo sind nach Latakia gezogen und haben sich dann im Stadion aufgehalten. Das Stadion in Idlib war mitten in der Stadt. Und die Landschaft um Idlib herum, wo die ganzen Tiere gehalten worden sind. Man hat sich gedacht: Okay, wir holen die Tiere aus der Landschaft und halten sie in der Stadt. Das war im Stadion. Da ist eine grüne Wiese. Da kann man auf jeden Fall einen Blick auf die Tiere haben. Das Stadion in Damaskus, genauer gesagt das Abbasiden-Stadion mit einer Kapazität von 40.000 Zuschauern, wurde wegen der zentralen Lage als Hubschrauberlandeplatz verwendet, aber auch als Waffenlager. Da wurden auch Raketen gelagert."
Terrorgruppen rekrutieren im Fußball
Der Sport als Machtinstrument in Kriegsgebieten – ein Thema mit trauriger Tradition. Ob al-Qaida, die Taliban oder der sogenannte Islamische Staat: Terrororganisationen nutzen den Fußball seit Jahrzehnten zur Vernetzung und Mobilisierung. Bereits der junge Osama bin Laden organisiert in den 1980er Jahren Fußballspiele. Später predigt er im Umfeld von Turnieren und veranstaltet für Kämpfer eine Freizeitliga.
Jahre später, 2014, rufen Fundamentalisten im irakischen Mossul das Kalifat des IS aus, umrahmt von einem Koranzitierwettbewerb und einem Fußballspiel. Der österreichische Journalist Clemens Zavarsky hat mehrfach im Nahen Osten recherchiert:
"Ein relativ hochrangiger IS-Führer, den sie dann gefangen haben, hat das dem Wall Street Journal mal erklärt. Sie konnten ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr in die Moscheen, da wurden sie beobachtet. Deswegen ging er zum Beispiel auf Fußballplätze, in Parks, et cetera. Die spielen an jeder Straßenecke Fußball, sobald es die Temperatur zulässt. Das war dann relativ einfach, dass man da Menschen rekrutiert."
Der IS will mit Gewalt seine Auslegung des Islam durchsetzen. Seine Kämpfer töten Zehntausende Menschen, zerstören Jahrhunderte alte Kulturstätten. 2016 verbreitet sich ein Video aus Rakka, der damaligen IS-Hauptstadt in Syrien. Vor laufender Kamera werden Männer mit verbundenen Augen hingerichtet. Sie hatten für einen beliebten Fußballklub gespielt. Für einige IS-Führer ist Fußball ein Symbol des "gottlosen" Westens. Doch sie müssen auch Rücksicht nehmen, sagt Zavarsky:

Der Krieg konnte den Fußball nicht töten: Irakische Fans freuen sich über den Erfolg ihrer Mannschaft beim Asiencup 2007.© imago / Xinhua
"Eine Dämonisierung des Westens war mit dem Fußball schwer möglich. Weil viele der Kämpfer auch aus dem Westen kamen und die Annehmlichkeit des Fußballschauens kannten. Bei Osama bin Laden in Afghanistan war es zum Beispiel so, dass der Fußball nur unter gewissen Regeln hat stattfinden können. Sie haben keine Haut zeigen dürfen, nur lange Hosen und lange Ärmel. Beim IS war es dann auch so, dass Jubeln verboten war, das hatte angeblich einen homosexuellen Touch. Der Schiedsrichter durfte nicht in die Trillerpfeife pfeifen, weil man dann Dämonen anlockt. Es waren wirre Regeln, die sie da aufgestellt haben. Mit dem Wissen, dass sie es nicht ganz verbieten können. Aber sie haben so viel Druck auferlegt, dass es halt irgendwie auch keinen Spaß gemacht hat."
Bomben explodieren während der Jubelfeier
Ein Land, das seit Jahrzehnten unter Krieg und Terror leidet, ist der Irak. Unter Diktator Saddam Hussein und seinem Militär bleiben die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen Kurden und Islamisten noch unter der Oberfläche. Auch im Sport, wo sein Sohn Udai Hussein ein strenges Regime führt. Nach großen Siegen beschenkt er Spieler mit Häusern. Nach Niederlagen lässt er sie mitunter verhaften und foltern.
Nach dem Sturz von Saddam Hussein versinkt der Irak noch tiefer im Chaos. Terroranschläge, Entführungen, Verletzungen durch Landminen. Der Fußballverband bezieht Büros in Jordanien. Nationalspieler, die ihre Heimat nicht verlassen wollen, tragen Waffen und Schutzwesten. In dieser Zeit vermittelt der Fußball Hoffnung. Bei der Asienmeisterschaft 2007 spielt das irakische Team überraschend gut. Auch wegen ihres brasilianischen Trainers Jorvan Vieira, erläutert Reporter Zavarsky:
"Die drei besten Spieler waren ein Sunnit, ein Schiit und ein Kurde. Die hat er alle in führende Rollen gebracht. Damit war dieses Religionsthema befriedet. Er hat auch von den Spielern verlangt, dass sie vor dem Spiel nicht beten, alles in Abstimmung mit dem Verband. Weil die Religion noch immer ein zersetzendes Element ist. Sie sind dann überraschend recht weit gekommen."

Erfolgreiches Team: 2007 gewann die irakische Fußballnationalmannschaft überraschend die Asienmeisterschaft.© imago / Xinhua
Im Halbfinale schlägt der Irak den Favoriten Südkorea im Elfmeterschießen. In Bagdad strömen Zehntausende auf die Straßen. Autokorso und Jubel sind auch Amateuraufnahmen zu sehen. Dann der Schock: Zwei Selbstmordattentäter töten mehr als 50 Menschen, mindestens 150 werden verletzt.
Zavarsky erinnert: "Das irakische Nationalteam hat damals gesagt: Sie wollen aus Respekt vor den Toten das Finale nicht spielen. Es haben sich dann sehr viele Eltern von toten Kindern gemeldet. Oder Verwandte, die dann gesagt haben: Wir haben uns so gefreut, dass Ihr das Spiel gewonnen habt. Bitte spielt das Finale; sozusagen zu Ehren der Toten. Der Irak hat das Finale dann gespielt und hat es bekanntlich überraschenderweise auch gewonnen. Das hat eine kurzfristige Euphorie entstehen lassen."
Assad kann mit Fußball Investoren locken
Auf einen solchen Hoffnungsschimmer warten auch viele Menschen in Syrien. Der Bürgerkrieg dort kostet bis heute mehr als 500.000 Menschen das Leben, mehr als elf Millionen sind auf der Flucht. Trotzdem wird der Fußballligabetrieb seit 2011 zumindest in reduzierter Form aufrechterhalten. Die Mannschaften spielen ihre Meister in den vermeintlich sicheren Städten Damaskus und Latakia aus. Präsident Assad will auch mit Fußball Normalität vermitteln, da ist sich der syrische Fan Nadim sicher:
"Das wird ausgenutzt. Dass ja alles wieder gut ist: ,Und wir haben jetzt Frieden. Die Flüchtlinge können zurückkommen. Das ist einfach der Himmel hier in Syrien.‘ Zum anderen finde ich das aber doch in Ordnung, weil die Leute das Stadion als letzten Zufluchtsort haben. Für die Menschen ist das ein Stück Normalität, das erkämpft wird."
Früher hat die syrische Nationalmannschaft ihre Heimspiele in Damaskus oder Aleppo vor 40.000 Zuschauern bestritten. Seit Kriegsbeginn spielt sie im Exil, häufig Tausende Kilometer entfernt in Südostasien. Nadim verfolgt das Team in den sozialen Medien.
"Jedes Mal, wenn die Nationalmannschaft spielt, haben wir zwei Fanlager. Auch die Leute, die gegen al-Assad sind und keinen Fußballbezug haben, wollen unbedingt, dass die Nationalmannschaft verliert. Dass er nicht noch mal extra eine Bühne hat, um sich nach außen zu präsentieren."

Zurück im Stadion: Junge Menschen zieht es nach Jahren des Überlebenskampfs in Syrien wieder auf die Ränge.© Imago Images / Sopa Images / Sally Hayden
Bei den Spielen im Exil sitzen auf den Tribünen häufig Assad-Anhänger neben geflohenen Dissidenten. Manchmal tragen Spieler und Offizielle T-Shirts mit Fotos von Assad. Es sind Gesten, die das Regime in den Staatsmedien als Einigkeit bewertet, sagt die Journalistin Kristin Helberg, die mehrere Bücher über Syrien veröffentlicht hat.
"Das Regime arbeitet vor allem daran, in die internationale Gemeinschaft zurückzukehren. Man versucht, Gelder für den Wiederaufbau zu beschaffen. Deswegen nutzt man alle möglichen Ebenen, um sich als ein Land zu präsentieren, in das man wieder investieren sollte; das bereit wäre, wieder Flüchtlinge zurückzunehmen. Ein Symbol wie die Fußballnationalmannschaft ist eine dankbare Möglichkeit, um klar zu machen: ‚Wir, das syrische Regime, repräsentieren das syrische Volk. Unsere Nationalmannschaft, das sind unsere Helden.‘"
Nationalspieler werden gefoltert und getötet
In Syrien haben die Vereine des Militärs und der Polizei lange einen Systemvorteil. Der mit 17 Meistertiteln erfolgreichste Klub kommt aus Damaskus und heißt Al-Dschaisch, die Armee. Viele syrische Spitzenspieler sind im Ausland unter Vertrag. In Jordanien oder Katar können sie sich finanziell absichern. Doch auch dort stehen sie unter politischem Einfluss.
Firas Al-Khatib etwa spielt mehr als zehn Jahre in Kuwait. Einen Teil seines Gehalts schickt er für die Finanzierung von Straßen und Moscheen in seine Heimatstadt Homs. 2012, ein Jahr nach Kriegsbeginn, verkündet Al-Khatib seinen Rücktritt aus dem syrischen Nationalteam, er bekennt sich zur Opposition.
"Der hat gesagt, dass die Nationalmannschaft nicht die Syrer vertritt, sondern das Regime", erläutert der syrische Fan Nadim. "Deswegen wollte er nicht für die Nationalmannschaft spielen. Als die Nationalmannschaft dann gute Chancen hatte, die Weltmeisterschaft 2018 zu erreichen, hat er doch wieder für das Team gespielt, sogar als Kapitän."
Das Nationalteam entfacht in sozialen Medien Kontroversen. Setzt die Regierung Spieler unter Druck? Sind ihre Familien in Gefahr? Das US-amerikanische Sportportal ESPN recherchiert monatelang und veröffentlicht im Mai 2017 eine lange Reportage. Darin schreibt der Pulitzer-Preisträger Steve Fainaru:
"Die syrische Regierung hat den Sport für ihre brutale Unterdrückung benutzt. Mindestens 38 Spieler aus den ersten beiden Ligen und Dutzende weitere aus den unteren Ligen wurden erschossen und gefoltert."
Der langjährige syrische Nationaltorwart Mosab Balhous muss 2011 für mehrere Monate in Haft, weil er Rebellen Zuflucht geboten haben soll. Der Nationalspieler Jihad Qassab soll Autobomben konstruiert haben, was er bestreitet. Nach schwerer Folter stirbt Qassab 2016 in einem Militärgefängnis.
Noch heute gelten viele Spieler als vermisst. Diejenigen, die ins Ausland fliehen, werden als Verräter bezeichnet. Ihre Konten in Syrien werden eingefroren, ihr Besitz beschlagnahmt. Wenige syrische Profis können sich gegen das Regime behaupten, zum Beispiel Nationalspieler Omar Al-Soma, erzählt Nadim:
"Es gab das Gerücht, dass er für seine Rückkehr verlangt hat, dass ein Spieler, ein Ex-Kollege, aus dem Knast entlassen wird. Wir haben keine Beweise dafür, aber tatsächlich: Nach dem ersten Auftritt von Omar Al-Soma bei der Nationalmannschaft wurde ein Spieler aus dem Knast entlassen. Man hat gemerkt, dass die ganzen Spieler, die sich politisch positioniert haben, zumindest gegen al-Assad, die sind in Vergessenheit geraten. Die haben auf jeden Fall nicht mehr die Möglichkeit gehabt, als Fußballspieler eine Karriere zu starten. Die waren einfach auf einmal weg."
Stammesführer mischen sich im Nationalteam ein
Wie politisch dürfen, wie politisch sollten Leistungssportler sein? Auch Mansur Faqiryar kann darauf differenzierte Antworten geben. Er stammt aus der afghanischen Hauptstadt Kabul, wo seit Jahrzehnten ein Konflikt auf den nächsten folgt. Als Baby kommt er mit seinen Eltern 1987 nach Bremen. Als Jugendlicher entwickelt sich Faqiryar zu einem Torwart mit Zukunftsperspektive. 2007 spielt er für den FC Oberneuland in der vierten Liga.

Beäugt von Hamid Karzai und Ahmad Shah Massoud: Fußballtraining afghanischer Nachwuchskicker im Stadion in Kabul 2004.© Getty Images / Robert Nickelsberg
Um die Jahrtausendwende sehnen sich viele Afghanen nach einem Neuanfang. Sie wollen Bürgerkrieg und Terror der Taliban hinter sich lassen. Nach mehr als 15 Jahren formiert sich erstmals wieder eine Nationalmannschaft. Auch Faqiryar möchte beim Aufbau helfen. Er reist bald regelmäßig nach Kabul:
"Gerade zu Beginn, als natürlich immer gefragt wurde: Wo kommst du her? Wer sind deine Vorfahren? Ich bin in Kabul geboren, ich bin Afghane, ich lebe in Deutschland, das war meine Standardantwort", berichtet Faqiryar. "Aber, wenn es ums Spiel, um Emotionen geht, da kamen schon häufiger mal Sätze wie: ‚Ihr seid ja nicht die wahren Afghanen, Ihr seid ja vor dem Krieg geflohen.‘ In dem Augenblick hat man es vielleicht nicht so gedeutet, aber im Nachhinein muss man sagen: Ganz klar, jeder hat versucht, sich zu positionieren."
In Afghanistan werden 50 Sprachen und mehr als 200 Dialekte gesprochen. Die größten ethnischen Gruppen sind die Paschtunen, Tadschiken, Hazara und Usbeken. Auch in der Umkleidekabine des Nationalteams müssen mehrere Dolmetscher übersetzen. Es kommt zu Streit, manchmal zu Handgemengen.
"Wir sind in Afghanistan eine Stammgesellschaft", sagt Faqiryar. "In der Regel ist es so, dass diese Stämme auch ihre Leute dann in vorderster Reihe sehen wollen. Das ist in der Politik so. Letztlich ist Fußball, auch wenn wir es nicht hören wollen, überall Politik."
Spieler in gepanzerten Wagen
Selten sind die Volksgruppen mit dem Nationalteam gleichermaßen zufrieden. Doch es gibt Ausnahmen wie die Südasienmeisterschaft 2013. Im Halbfinale schlägt die afghanische Auswahl den Gastgeber Nepal. Der überragende Torhüter Faqiryar und seine Mitspieler erhalten im Hotel anschließend Ausgehverbot. Wenige Tage zuvor waren nepalesische Arbeiter in Afghanistan von den Taliban enthauptet worden, nun fürchtet die Mannschaft Racheaktionen.
Knapp zehn Millionen Afghanen verfolgten dann das Finale der Südasienmeisterschaft im Fernsehen. In der nepalesischen Hauptstadt Katmandu besiegt ihr Nationalteam Indien – eine Sensation. Faqiryar wird zum besten Spieler des Turniers gewählt, unter seinem Trikot trägt er ein T-Shirt mit dem Schriftzug: "Peace for Afghanistan". Plötzlich ist Faqiryar der Volksheld eines Landes, in dem er nie gelebt hat.
In Kabul feiern Hunderttausende die Rückkehr ihrer Mannschaft. Die größte Feier soll im Ghazi-Stadion stattfinden, im Nationalstadion Afghanistans. Die Taliban hatten das Stadion einst für Folter und Hinrichtungen genutzt. Sie ließen abgeschnittene Arme und Beine von der Torlatte baumeln, verbrannten Bücher und Filme von "Ungläubigen".
Mansur Faqiryar freut sich, dass die Afghanen nun mit ihrem Nationalstadion etwas Positives verbinden können. Doch Freude kann in Afghanistan schnell in Angst umschlagen. Polizisten wenden sich während der Feier an Faqiryar.
"Irgendwann hieß es: ‚Wir können keine Sicherheit von irgendjemandem gewährleisten. Seht zu, dass die Mannschaft wegkommt.‘ Am Ende war die Durchsage: ,Verlasst so schnell wie möglich das Stadion. Ihr gefährdet ja nicht nur euch, Ihr gefährdet alle Menschen hier.‘ Denn du hast keinen Überblick mehr. Keiner kann kontrolliert werden, keiner wird kontrolliert."
Vor dem Stadion patrouillieren Soldaten mit Maschinengewehren. Fußballfunktionäre halten sich einen eigenen Sicherheitsdienst. Prominente Spieler fahren in gepanzerten Wagen. Die Politiker feiern den Titelgewinn als einen afghanischen Aufbruch. Faqiryar, der die Biografie "Heimat Fußball" veröffentlicht hat, erinnert an die Worte des damaligen Staatspräsidenten Hamid Karzai:
"Diese Liebe, dieser Zusammenhalt: Was du geleistet hast, haben wir Politiker mit Milliardenausgaben über Jahre nicht geschafft."
Die Sorge vor der Mobilisierung der Ultras
Die Freude, die der Fußball in Konfliktregionen auslöst, ist selten von Dauer. Diktatoren wollen im Sport das letzte Wort haben, manchmal mit Hilfe aus dem Westen. Bei der Asienmeisterschaft 2019 wird das syrische Nationalteam von Bernd Stange betreut. Der deutsche Trainer hatte 2002 schon die irakische Mannschaft übernommen, als Saddam Hussein noch im Amt war. In einer Reportage über Stange kommt im SZ-Magazin 2019 auch der General Mowaffak Joumaa zu Wort, der wichtigste Sportfunktionär unter Baschar al-Assad.
"Die politische Aussage war uns wichtig. Dass wir in der Lage waren, einen Deutschen zu engagieren, zeigt: Syrien gewinnt, Syrien ist wieder sicher."

Deutscher Trainer für Syrien: Bernd Stange (rechts) während des Länderspiels seiner Mannschaft gegen Palästina beim Asienpokal 2019.© Getty Images / Matthew Ashton
Die FIFA verbietet die politische Vereinnahmung des Fußballs, mehr als 20 Mal hat sie Nationalverbände suspendiert. Auch im Fall von Syrien fordern Menschenrechtler ein strengeres Vorgehen gegen die Sportfunktionäre. Bislang vergeblich.
Die Diktatoren im Nahen Osten fürchten sich vor einer Mobilisierung der Ultras, wie in Ägypten während des sogenannten Arabischen Frühlings. Damals hatten Hunderte Fans auf dem Tahir-Platz gegen Staatschef Husni Mubarak protestiert. Auch in Syrien überwacht der Geheimdienst die Fans, erzählt der in Deutschland lebende Ultra Nadim:
"Die dürfen sich nicht Ultras nennen, sondern Fanklubs, weil die ein Problem mit der Bezeichnung Ultras haben. Die hatten Angst gehabt, dass wir uns dem Vorbild Ägypten anschließen. Bitte meldet euch! Macht eine Liste, wer überhaupt in der Gruppe ist. Und keine Zaunfahnen auf Englisch, sondern nur auf Arabisch. Die wollen einfach drüber Kontrolle haben."
Nadim lebt im Südwesten Deutschlands, er studiert IT und nutzt sein Semesterticket für die Bahn, um möglichst viele Spiele in der Region zu sehen, auch wenn es zurzeit nicht möglich ist. Der Fußball in Syrien lässt ihn nicht los. Für das Onlineportal Copa90 hat Nadim an dem Film "The Secret Life Of Syrian Ultras" mitgewirkt.
Nadim hält Vorträge in Jugendeinrichtungen, will Klischees auflösen. Vor allem über die Ultras, die seit 2017 allmählich in die syrischen Stadien zurückkehren. Fußball im Kriegsland Syrien? Das ist für Nadim auch ein gutes Zeichen. Viel zu lange hat sich der Alltag nur ums Überleben gedreht.