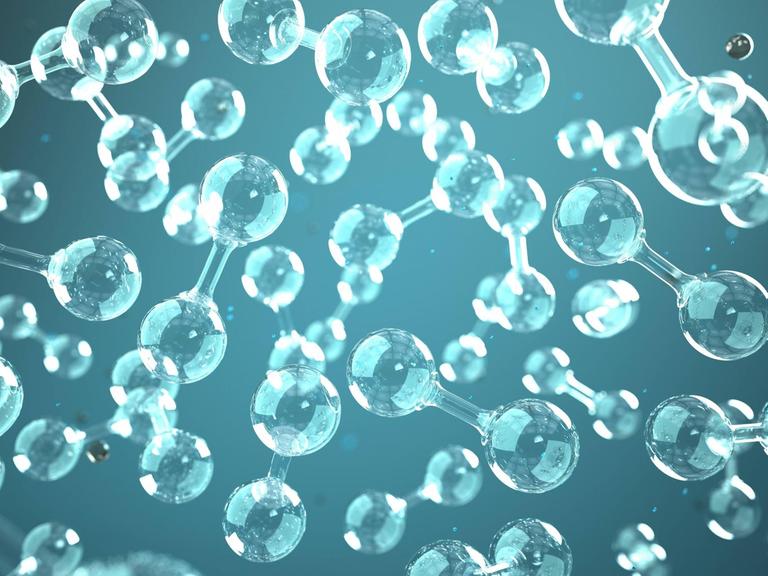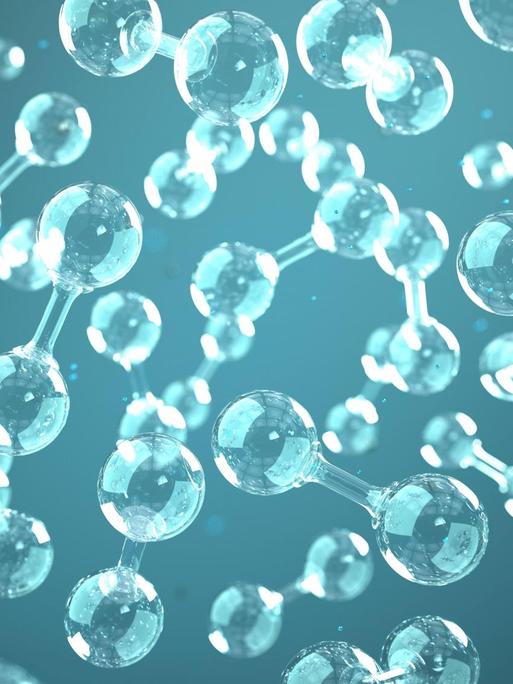Dr. Felix Christian Matthes ist Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat, den das Bundeswirtschaftsministerium im Sommer 2020 ins Leben gerufen hat, und er war Mitglied der Kommission der Bundesregierung für den Ausstieg Deutschlands aus der Kohle. 1990 begann er seine Forschungs- und Beratungstätigkeit am Öko-Institut für angewandte Ökologie und war verantwortlich für die Gründung dessen Berliner Büros. Seit 2009 ist Matthes Forschungskoordinator für Energie- und Klimapolitik. Zuvor hatte er von 1997-2008 beim Institut den Bereich Energie & Klimaschutz koordiniert. Sein Studium der Elektrotechnik absolvierte er an der Technischen Hochschule Leipzig. 1999 promovierter er an der Freien Universität Berlin zum Doktor der Politikwissenschaft.
Ist Wasserstoff das neue Erdöl?
29:30 Minuten

Den Hype um das Potenzial von Wasserstoff in der Klimapolitik müsse man relativieren, glaubt Felix Matthes vom Ökoinstitut. Aber der "Champagner" unter den Energieträgern wird, sinnvoll verwendet, eine wichtige Rolle im Energiemix der Zukunft haben.
Wasserstoff sei "ein bisschen" das neue Öl, sagt Felix Matthes. Wir werden ihn in einer Welt brauchen, in der wir ohne klimaschädliche Gase leben und arbeiten werden, glaubt der Experte für Energie und Klimaschutz. Zwar sei es ähnlich vielseitig verwendbar, aber er ist wesentlich teurer – und wird es wohl auf absehbare Zeit auch bleiben.
Strom wird die "Energie des 21. Jahrhunderts" sein
Öl war die Grundlage in der zweiten Stufe der Industrialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg und konnte damals nicht zuletzt deshalb zu einer "Massenmotorisierung" führen, weil es eben billig war. Diese Rolle des billigen Grundenergieträgers wird in der Zukunft, nach Einschätzung von Felix Matthes, der Strom übernehmen. Wasserstoff könne vor allem als Speichermedium für Strom aus erneuerbaren Energien und in der Industrieproduktion – etwa von Stahl – eine wichtige "4. Säule" der Energiewende sein. Wasserstoff-Pkws blieben dagegen "politische Folklore".
Wasserstoffproduktion muss zwingend "klimafreundlich" sein
Dass um Wasserstoff jetzt fast ein "Hype" entstehe, habe aus Sicht des Umweltökonoms damit zu tun, dass inzwischen der Anteil regenerativ erzeugten Stroms auf einen noch vor 20 Jahren kaum denkbaren Anteil am deutschen Strommix gewachsen sei. Zudem habe das Ziel der vollständigen Klimaneutralität die Verbindlichkeit der Energiewende und damit des Ausstiegs aus dem fossilen Zeitalter erhöht.
Importe im großen Stil unverzichtbar
Allerdings werde man auf absehbare Zeit auf Wasserstoffimporte angewiesen sein – Schätzungen liegen bei 70 Prozent der benötigten Mengen. Zu den sonnen- und windintensiven Ländern, aus denen man grünen Wasserstoff einführen könnte, gehören politisch stabile Nachbarländer wie etwa Spanien und Norwegen. Der Transport von Wasserstoff ist aber extrem teuer und deshalb rechnet sich die Überwindung weiter Entfernungen, etwa von Australien, momentan noch nicht. Darum werden wir in Europa bei den Wasserstoffimporten mittelfristig auch an weniger investitionssichere Länder in Nordafrika und im Mittleren Osten "gekettet" sein, sagt Felix Matthes.
(AnRi)
Das Interview im Wortlaut:
Deutschlandfunk Kultur: "Deutschland befindet sich im Wasserstoffrausch." Das kommentierte vor ungefähr zwei Wochen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ist Wasserstoff das neue Öl?
Felix Matthes: Darauf gibt es zwei Antworten: Erstens wird Wasserstoff ein neuer Energieträger sein, den wir in einer Welt brauchen, die ohne klimaschädliche Gase auskommt. Von daher ist die erste Antwort: Ja, ein bisschen.
Die zweite Antwort ist aber auch: Nein, weil natürlich das Öl ein Energieträger ist und war, der die Welt bestimmt hat, der geopolitische Grenzen verschoben hat und der ganz vieles dominiert hat. Das wird beim Wasserstoff erkennbar nicht der Weg sein.
Wenn man mal den Hype weglässt – eine wichtige Säule von Energiewende und Klimaschutz wird er sein, aber niemals die Rolle spielen, die Öl gehabt hat, auch wenn Wasserstoff natürlich eine klare internationale Komponente ist.
Deutschlandfunk Kultur: Genau, und dann natürlich auch politische Konsequenzen haben könnte – je nach dem. Aber darüber reden wir gerne später noch. Auf alle Fälle ist halt Wasserstoff ähnlich vielseitig verwendbar wie Öl: Man kann es verheizen, man kann es tanken, man kann es speichern. Man kann chemische neue Stoffe daraus entwickeln. Insofern ist er schon wie Öl.
Deutschlandfunk Kultur: Genau, und dann natürlich auch politische Konsequenzen haben könnte – je nach dem. Aber darüber reden wir gerne später noch. Auf alle Fälle ist halt Wasserstoff ähnlich vielseitig verwendbar wie Öl: Man kann es verheizen, man kann es tanken, man kann es speichern. Man kann chemische neue Stoffe daraus entwickeln. Insofern ist er schon wie Öl.
Matthes: Es ist vielseitig verwendbar, aber im Gegensatz zu Öl ist es teuer. Öl war die Grundlage in der zweiten Stufe der Industrialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg – Massenmotorisierung – weil es eben billig war. Diese Form des billigen Grundenergieträgers wird in der Zukunft wahrscheinlich der Strom einnehmen. Wir produzieren heute mit neuen Anlagen, auch Solaranlagen und Windenergieanlagen an Land und auf See, sehr billig Strom. Das heißt, der billige, weit verbreitete Energieträger wird eher Strom sein, soweit es nicht um Speicherung geht und soweit es nicht um den Input für chemische und industrielle Prozesse geht.
Von daher ist wahrscheinlich Strom die Energie des 21. Jahrhunderts. Für die Teile, die man mit Strom nicht richtig versorgen kann, wird dann unter anderem Wasserstoff eine Rolle spielen. Das heißt, die Rollen drehen sich so ein bisschen um, vielseitig verwendbar, aber teuer im Gegensatz zu Strom, in der Zukunft vergleichsweise billig, aber eben nicht ganz so vielseitig verwendbar.
"Mehr eine elektrische als eine Wasserstoffgesellschaft"
Deutschlandfunk Kultur: Das würde ich alles gerne noch ein bisschen im Detail diskutieren. Aber es ist also schon richtig, zu sagen, es ist eine Säule der Energiewende, dieser Wasserstoff. Würden Sie denn von dem, was uns da dräut in näherer oder fernerer Zukunft, von einer Wasserstoffwirtschaft reden?
Matthes: Davon würde ich nicht reden. Es ist aus meiner Sicht die vierte Säule der Energiewende. Die erste Säule ist sicherlich Energieeffizienz. Das zweite sind erneuerbare Energien, die man direkt nutzt oder zur Stromerzeugung. Die dritte große Säule ist die Elektrifizierung. Und danach kommt der Wasserstoff. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann wird es wahrscheinlich mehr eine elektrische Gesellschaft sein als eine Wasserstoffgesellschaft. Aber auch ein Anteil von 20 oder 25 Prozent Wasserstoff ist ein signifikanter Bestandteil dieses zukünftigen Systems, aber es wird nicht die durch Wasserstoff geprägte Gesellschaft sein.
Deutschlandfunk Kultur: Im Moment sind es europaweit, glaube ich, zwei Prozent. Das ist wahrhaftig noch nicht so viel. Da müsste man einiges tun. Es kann also zumindest eine Schlüsseltechnologie sein. Aber Sie haben jetzt bei dem, was es braucht für die Energiewende, eigentlich ein Stichwort ausgelassen – nämlich das Sparen.
Deutschlandfunk Kultur: Im Moment sind es europaweit, glaube ich, zwei Prozent. Das ist wahrhaftig noch nicht so viel. Da müsste man einiges tun. Es kann also zumindest eine Schlüsseltechnologie sein. Aber Sie haben jetzt bei dem, was es braucht für die Energiewende, eigentlich ein Stichwort ausgelassen – nämlich das Sparen.

Felix Matthes: "Ohne Energieeffizienz wird es sehr schwierig, weil wir den Wasserstoff im Moment noch gar nicht so ausreichend haben, und er wird eben teuer sein."© picture alliance / dpa/dpa-Zentralbild / Soeren Stache
Es gibt ja viele, die sagen, gerade im Zusammenhang mit dem Potenzial von Wasserstoff – was man alles damit machen kann, dazu gleich mehr – aber dass gerade durch dieses Potenzial sich manch einer geneigt sehen könnte zu sagen: Ach, da brauchen wir gar nicht mehr so viel Energie einsparen bei Motoren oder beim Heizen, weil wir ja jetzt Wasserstoff haben und da können wir die Energie raushauen?
Matthes: Energieeffizienz war schon die erste Säule, die ich vorhin aufgezählt habe. Ohne Energieeffizienz wird es sehr schwierig, weil wir den Wasserstoff im Moment noch gar nicht so ausreichend haben, und er wird eben teuer sein. Das heißt, man muss den Verbrauch so weit runterbringen, dass man sich einen vergleichsweisen teuren Energieträger dann wirklich auch leisten kann. Er wird niemals so billig sein, dass es aus volkswirtschaftlicher Sicht verantwortbar wäre, zu sagen: "Wir müssen jetzt keine Energie mehr einsparen oder die Energieeffizienz nicht erhöhen – wir haben doch Wasserstoff". Das wäre ein tragischer Fehlschluss und am Ende des Tages auch eine volkswirtschaftliche Falle.
Wasserstofftechnologie "mit der Brechstange" einführen?
Deutschlandfunk Kultur: Es ist so, dass es mittlerweile eine Wasserstoffstrategie oder derer mehrere gibt. Seit dem Sommer hat Deutschland eine. Auch die Europäische Union hat eine. Der nationale Wasserstoffrat in Deutschland, dem Sie auch angehören, ist gegründet worden. 24 weitere Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sitzen da drin. Es geht um die Umsetzung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung.
Im schon erwähnten Kommentar der FAZ vor zwei Wochen wurde auch davor gewarnt, diese Technologie "mit der Brechstange hochzufahren", weil das dann ähnliche Risiken bergen könnte wie seinerzeit mit der Solarenergie, dass man eine Technologie mit staatlichen Subventionen pusht, die nicht rentabel, unausgereift ist und viel Geld in Anspruch nimmt, um sie anzuschieben.
Matthes: Ich würde die Einordnung nicht so vornehmen, aber das Solarenergiebeispiel ist schon wichtig. Es ist richtig, wir haben in Deutschland viel Geld bezahlt. Aber wir haben einen maßgeblichen Beitrag dafür geleistet, dass die Fotovoltaik, die Solarenergie heute weltweit zu den sehr billigen Stromerzeugungsoptionen gehört.
Deutschlandfunk Kultur: Aber wir haben davon oftmals nichts, weil die Solarpanele beispielsweise vielleicht bei uns entwickelt wurden, aber inzwischen massenhaft in China produziert werden.
Matthes: Aber wir sehen, dass die Produktion auch wieder zurückkommt. Wir haben das mal ausgerechnet. Wir haben in den Jahren seit 2010 die Kosten für die Fotovoltaik etwa um 90 Prozent runtergekauft. Und davon haben etwa ein Drittel die Deutschen bezahlt. Sozusagen durch den Markt, den wir hier geschaffen haben, haben wir die Kosten für eine Technologie runtergekauft, die damit global kostengünstig verfügbar wurde. Das ist unser Beitrag zum weltweiten Klimaschutz. Es war ein lohnenswertes Investment. Und die Strategie, die hinter der Wasserstoffstrategie sowohl in Europa als auch in Deutschland steht, ist, genau das zu wiederholen: Einerseits die Technologieführerschaft, die wir ja heute bei der Sonnenenergie im Anlagenbau und weiterhin noch haben, beim Wasserstoff auch zu bekommen, und die Kosten für die Herstellung von grünem Wasserstoff – das heißt, aus Strom und Wasser mit der sogenannten Elektrolyse erzeugt – dass wir diese Technologie vorantreiben und dann vielleicht auch besser als bei der Fotovoltaik damals Ausrüster der Welt sind.
Da gibt es einen harten Wettbewerb. Auch hier sind die Chinesen wieder unterwegs. Da geht es um die Technologieführerschaft. Letztendlich, wenn man die Wasserstoffstrategie genau anguckt, steht dahinter die Grundidee, die damals bei der Sonnenenergie nicht formuliert worden war – das ist eher so nebenbei passiert: Die Idee, dass wir versuchen sollten, als wohlhabendes Land, als technologieorientiertes Land die Kosten und die Verfügbarkeit dieser vierten Säulentechnologie der Energiewende wirklich zu verbessern.
Nachfrage steigern mit Quoten für Wasserstoff?
Deutschlandfunk Kultur: Es gibt, wie gesagt, eine europäische Wasserstoffstrategie. Da gibt es Pläne, wie man den sehr geringen Wasserstoffanteil am Energiemix in den nächsten Jahrzehnten steigern kann. Und zu diesen Plänen gehört, dass man möglicherweise die Nachfrage steigern sollte durch eine entsprechende Gesetzgebung, was dann Wasserstoff attraktiver machen könnte, aber auch durch Quoten für die verschiedenen Sektoren. Sinnvoll?
Matthes: Wenn man solche neuen Technologien in Märkte reinbringen will, dann kann man drei Dinge tun. Man kann einerseits Leute verpflichten, ihn zu nutzen. Man kann zweitens die Produktion fördern. Und man kann drittens die Alternativen teurer machen.
Am Ende des Tages wird es eine Mischung aus diesen drei Strategien machen. Die Alternativen teurer machen, das machen wir zunehmend.
Deutschlandfunk Kultur: Die fossilen Energien.
Matthes: Die fossilen Energien, indem wir CO²-Emissionen bepreisen über das europäische Emissionshandelssystem, über einheimische Systeme.
Deutschlandfunk Kultur: Aber viel zu wenig, um Wasserstoff tatsächlich wettbewerbsfähig zu machen.
Matthes: Ja. Deswegen wird es auch nur ein Element sein können. Wir werden Erzeugungsanlagen für die nächsten zehn Jahre subventionieren müssen, in den Markt rein kaufen. Nicht so sehr viele, aber es gibt ein paar Sektoren, wo man Unternehmen oder Verbraucher verpflichten kann, eine bestimmte Quote von Wasserstoff hinzubekommen. Das Problem bei diesen Quoten ist, dass sie relativ zielungenau sind. In der Wasserstoffstrategie sind 38 Aktivitäten aufgerufen.
Deutschlandfunk Kultur: In der europäische oder deutschen?
Matthes: In der deutschen.
Deutschlandfunk Kultur: Macht es eigentlich Sinn, dass es beides gibt?
Matthes: Ja. Es gibt einen Konkurrenzkampf.
Deutschlandfunk Kultur: Zwischen der europäischen und der deutschen.
Matthes: Ja, natürlich.
Weg vom Hype und rauf auf die Straße
Deutschlandfunk Kultur: Gehen die nicht Hand in Hand und macht es nicht nur gemeinsam Sinn in Europa?
Matthes: Zumindest Deutschland ist sehr stark technologieorientierter. Und wenn Sie die Kollegen von Siemens fragen, die wollen natürlich Elektrolyseanlagen verkaufen, Erzeugungsanlagen für Wasserstoff. Von daher gibt es da eine gesunde Konkurrenz. Das ist auch nicht schädlich. Wobei man zugegebenermaßen sagen muss, dass die deutsche Strategie ein bisschen weiterentwickelt ist und ein bisschen detaillierter ist. Mit Wasserstoff verbinden sich viele Hoffnungen. Einiges davon ist nicht belastbar, einiges sehr wichtig. Und was die deutsche wirklich vorbildlich gemacht hat, ist, dass sie diese Erwartungen, Hoffnungen, Möglichkeiten in 38 Pakete zerlegt hat und dass wir jetzt in jedem dieser Pakte gucken: Wird es funktionieren? Unter welchen Bedingungen wird es funktionieren? Welche Instrumente sind vorstellbar? – Damit bringen wir so eine Wasserstoffstrategie sozusagen vom Hype wirklich auf die Straße.
Deutschlandfunk Kultur: Aber es ist ein verspäteter Hype. Denn dass es bei der Herstellung von Wasserstoff nur Wasser und Strom braucht und dass es so wunderbar sauber verbrennt, wenn man es verbrennt, wieder Wasser rauskommt – das weiß man ja schon länger. Die ersten Strategien, aus diesem Stoff etwas wirklich Sinnträchtiges zu machen, gibt es im Jahre 2020. Warum jetzt?
Matthes: Weil eine wichtige Voraussetzung für klimafreundlichen Wasserstoff lange nicht da war oder auch umstritten war. Das ist nämlich, dass man sauberen Strom haben muss. Wenn man sich überlegt, im Jahr 2000 hatten wir fünf Prozent regenerativen Strom im System. Wir haben noch berühmte Wissenschaftler und berühmte Firmen im Jahr 1994 gehabt, die gesagt haben: Der maximale Anteil von regenerativ erzeugtem Strom am deutschen Stromaufkommen ist vier Prozent. Wir sind heute im Jahr 2020 bei fünfzig Prozent.
Deutschlandfunk Kultur: Im Sommer teilweise bei 100 Prozent.
Matthes: Genau. Aber das heißt, dass wir in einer Situation sind, und das ist der erste Punkt, glaube ich, dass 100 Prozent regenerative Stromerzeugung, saubere Stromerzeugung eine echte Option ist – und nicht erst in 50 Jahren, sondern in zehn oder in 20 Jahren. Das ist neu.
Die Wirkung vom Ziel, CO²-frei zu produzieren
Deutschlandfunk Kultur: Und dass bei den Klimazielen Druck gemacht wurde, wäre dann der andere Grund?
Matthes: Das ist der andere Grund. Wir haben lange diskutiert über Treibhausgasemissionsminderung von 80 Prozent. Das hieß immer, 20 Prozent blieben übrig. Und wenn man 20 Prozent übrighat, ist Erdgas am Ende unschlagbar. Der Durchbruch für die Wasserstoffdiskussion in großem Stil kam, nachdem Klimaneutralität – also null Treibhausgasemissionen – auf die politische Agenda kam.
Was wir Klimaneutralität nennen, hat dazu geführt, dass man heute auch für die letzten Prozentpunkte dieser Emissionsminderung eine Lösung braucht. Und Erdgas taugt dafür nicht.
Deutschlandfunk Kultur: Weil es auch noch CO² produziert.
Matthes: Weil es noch erhebliche CO²-Mengen produziert. Das heißt, man brauchte einen CO²-freien Energieträger, der das kann, was Strom nicht kann. Diese beiden Elemente haben dazu geführt, dass in den letzten drei bis vier Jahren diese Wasserstoffstrategie mit neuer Brisanz auf die Tagesordnung gekommen ist.
Man muss dazu sagen: Als ich beim Öko-Institut angefangen habe 1990 hatten wir auch schon eine große Wasserstoffdiskussion. Da war die aber sehr spekulativ.
Deutschlandfunk Kultur: In kleinen Kreisen von Fachleuten.
Matthes: Ja, und immer 50, 60 Jahre weit weg. Während wir jetzt in einer Situation sind, wo wir in 30 Jahren klimaneutral sein wollen und wo wir wissen, dass wir heute 50 Prozent regenerativ erzeugten Strom sauber produzieren können. Da hat das eine andere Verbindlichkeit und damit natürlich auch eine andere politisch-gesellschaftliche Durchschlagskraft.
Deutschlandfunk Kultur: Der Nationale Wasserstoffrat, dem Sie angehören, sagt mit Recht, Sie haben es auch schon erwähnt: Ohne Importe kann man diese Mengen von Wasserstoff, von denen wir reden, überhaupt nicht produzieren. Man muss ihn importieren – und zwar aus tendenziell wind- oder sonnenintensiven Ländern. Kleiner Schönheitsfehler ist, dass wir möglicherweise dabei in eine ähnliche Falle tappen könnten wie mit dem Erdöl.
Sie haben vorhin davon gesprochen, dass das Wunderbare an Wasserstoff ist, dass es eben nicht geopolitische Fragen nach sich zieht. Aber ganz stimmt das ja nicht. Denn wenn wir 70 Prozent – so heißt es, einige sprechen sogar noch von mehr – auf absehbare Zeit importieren müssen, und zwar aus wind- und sonnenenergiereiche Länder, dann reden wir zum Beispiel von Nordafrika. Oder wir reden von Chile. Wir reden auch von Australien. Das wäre ja noch nett. Da wäre dann wieder das Problem: Wie kriegen wir das Zeug hierher? Aber ansonsten sind das Länder mit instabilen politischen Verhältnissen, von denen wir uns dann wieder ein Stück abhängig machen würden.
Matthes: Ja, wir tun das aber heute bei Kupfer und bei vielen Rohstoffen auch.
Für Importe "an Nordafrika und Mittleren Osten gekettet"
Deutschlandfunk Kultur: Das macht es ja nicht besser.
Matthes: Das macht es nicht besser. Ich weiß auch gar nicht, ob Autarkie ein anstrebenswertes Ziel ist, denn vom Handel profitieren ja immer zwei. Aber ich würde sozusagen es ein bisschen abschichten. Eine der Herausforderungen beim Wasserstoff und gerade beim Import von Wasserstoff ist, dass der Transport extrem teuer ist. Das heißt, wir reden für das nächste Jahrzehnt sowieso nicht von großen Importmengen. Da wird das im Wesentlichen hier oder im benachbarten Ausland erzeugt werden. Aber mit der Perspektive auf 2040 und 2050 werden wir über mehrere Kreise sprechen müssen.
Der erste Kreis ist, dass man natürlich mit Spanien, mit Norwegen auch in der Nähe stabile Staaten haben, die eine wichtige Quelle sein können – wie gesagt, weil die Transportentfernung ein Killermechanismus ist.
Deutschlandfunk Kultur: Aber eine Energiepartnerschaft, die schon besteht, ist beispielsweise mit Marokko.
Matthes: Ja. Da ist dann die Frage, ob diese Energiepartnerschaft zunächst erst mal auf den Export von Wasserstoff aus Marokko nach Europa fokussiert ist. Das stimmt nämlich gar nicht, sondern das soll zunächst mal die Basis bilden für Ammoniakproduktion, also die Herstellung von chemischen Gütern in Marokko selbst.
Aber in diesem zweiten Kreis sind wir in Europa an Nordafrika und den Mittleren Osten gekettet. Da ist ein Unterschied zum Beispiel zu Nordamerika, wo OECD-Staaten wie Chile eine große Rolle spielen werden, oder zu Asien, wo Australien, auch ein stabiler Staat, eine große Rolle spielen wird. Wir Europäer werden – und deswegen ist es auch geopolitisch wichtig – die sein, die zuerst über Wasserstoffimporte aus Ländern reden, wo es mit der Governance und der Stabilität zumindest ein paar Fragezeichen gibt.
Deutschlandfunk Kultur: Und wie geht es Ihnen damit?
Matthes: Wir müssen das lösen.
Deutschlandfunk Kultur: Aber wie können wir es lösen? Die Regierungen sind, wie sie sind. Die Menschenrechtsverhältnisse sind wie sie sind. Die sozialen Verhältnisse sind wie sie sind.
Matthes: Deswegen wird das erstens nicht sofort passieren, sondern wir werden versuchen müssen, inwieweit wir diese Staaten auch mit Wasserstoff stabilisieren. Gerade die Staaten, die Probleme haben im sozialen, im politischen Bereich, resultieren die ja teilweise daraus, dass es eben auch nicht genug Strom gibt, dass es nicht genug Frischwasser gibt – das sind ja alles Dinge, die man dann auch zur H2-Erzeugung benötigt… Wir müssen versuchen, diese Staaten mit zu stabilisieren, weil sich zum Beispiel im Nahen Osten ja durchaus nicht nur die Frage steht, was könnten die eventuell an uns liefern, sondern was können sie nicht mehr an uns liefern.
Das heißt, man könnte das Argument auch umdrehen in Bezug auf die Regionen, aus denen wir heute Energie beziehen, dass möglicherweise die Wasserstofflieferung von dort vergleichsweise stabiler ist als eine Welt, in der wir von dort kein Öl und Gas mehr beziehen und dann sozusagen der Ausfall dieses Einkommens für diese Staaten, in diesen Gesellschaften noch viel, viel größere Umbrüche und damit auch geopolitische Gefahren für uns produziert.
Das ist nicht einfach. Das ist ein Balanceakt. Aber den kann man angehen. Und dann hat Wasserstoff auch das Potenzial zu stabilisieren. Weil, ein "Weiter so" ist natürlich auch sicherheitspolitisch nicht so der richtige Traum für uns.
"Champagner" der Energiewende sinnvoll konsumieren
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben schon mehrmals angesprochen, dass Wasserstoff in der Produktion, aber auch in der Lagerung und in der Verbreitung teuer ist. Manche sagen, es ist sozusagen der Champagner unter den Elementen der Energiewende. Wenn es denn Champagner ist und auf absehbarer Zeit teurer bleibt und auch in der Menge einfach nicht in dem Maße, wie man es vielleicht haben möchte, auf Anhieb verfügbar sein wird, wo ist er denn am sinnvollsten eingesetzt? Wir haben gesagt, er ist Energieträger. Er ist Rohstoff. Er ist Energiespeicher. Es gibt ihn gasförmig, flüssig, in reiner Form oder gemischt als eine Art Designerkraftstoff. Wo macht er dann am meisten Sinn?
Matthes: Da, wo man – um mal im Bild des Champagners zu bleiben – den größten Genuss hat. Aber Champagner ist teuer. Das heißt ja nicht, dass man ihn nicht trinken soll. Man soll ihn eben nur nicht aus Bierstiefeln trinken.
Die Frage ist beim Wasserstoff: Wo gibt es eigentlich keine Alternative dazu? Da haben wir zwei Bereiche, in denen das sehr klar ist: Das ist die chemische Industrie und das ist zweitens die Eisen- und Stahlindustrie. Wenn wir weiter Stahl produzieren wollen und das nicht mit Kohle tun wollen, werden wir das mit Wasserstoff tun müssen. Und wir haben eine Vielzahl von chemischen Prozessen, wo wir einfach Wasserstoff als Ausgangsmaterial brauchen.
Deutschlandfunk Kultur: Mobilität, sagen Sie jetzt interessanterweise nicht.
Matthes: Nicht in der ersten Gruppe. Die erste Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass es erkennbar keine Alternative gibt.
Dann gibt es einen zweiten Bereich, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es keine Alternativen gibt. Das ist der Flugverkehr. Das ist der Schiffsverkehr. Und das ist möglicherweise der Langstreckengüterverkehr auf der Straße. Da würde ich sagen, das sollten wir nicht ausschließen. Auch da gibt es beim Langstreckengüterverkehr Menschen, die sagen, "die Batterien werden zukünftig so leistungsfähig und so leicht, dass das auch funktioniert". Es gibt andere, die sagen: "Wir können Oberleitungen auf die Autobahn bauen." – Aber da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Wasserstoff in Kombination mit einer Brennstoffzelle oder als synthetischer Treibstoff zum Zuge kommt.
Und dann gibt es einen dritten Bereich, wo wir mit relativ hoher Sicherheit wissen, dass es eine Vielzahl von Alternativen gibt und die Alternativen auch grenzenlos konkurrenzfähig sind.
Deutschlandfunk Kultur: Stromerzeugung zum Beispiel?
Matthes: Ja, Stromerzeugung teilweise, aber auch beim Pkw – da wird das Rennen durch die Elektromobilität gemacht.
Wasserstoffautos gehören zur "politischen Folklore"
Deutschlandfunk Kultur: Das hören natürlich die Autobauer gar nicht gern, Herr Matthes. Denn manch einer der Branche hofft ein bisschen darauf, dass wir mit Wasserstoff oder mit synthetischen Kraftstoffen, in denen Wasserstoff eine Rolle spielen könnte, etwas verbrennen können, was wir dann schlicht und ergreifend in den vorhandenen Tank der noch mit Verbrennungsmotoren fahrenden Fahrzeuge packen können und die vorhandenen Tankstellen und die vorhandene Infrastruktur nutzen können.
Matthes: Aber das ist, glaube ich, eher politische Folklore. Wir haben im Wasserstoffrat neulich eine Stellungnahme gemacht zu einer europäischen Regelung. Da haben wir gesagt: Okay, lasst uns doch mal unsere Weltbilder nebeneinanderlegen – auch die Automobilindustrie und solche Leute wie wir. Diese Weltbilder waren erstaunlich ähnlich. An einen Wasserstoff-Pkw glaubt in der Automobilindustrie eigentlich niemand mehr so richtig. Die flüssigen Treibstoffe sind sehr voraussetzungsreich, mit vielen technologischen Fragen. Und es ist auch irre teuer.
Das heißt, wenn Sie sich wirklich mal sorgfältig angucken, was die Automobilindustrie außer es in politischen Veranstaltungen zu sagen, wirklich macht, dann konzentriert sie sich bei Wasserstoff schon auf die schweren Lkw und auf den Flugverkehr. Im Bereich der Gebäudeheizung und bei den Pkw wird er keine große Rolle spielen.
Und es ist am Ende des Tages auch richtig so. Wir müssen ja die Wasserstoffmengen ins Land bringen und wir müssen sie dann irgendwie auch bezahlen. Da muss man dann schon in die Richtung gehen, wo es keine Alternative gibt, das heißt, die Zahlungsbereitschaft eigentlich unendlich ist, und in Bereiche, wo die Alternativen möglicherweise nicht so dicht sind. Das ist ganz sicher im Schiffsverkehr. Das ist möglicherweise so bei den schweren Lkw.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben gesagt, ein Problem sind die Kosten. Möglicherweise wird sich über die Zeit da ein Ausgleich zu fossilen Brennstoffen finden lassen, indem diese einfach teuer werden. Die CO2-Abgabe beginnt irgendwann zu greifen. Es wird teurer werden, wenn auch manche sagen, dass das fossilen Brennstoff nicht schnell genug, nicht ausreichend teurer macht.
Das andere Kernproblem ist der Wirkungsgrad? Denn je weiter weg wir gehen von dem reinen Wasserstoff, der schwer zu handhaben ist, der hohe technische Voraussetzungen an die Produktion, aber eben auch an die Infrastruktur stellt, desto geringer ist der Wirkungsgrad – wie viel ich aus einem Liter von diesem Kraftstoff an Energie rausziehen kann.
Matthes: Am Ende geht es um Kosten. Da spielen natürlich Wirkungsgrade auch eine große Rolle.
Deutschlandfunk Kultur: Ja, und auch Mengen. Wenn ich unglaublich viel Wasserstoff produzieren muss, um dann einen Wirkungsgrad über den Umweg Brennstoffzelle oder eben synthetische Kraftstoffe zu bekommen, dann wird es ja auch einfach noch mal schwieriger.
Matthes: Aber wir haben schon auch Regionen in der Welt, wo man viel Strom erzeugen kann. Aber, wie gesagt, das Entscheidende ist gar nicht der Wirkungsgrad, sondern jede weitere Umwandlung ist mit relativ hohen Investitionskosten verbunden. Das heißt, da gehen nicht nur Prozentpunkte des Wirkungsgrads verloren, sondern man muss auch deutlich mehr Geld einsetzen. Und das ist am Ende des Tages für den Einsatz auf der Kostenseite entscheidend. Der Transport von Wasserstoff an sich bringt keine großen Wirkungsgradverluste mit sich, auch ein paar, aber nicht so große.
"Kostenzuschläge sind größer als Wirkunggradabschläge"
Deutschlandfunk Kultur: Aber die diversen Umwandlungen – ich muss den Wasserstoff erst gewinnen ...
Matthes: Ja, aber die Kosten sind sehr viel wichtiger. Die Kostenzuschläge sind sehr viel größer als die Wirkungsgradabschläge. Von daher wird man da vorsichtig sein müssen. Der Wirkungsgrad ist immer so ein bisschen Indikator, der einem etwas über die Kosten sagt. Und erneuerbarer Strom ist und bleibt ein kostbares Gut, auch wenn es natürlich in Chile oder in Nordafrika zu Preisen erzeugbar ist, von denen wir hier nur träumen können, weil es einen Unterschied macht, ob die Sonne 3000 Stunden scheint oder der Wind 6000 Stunden weht. Aber man muss sich die Größenordnung klarmachen.
Wenn wir zur heutigen Technologie bei uns Wasserstoff erzeugen, bräuchten wir einen CO2-Preis, der irgendwo 250, 300 Euro pro Tonne CO2 ist.
Deutschlandfunk Kultur: Was haben wir im Moment? 20, 30?
Mattes: Wir haben im Moment im europäischen Emissionshandel fast 30 Euro und demnächst jetzt im deutschen, im nationalen Emissionshandelssystem mal 60 Euro. Wenn wir die Kosten runterkriegen, dann kommen wir wahrscheinlich mal in die Größenordnung von 100 bis 150 Euro pro Tonne CO2, die wir brauchen, um eine Kostengleichheit etwa zu Erdgas herzustellen. Das ist nicht unvorstellbar, aber das ist im Vergleich zu den CO2-Preisen, die heute aufgerufen werden, noch ein vergleichsweise hoher Wert. Und das ist schon für den Fall, dass wir enorm erfolgreich mit der Kostensenkung sind.
Deutschlandfunk Kultur: Sie betrachten die relativ geringe Effektivität, wie viel Brennwert ein Kraftstoff hat, hauptsächlich unter dem Kostenfaktor. Aber wenn ich so wenig rausziehe aus einem Liter synthetischen Kraftstoff mit Wasserstoff beispielsweise – 13 Prozent, heißt es, ist die Energieeffektivität nur – dann ist das doch einfach auch nicht praktikabel, weil ich ungeheure Mengen brauche, um auf meinen Schnitt von 400 km pro Tankfüllung oder so was zu kommen.
Matthes: Wie gesagt, Energieeffizienz ist ein schwieriger Indikator. Wenn Sie sich heute eine Solarenergieanlage auf dem Dach angucken, dann wandelt die von der Sonne, die da einfällt, vielleicht 15 Prozent um. Das ist schon ganz gut, aber der Wirkungsgrad an sich ist nicht so besonders hoch. Es geht im Grunde genommen darum: Was kriegen Sie als Energieträger an Kosten zusammen? Diese Frage der Energieeffizienz ist extrem davon abhängig, wie Sie Systemgrenzen ziehen, wo Sie anfangen zu rechnen, wo Sie aufhören zu rechnen. Und am Ende des Tages steht auf dem Molekül Wasserstoff nicht eine Zahl 13 Prozent Wirkungsgrad, sondern es steht: Pro Megawattstunde 50 oder 70 oder 100 Euro an Kosten.
Ich würde einfach davor warnen, die Energieeffizienzfrage, die ist wichtig, die ist ein Indikator, aber am Ende des Tages zählt die Frage: Kann man so viel Strom erzeugen, regenerativen Strom, um das alles zu erzeugen? Da haben wir im Inland hier klare Grenzen. Wenn man den Import schafft, dann ist die Kostenfrage die entscheidende.
Wenn man Wasserstoff nur hier im Lande erzeugen würde, dann ist es sicherlich klar. Wir haben eine extrem begrenzte Fläche für regenerative Stromerzeugung. Dann würde auf einmal die Flächenrestriktion die ganze Wasserstoffentwicklung beschränken. Weil sie das aber schon so stark tut, glauben wir ja alle, dass wir es aus Regionen zumindest teilweise importieren müssen, wo diese Flächenrestriktion für die regenerative Stromerzeugung nicht so gravierend ist.
Wasserstoff ist "keine Religion" und keine "Erlösung"
Deutschlandfunk Kultur: Im Moment in Arbeit ist eine Reform des Gesetzes für Erneuerbare Energien in Deutschland, EEG. Da war bis diese Woche offenbar nicht klar, inwieweit Wasserstoff von der Umlage für erneuerbare Energien, die auf die Stromerzeugung kommt, ausgenommen wird. Das wäre natürlich schon fast ein Schildbürgerstreich, wenn man Wasserstoffproduktion subventioniert und dann anschließend aber auf das Produkt die Umlage für erneuerbare Energien draufgibt.
Matthes: Na ja, es gibt ja auf den Wasserstoff keine Umlage für erneuerbare Energien, sondern auf die Wasserstoffproduktion, für die Strom ein Input-Parameter ist. Es ist ja nicht das Ergebnis, sondern das Input-Parameter, wenn der teurer wird. Das zeigt aber noch mal, wie weit man gehen muss, wenn man solche Dinge wie Wasserstoff anstrebt.
Wasserstoff ist ja nicht eine Religion oder eine Erlösung, sondern ist eins von verschiedenen Klimaschutzinstrumenten. Ja, wir werden niemals konkurrenzfähigen oder halbwegs konkurrenzfähigen Wasserstoff erzeugen können, wenn wir den Strom mit der EEG-Umlage belasten. Aber gilt das Gleiche nicht auch für die Wärmepumpe, die mit Strom betrieben wird und Hauswärme erzeugt?
Das heißt: Wozu uns die Wasserstofffrage jetzt final zwingt, ist, dass wir dieses System von Steuern und von Abgaben und von Umlagen grundlegend modernisieren müssen, dass eben die Differenzkosten für die erneuerbaren Energien eben aus der CO2-Bepreisung gezahlt werden müssen und nicht über eine Umlage auf die Stromkosten. – Wie gesagt, das Beispiel mit der Wärmepumpe: Wenn die Wärmepumpe die EEG-Umlage bezahlen muss, die Wasserstoffproduktion oder nicht, schaffen wir da nicht auch schon wieder eine neue Verzerrung und halten die Wärmepumpe als eine sehr effiziente Technologie aus dem Markt raus, die CO2 spart, die mit wenig Strom viel mehr CO2 auch einsparen kann, weil wir eine andere Option, nämlich Wasserstoff, verbilligen?
Das zeigt mal, dass wir das ökonomische Rahmenbedingungssystem ins Lot bringen müssen. Das ist die große Aufgabe der nächsten Legislaturperiode. So, wie es ist, kann es nicht bleiben. Und an einer einzelnen Stelle, nur weil alle Freunde von Wasserstoff sind, das System zu reparieren, kann nicht lange halten, weil, das wird Flickwerk. Und irgendwann reißt Flickwerk.
Deutschlandfunk Kultur: Ihr nächstes Auto, Herr Matthes – welchen Antrieb wird es haben? Nachdem, was Sie gesagt haben, flüssigen Wasserstoff nicht. Sondern?
Matthes: Die Frage stellt sich für mich nicht, weil ich keinen Führerschein habe. Ich muss gestehen, dass meine Frau einen voll elektrischen Dienstwagen hat, in dem ich manchmal mitfahre. Beim Pkw glaube ich nicht an die Zukunft des Wasserstoffs.