Unschickliche Finsternis
Der britische Historiker Richard Cobb hat die zeitgenössischen Akten zu Pariser Wasserleichen der Zeit von 1795 bis 1801 ausgewertet und damit ein Stück französische Sozialgeschichte geschrieben.
Im Jahre 1900 wurde aus der Seine die Leiche einer hübschen jungen Frau geborgen, offenbar einer Selbstmörderin. Ihre Herkunft wurde nie geklärt. Ein Angestellter des Leichenschauhauses verfertigte von ihrem Antlitz eine Gipsmaske, die, vervielfältigt und verkauft, eine außerordentliche Aufmerksamkeit erfuhr. Die Unbekannte aus der Seine gedieh zu einem Lieblingsobjekt von Literaten, sie kommt in Gedichten, Prosaarbeiten und Dramen vor, in Frankreich wie im Ausland.
"Das Gesicht der jungen Ertränkten, das man abnahm, weil es schön war, weil es lächelte. Das Antlitz dessen, dem ein Gott das Gehör verschlossen hat, damit es keine Klänge gäbe, außer seinen."
So Rainer Maria Rilke.
Spätestens durch jenen Fund wurde deutlich, dass Frankreichs Hauptstadtfluss nicht nur als Transportweg dient, sondern auch als eine Art Massengrab. Diese makabre Funktion ist alt. Der britische Historiker Richard Cobb hat die zeitgenössischen Akten zu Pariser Wasserleichen der Zeit von 1795 bis 1801 ausgewertet und damit ein Stück französische Sozialgeschichte geschrieben.
Der 1996 im Alter von 78 Jahren Verstorbene war ein Sonderling. Das Kind einer Mittelstandsfamilie hielt sich fit durch Langstreckenlauf, vergrub sich jahrelang in französischen Archiven und ehe er Ordinarius in Oxford wurde, lebte er zunächst davon, dass er Stewardessen Sprachunterricht erteilte und finanzielle Unterstützung von der Kommunistischen Partei erhielt. Dabei war er selber kein Kommunist. In einem Leserbrief 1969 an das New York Times Literary Supplement behauptet er, von Marx nie eine Zeile gelesen zu haben.
"In unnachahmlicher Weise verband Cobb die Leidenschaft der Geschichtsforschung mit der Begabung zur Geschichtsschreibung."
So Patrick Bahners, langjähriger Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen. Er hat die deutsche Cobb-Ausgabe mit einem liebevollen Vorwort versehen, in dem er meint, der Autor sei in die Nähe des Poststrukturalisten Michel Foucault zu setzen.
Cobbs Vorzugsgegenstand als Historiograph war die Große Revolution, einer in Frankreich höchst ausführlich, von allen Seiten und allen Ideologien her behandelten Epoche. 1795, hier hebt Cobb an, war die Blutherrschaft der Terreur eben vorüber. Es gab das Direktorium. 1801, wo Cobb endet, herrschte bereits Napoleon.
Es geht um 404 Todesfälle, eingeliefert in die Basse-Gôrge an der Seine, das damalige Pariser Leichenschauhaus. Mehr als die Hälfte, nämlich 249, waren Selbstmörder, die anderen Opfer von Unfällen oder Verbrechen. Die Untersuchung erfolgte durch einen Friedensrichter und dessen zwei Gehilfen. Es ging darum, die Identität der Verstorbenen festzustellen.
"Justiz und Polizei reagierten im 18. Jahrhundert sehr empfindlich, wenn jemand in der Öffentlichkeit starb, zumal unter Gewaltanwendung – man fürchtete Nachahmer. Selbst das Bemühen, den Namen eines Toten herauszufinden, war nicht nur der Sorge um das öffentliche Wohl geschuldet. Indem man ihn der Finsternis unschicklicher Anonymität entriss, bezeugte man auch Achtung vor der Einzigartigkeit eines Menschen."
Die Feststellung der Identität geschah durch Aussagen von Zeugen, durch den Befund körperlicher Merkmale und, sofern vorhanden, von Kleidung. Letztere wurde nämlich gerne gestohlen. Zeugen fanden sich offenbar reichlich: Man lebte eng zusammen, kannte und beobachtete einander, und wenn es zur Selbsttötung kam, geschah sie häufig vor Publikum. Die dann entstandenen Protokolle lesen sich so:
"…männlicher Leichnam von ungefähr 45 Jahren… schwarze Haare, zu einem Zopf gebunden … eine Hose aus gesprenkeltem Tuch mit schwarzen Streifen, besetzt mit Messingknöpfen mit der Prägung "République française", eine Unterhose aus Barchent mit ähnlichen Knöpfen, eine Leibbinde, in der Hosentasche fand man einen Schlüssel…"
Cobb ist vornehmlich an den Selbstmorden interessiert. Er registriert Häufigkeit, Alter und Geschlecht. Männer brachten sich häufiger um als Frauen. Die Motive, nicht anders als anderswo, nicht anders auch als heute, sie waren: Einsamkeit, Krankheit, Betrogenwerden und materielles Elend.
Viele dieser unglücklichen gebürtigen Pariser, die etliche Jahre im selben Viertel gelebt und einen guten Namen, einen guten Ruf hatten, waren zu unbeweglich, um von dem expandierenden Arbeitsmarkt zu profitieren. Menschen, die nicht genügend Phantasie besaßen oder körperlich ungeeignet waren, um in einer rasch sich wandelnden Gesellschaft ihren Platz zu finden.
Fast sämtliche Selbstmörder entstammten der Unterschicht. Wassertod war das Suizidmittel der Armen, Wohlhabendere leisteten sich Gift oder eine Schusswaffe. Unmittelbare Auswirkungen der großen geschichtlichen Erschütterungen finden sich kaum.
"Man hat den Eindruck, dass in einer Gesellschaft, in der man so dicht aufeinander hockt wie in Paris am Ende des 18. Jahrhunderts, alles seine Zeit und seinen Ort hat: Tod, Geburt, Werben, Heiraten, Jahrmarkt, Rausch, Stehlen – ein Kalender, der aus einer Zeit lange vor der Revolution stammt, überhaupt nicht von ihr beeinflusst wurde, ja, sie vollkommen ignoriert."
Allen plebejischen Neigungen bei Jakobiner und Sansculotten zum Trotz: Die Revolution war eine durch und durch bürgerliche Angelegenheit. Auch dafür liefert Cobb die Fakten.
Sein Buch ist flüssig geschrieben. Manchmal verirrt es sich in statistische Einzelheiten, die nichts bestätigen als sich selbst. Die Akribie der zitierten Protokollanten ist erstaunlich; schwer vorstellbar, dass sich dergleichen andernorts fände. Am besten ist Cobb, wenn er konkrete Fälle und Schicksale erzählt. Namenlose erhalten einen Namen und ein winziges Stück Unsterblichkeit, das sie aus der Masse jener heraushebt, die stets brav gelebt haben, die normal gestorben und längst völlig vergessen sind.
Richard Cobb: Tod in Paris. Die Leichen der Seine 1795-1801
Klett-Cotta
"Das Gesicht der jungen Ertränkten, das man abnahm, weil es schön war, weil es lächelte. Das Antlitz dessen, dem ein Gott das Gehör verschlossen hat, damit es keine Klänge gäbe, außer seinen."
So Rainer Maria Rilke.
Spätestens durch jenen Fund wurde deutlich, dass Frankreichs Hauptstadtfluss nicht nur als Transportweg dient, sondern auch als eine Art Massengrab. Diese makabre Funktion ist alt. Der britische Historiker Richard Cobb hat die zeitgenössischen Akten zu Pariser Wasserleichen der Zeit von 1795 bis 1801 ausgewertet und damit ein Stück französische Sozialgeschichte geschrieben.
Der 1996 im Alter von 78 Jahren Verstorbene war ein Sonderling. Das Kind einer Mittelstandsfamilie hielt sich fit durch Langstreckenlauf, vergrub sich jahrelang in französischen Archiven und ehe er Ordinarius in Oxford wurde, lebte er zunächst davon, dass er Stewardessen Sprachunterricht erteilte und finanzielle Unterstützung von der Kommunistischen Partei erhielt. Dabei war er selber kein Kommunist. In einem Leserbrief 1969 an das New York Times Literary Supplement behauptet er, von Marx nie eine Zeile gelesen zu haben.
"In unnachahmlicher Weise verband Cobb die Leidenschaft der Geschichtsforschung mit der Begabung zur Geschichtsschreibung."
So Patrick Bahners, langjähriger Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen. Er hat die deutsche Cobb-Ausgabe mit einem liebevollen Vorwort versehen, in dem er meint, der Autor sei in die Nähe des Poststrukturalisten Michel Foucault zu setzen.
Cobbs Vorzugsgegenstand als Historiograph war die Große Revolution, einer in Frankreich höchst ausführlich, von allen Seiten und allen Ideologien her behandelten Epoche. 1795, hier hebt Cobb an, war die Blutherrschaft der Terreur eben vorüber. Es gab das Direktorium. 1801, wo Cobb endet, herrschte bereits Napoleon.
Es geht um 404 Todesfälle, eingeliefert in die Basse-Gôrge an der Seine, das damalige Pariser Leichenschauhaus. Mehr als die Hälfte, nämlich 249, waren Selbstmörder, die anderen Opfer von Unfällen oder Verbrechen. Die Untersuchung erfolgte durch einen Friedensrichter und dessen zwei Gehilfen. Es ging darum, die Identität der Verstorbenen festzustellen.
"Justiz und Polizei reagierten im 18. Jahrhundert sehr empfindlich, wenn jemand in der Öffentlichkeit starb, zumal unter Gewaltanwendung – man fürchtete Nachahmer. Selbst das Bemühen, den Namen eines Toten herauszufinden, war nicht nur der Sorge um das öffentliche Wohl geschuldet. Indem man ihn der Finsternis unschicklicher Anonymität entriss, bezeugte man auch Achtung vor der Einzigartigkeit eines Menschen."
Die Feststellung der Identität geschah durch Aussagen von Zeugen, durch den Befund körperlicher Merkmale und, sofern vorhanden, von Kleidung. Letztere wurde nämlich gerne gestohlen. Zeugen fanden sich offenbar reichlich: Man lebte eng zusammen, kannte und beobachtete einander, und wenn es zur Selbsttötung kam, geschah sie häufig vor Publikum. Die dann entstandenen Protokolle lesen sich so:
"…männlicher Leichnam von ungefähr 45 Jahren… schwarze Haare, zu einem Zopf gebunden … eine Hose aus gesprenkeltem Tuch mit schwarzen Streifen, besetzt mit Messingknöpfen mit der Prägung "République française", eine Unterhose aus Barchent mit ähnlichen Knöpfen, eine Leibbinde, in der Hosentasche fand man einen Schlüssel…"
Cobb ist vornehmlich an den Selbstmorden interessiert. Er registriert Häufigkeit, Alter und Geschlecht. Männer brachten sich häufiger um als Frauen. Die Motive, nicht anders als anderswo, nicht anders auch als heute, sie waren: Einsamkeit, Krankheit, Betrogenwerden und materielles Elend.
Viele dieser unglücklichen gebürtigen Pariser, die etliche Jahre im selben Viertel gelebt und einen guten Namen, einen guten Ruf hatten, waren zu unbeweglich, um von dem expandierenden Arbeitsmarkt zu profitieren. Menschen, die nicht genügend Phantasie besaßen oder körperlich ungeeignet waren, um in einer rasch sich wandelnden Gesellschaft ihren Platz zu finden.
Fast sämtliche Selbstmörder entstammten der Unterschicht. Wassertod war das Suizidmittel der Armen, Wohlhabendere leisteten sich Gift oder eine Schusswaffe. Unmittelbare Auswirkungen der großen geschichtlichen Erschütterungen finden sich kaum.
"Man hat den Eindruck, dass in einer Gesellschaft, in der man so dicht aufeinander hockt wie in Paris am Ende des 18. Jahrhunderts, alles seine Zeit und seinen Ort hat: Tod, Geburt, Werben, Heiraten, Jahrmarkt, Rausch, Stehlen – ein Kalender, der aus einer Zeit lange vor der Revolution stammt, überhaupt nicht von ihr beeinflusst wurde, ja, sie vollkommen ignoriert."
Allen plebejischen Neigungen bei Jakobiner und Sansculotten zum Trotz: Die Revolution war eine durch und durch bürgerliche Angelegenheit. Auch dafür liefert Cobb die Fakten.
Sein Buch ist flüssig geschrieben. Manchmal verirrt es sich in statistische Einzelheiten, die nichts bestätigen als sich selbst. Die Akribie der zitierten Protokollanten ist erstaunlich; schwer vorstellbar, dass sich dergleichen andernorts fände. Am besten ist Cobb, wenn er konkrete Fälle und Schicksale erzählt. Namenlose erhalten einen Namen und ein winziges Stück Unsterblichkeit, das sie aus der Masse jener heraushebt, die stets brav gelebt haben, die normal gestorben und längst völlig vergessen sind.
Richard Cobb: Tod in Paris. Die Leichen der Seine 1795-1801
Klett-Cotta
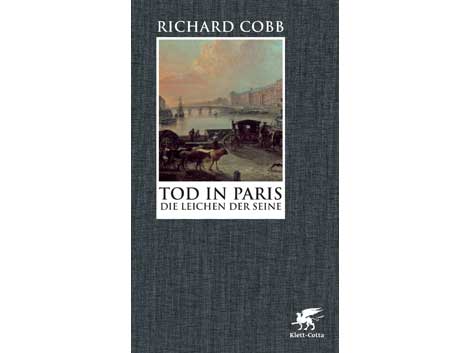
Cover Richard Cobb: "Tod in Paris"© Verlag Klett-Cotta
