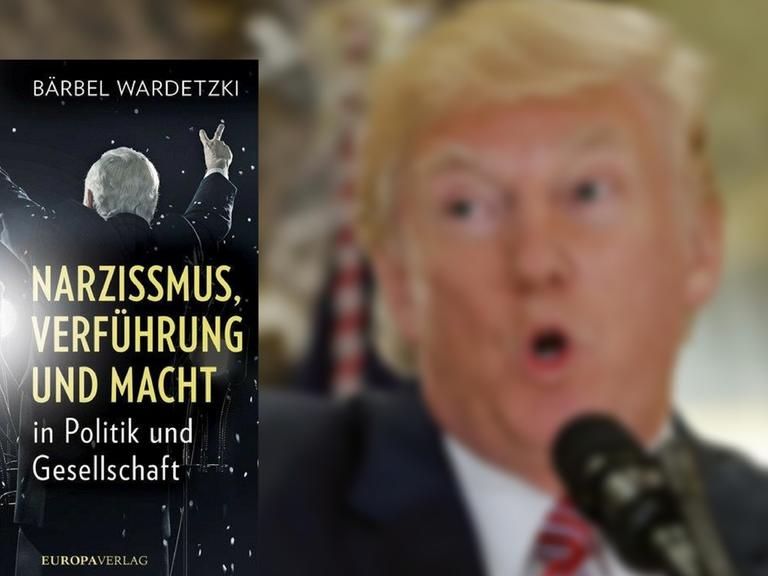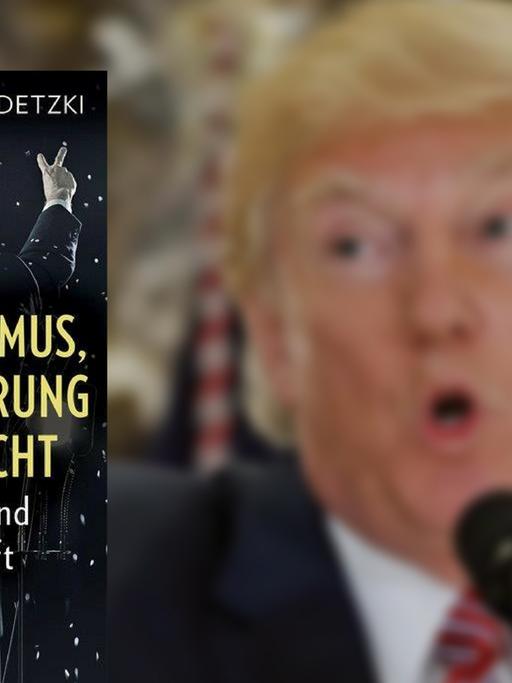Gesine Palmer, geboren 1960 in Schleswig-Holstein, studierte Pädagogik, evangelische Theologie, Judaistik und allgemeine Religionsgeschichte in Lüneburg, Hamburg, Jerusalem und Berlin. Nach mehrjähriger wissenschaftlicher Lehr- und Forschungstätigkeit gründete die Religionsphilosophin2007 das "Büro für besondere Texte".
Lob der Unberechenbarkeit

Das Klimaabkommen in Gefahr, Eskalation im Nordkorea Konflikt, wüste Drohungen gegen Venezuela. Politik und Medien seien sich einig darin, das größte Problem ist Trumps Unberechenbarkeit. Diese Diagnose hält Theologin Gesine Palmer für falsch. Wir sollten uns keine Berechenbarkeit in der Politik wünschen.
Eine der meist gehörten Klagen über den schon nicht mehr ganz so neuen Präsidenten im Weißen Haus lautet, er sei unberechenbar. Wenn ich so etwas höre, frage ich mich immer, ob die Leute eigentlich wissen, was sie reden. Sollte er denn etwa berechenbar sein? Berechenbar sind Roboter. Und theoretisch lässt sich natürlich auch denken, dass wir alle Staatsämter zukünftig mit Robotern besetzen. Die treffen immer nur sachliche Entscheidungen und machen alles richtig, wenn sie richtig berechnet sind.
Das Problem der Prinzipienlosigkeit
Was die Trump-Kritiker wollen, ist natürlich etwas anderes. Sie hoffen auf Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, sowas. Und ein bisschen auch auf Verständlichkeit. Was ist verständlich? Jemandem, der lange im Politikbetrieb gearbeitet hat, ist eine bestimmte strategische Denke verständlich. Ein bisschen Tugend, ein bisschen Verlässlichkeit, nicht zu viel, und ein bisschen Taktieren hier, Lavieren da, ab und zu den Rücken gerade machen, aber nicht zu sehr, und wenn man sich selbst ausgiebig darstellt, dann bitte nur, indem man dazu sagt, wie schlecht man die Selbstdarstellerei überhaupt und besonders beim politischen Gegner findet. Trump hingegen, so sagt die gut eingepegelte Schule der linksliberalen Routiniers, übertreibt es mit der Selbstdarstellung, folgt seinen Launen, sagt heute so und morgen so und ist prinzipienlos, überhaupt nicht "reif" für das Amt.
Unberechenbarkeit als Chance auf etwas Neues
Nur: Gewählt worden ist er genau deswegen. Wenn seine Wählerinnen und Wähler sagten, sie könnten Hillary Clinton nicht vertrauen, dann deswegen, weil sie sie für berechnend und berechenbar hielten: es würde von dort nichts Neues kommen, so glaubten sie zu wissen. Von Trump wussten sie nichts. Darin lag ihre Hoffnung. Das ist einerseits natürlich furchtbar dumm. Und ich habe inständig bis zuletzt gehofft, dass Hillary Clinton es schaffen würde. Aber das hoffte ich gerade, weil ich sie nicht für berechenbar hielt. Ich traute ihr vielmehr etwas zu, das ich im guten Sinne mit politischer Erfahrung verbinde: Gewissenhaftigkeit. Ich traute ihr zu, dass sie ihre Entscheidungen, die in der ganzen Welt Auswirkungen haben würden, nach bestem Wissen und Gewissen treffen würde. Sie würde sich verpflichtet fühlen, ihre Entscheidungen, die falschen und die richtigen, zu erklären. Sie würde sich, so gut sie könnte, an Verträge halten – und sie würde, wenn sie davon abwiche, öffentlich Rechenschaft ablegen. Dieses erwarte ich von demokratischen Politikerinnen und Politikern – und ich würde es Gewissenhaftigkeit nennen, auch Verlässlichkeit.
Zur Verlässlichkeit gehört aber paradoxerweise gerade ein Stück Unberechenbarkeit. Ich kann nur einem Menschen vertrauen, der stark genug ist, eine von mir unberechenbare Entscheidung zu treffen. Unser Handeln ist geradezu per Definition an die Möglichkeit des Neuen, und damit an Unberechenbarkeit gebunden. Nur weil Handeln unberechenbar ist, können wir es als Chance auf etwas anderes, vielleicht besseres verstehen. Das hat die Philosophin Hannah Arendt eindrücklich gezeigt.
Gewissenhaftigkeit gefordert
Davon mögen die, die Trump gewählt haben, nicht mehr als eine Intuition gehabt haben. Aber ihre Wahl zeigt ein bekanntes Phänomen: Gerade wo nach ihren Berechnungen alles nur noch schief gehen kann, setzen sie ihre letzte Hoffnung auf Veränderung zum Besseren in die Unberechenbarkeit des Mannes, der ihnen am meisten verspricht. Das muss nicht unbedingt schiefgehen. Damit es nicht schiefgeht, müsste Trump aber nicht berechenbarer werden. Das ist er längst viel zu sehr: Schmeichel ihm und alles ist gut, kritisiere ihn und du kannst gehen. Nein, er müsste verlässlicher und gewissenhafter gegenüber den Institutionen und der Wählerschaft werden, die ihm als amerikanischen Präsidenten so viel zutrauen.